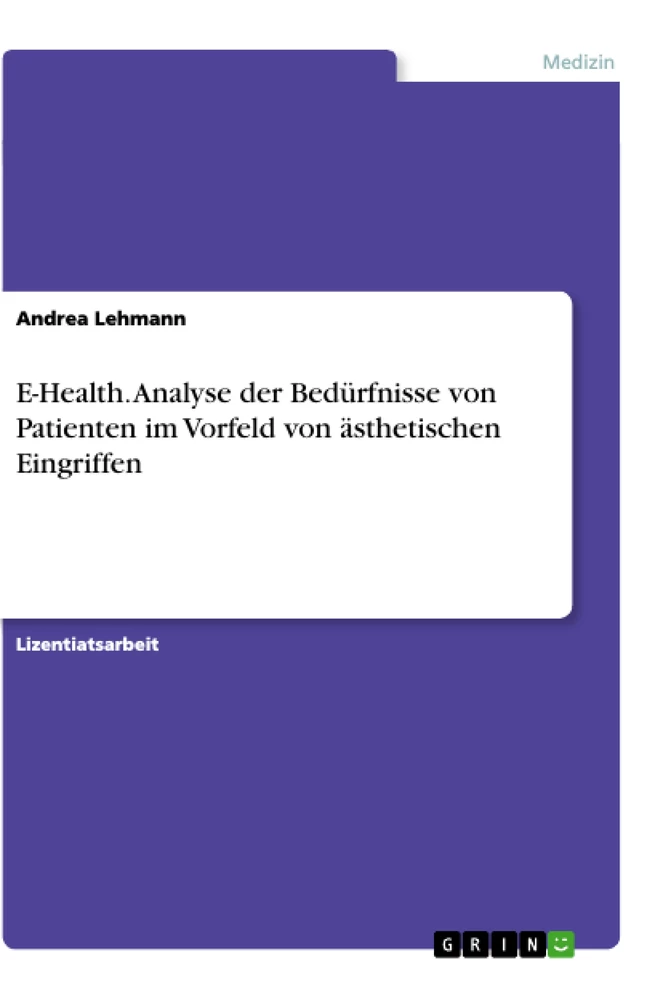
E-Health. Analyse der Bedürfnisse von Patienten im Vorfeld von ästhetischen Eingriffen
Lizentiatsarbeit, 2009
103 Seiten, Note: 5.6
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- TEIL 1: THEORETISCHE GRUNDLAGEN
- 1. Einleitung
- 1.1. Ausgangslage und Problemstellung
- 1.2. Zielsetzungen
- 2. Begriffliche Grundlagen
- 2.1. E-Health
- 2.2. Plastische Chirurgie
- 3. Nutzen des Medienkonsums
- 3.1. Nutzen- und Gratifikationsansatz
- 3.2. Das aktive Publikum
- 3.3. Selektion des Mediums
- 3.4. Nutzen und Gratifikationen in Neuen Medien
- 4. Internet-Foren
- 4.1. Entwicklung
- 4.2. Virtuelle Gemeinschaft
- 4.3. Herstellung und Weitergabe von Wissen
- 4.4. Usability von Diskussionsforen
- 5. E-Health
- 5.1. Entwicklung
- 5.2. Inhalt von E-Health-Angeboten
- 5.3. Chancen und Risiken
- 5.4. Auswirkungen von E-Health auf die Arzt-Patient-Beziehung
- 5.5. Weitere Auswirkungen von E-Health
- 5.6. Rechtliche Schranken
- 6. Schönheitsoperationen
- 6.1. Bedeutung in der Gesellschaft
- 6.2. Entscheidungsfaktoren
- 6.3. Spezifische Informationsbedürfnisse
- TEIL 2: EMPIRISCHER TEIL
- 7. Methodisches Vorgehen
- 7.1. Forschungsfragen
- 7.2. Auswahl der Untersuchungseinheiten
- 7.3. Forschungsmethode und Datenerhebung
- 7.4. Pretest
- 7.5. Untersuchungseinheiten
- 8. Inhaltsanalyse
- 8.1. Gesuchte Inhalte
- 8.2. Gründe für die Wahl von Diskussionsforen
- 8.3. Erhaltene Gratifikationen in Diskussionsforen
- 8.4. Einfluss auf die Arzt-Patient-Beziehung
- 9. Diskussion und Fazit
- 9.1. Geeignete Diskussionsforen
- 9.2. Trends in der Schönheitschirurgie
- 9.3. Intimchirurgie
- 9.4. Schönheitschirurgie als Unterhaltung
- 9.5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Lizentiatsarbeit analysiert den Bedarf von Patienten an Informationen im Vorfeld ästhetischer Eingriffe im Kontext von E-Health. Die Arbeit untersucht die Nutzung von Online-Ressourcen, insbesondere Internetforen, und deren Einfluss auf die Arzt-Patient-Beziehung.
- Informationsbedürfnisse von Patienten vor ästhetischen Eingriffen
- Nutzung von E-Health-Ressourcen (insbesondere Internetforen)
- Der Nutzen- und Gratifikationsansatz im Kontext der Informationsbeschaffung
- Auswirkungen der Online-Kommunikation auf die Arzt-Patient-Beziehung
- Rechtliche und ethische Aspekte von E-Health im Bereich der Schönheitschirurgie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung (Kapitel 1) beschreibt die Ausgangslage und die Problemstellung. Kapitel 2 legt die begrifflichen Grundlagen zu E-Health und plastischer Chirurgie dar. Kapitel 3 beleuchtet den Nutzen des Medienkonsums, während Kapitel 4 Internetforen als Informationsquelle näher untersucht. Kapitel 5 befasst sich umfassend mit E-Health, seinen Chancen, Risiken und Auswirkungen. Kapitel 6 fokussiert auf Schönheitsoperationen, deren gesellschaftliche Bedeutung und die spezifischen Informationsbedürfnisse der Patienten. Kapitel 7 beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung. Die Ergebnisse der Inhaltsanalyse von Internetforen werden in Kapitel 8 präsentiert, wobei die Aspekte der Informationsbeschaffung, Gratifikationen und des Einflusses auf die Arzt-Patient-Beziehung betrachtet werden.
Schlüsselwörter
E-Health, ästhetische Eingriffe, Schönheitschirurgie, Internetforen, Patienteninformation, Arzt-Patient-Beziehung, Nutzen- und Gratifikationsansatz, Online-Kommunikation, Informationsbedürfnisse.
Details
- Titel
- E-Health. Analyse der Bedürfnisse von Patienten im Vorfeld von ästhetischen Eingriffen
- Hochschule
- Université de Fribourg - Universität Freiburg (Schweiz) (Medien- und Kommunikationswissenschaft)
- Note
- 5.6
- Autor
- Andrea Lehmann (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2009
- Seiten
- 103
- Katalognummer
- V182823
- ISBN (eBook)
- 9783656066521
- ISBN (Buch)
- 9783656630739
- Dateigröße
- 3170 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- analyse bedürfnisse patienten vorfeld eingriffen schönheitsoperation forum arzt medienkompetenz gesundheitswesen social media
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 50,99
- Arbeit zitieren
- Andrea Lehmann (Autor:in), 2009, E-Health. Analyse der Bedürfnisse von Patienten im Vorfeld von ästhetischen Eingriffen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/182823
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









