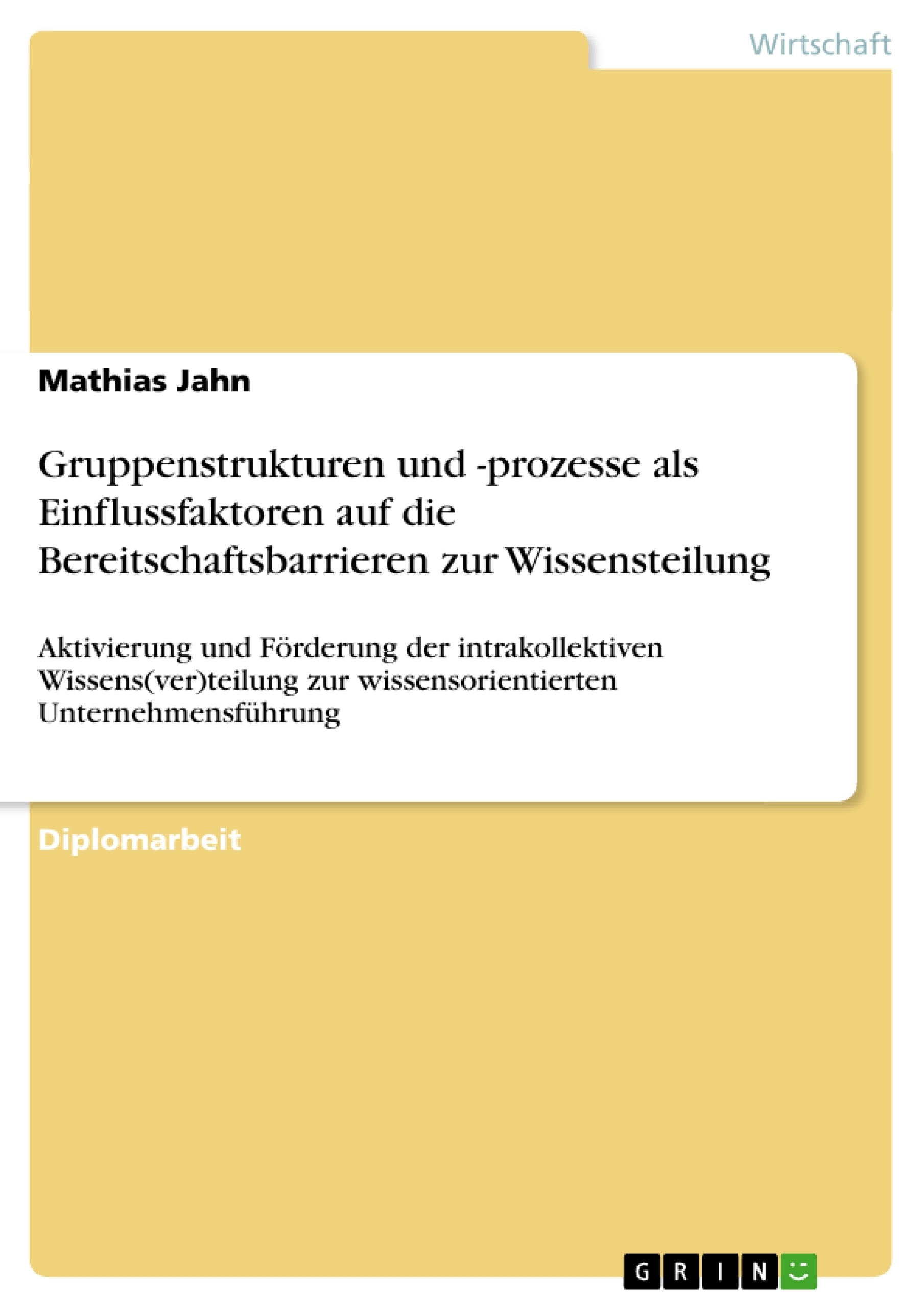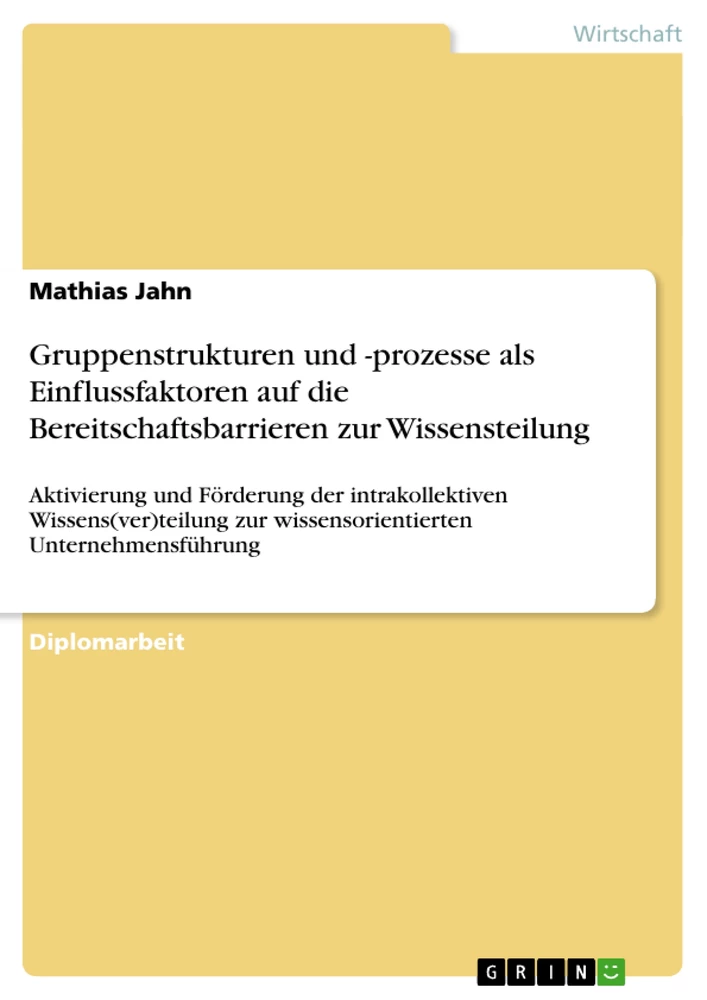
Gruppenstrukturen und -prozesse als Einflussfaktoren auf die Bereitschaftsbarrieren zur Wissensteilung
Diplomarbeit, 2003
182 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung und methodisches Vorgehen
- 2. Wissen
- 2.1 Was ist Wissen? – Abgrenzung zu Daten und Information
- 2.2 Perspektiven des Wissens - Wissensbasis
- 2.2.1 Perspektiven
- 2.2.1.1 Wissen als „Objekt“
- 2.2.1.2 Wissen als „Prozess“
- 2.2.2 Die „organisationale Wissensbasis“
- 2.2.2.1 Wissensarten
- 2.2.2.2 Wissensträger
- 2.3 Die Bedeutung des Wissens als Wettbewerbsfaktor
- 3. Grundlagen des Wissensmanagements
- 3.1 Wissensmanagement - empirische Befunde
- 3.2 Betrachtungen zum Wissensmanagement aus theoretischer Sicht
- 3.2.1 Zum Begriff des Wissensmanagements
- 3.2.2 Überblick über die Ansätze und Konzepte des Wissensmanagements
- 3.2.3 Technik- versus humanorientiertes Wissensmanagement
- 3.2.4 Ganzheitliches Wissensmanagement
- 3.2.5 Bausteinmodell des Wissensmanagements nach Probst et al
- 3.2.5.1 Wissensziele
- 3.2.5.2 Wissensidentifikation
- 3.2.5.3 Wissenserwerb
- 3.2.5.4 Wissensentwicklung
- 3.2.5.5 Wissens(ver)teilung
- 3.2.5.6 Wissensnutzung
- 3.2.5.7 Wissensbewahrung
- 3.2.5.8 Wissensbewertung
- 3.3 Zusammenfassung
- 4. Baustein „Wissens(ver)teilung“ – theoretische Fundierung
- 4.1 Verständnis und Aufgaben nach Probst et al
- 4.2 Grundsatzfragen zur Wissens(ver)teilung
- 4.2.1 Inhalte, Zeitpunkt, Verortung und Umfang der Wissens(ver)teilung
- 4.2.2 Erwünschte Formen der Wissens(ver)teilung
- 4.2.3 Auswirkungen mangelhafter versus übertriebener Wissens(ver)teilung
- 4.2.3.1 Gefahren und Kosten der Wissens(ver)teilung
- 4.2.3.2 Nutzen der Wissens(ver)teilung
- 4.2.3.3 Relativer Nutzen der Wissens(ver)teilung
- 4.3 Der Wissens(ver)teilungsprozess - Teilprozesse der Wissensdiffusion
- 4.3.1 Problematik der Teilbarkeit von Wissen
- 4.3.2 Modell der Wissensdiffusion nach Seidel
- 4.3.2.1 Die Phase der „Teilung“
- 4.3.2.2 Die Phase des „Transfers“
- 4.3.2.3 Die Phase der „Veränderung der Wissensbasis“
- 4.3.3 Determinanten des Verhaltens – Einflussfaktoren im Diffusionsprozess
- 4.3.3.1 „Soziales Dürfen“
- 4.3.3.2 „Situative Ermöglichung“
- 4.3.3.3 „Können“
- 4.3.3.4 „Wollen“
- 4.3.4 Konzentration auf die Bereitschaft zur Wissensteilung – „Wollen“
- 4.4 Bereitschaftsbarrieren zur Wissensteilung
- 4.4.1 Empirische Ergebnisse
- 4.4.2 Individuelle Bereitschaftsbarrieren zur Wissensteilung – die Theorie
- 4.4.2.1 Machttheoretische und mikropolitische Überlegungen
- 4.4.2.2 Wettbewerbstheoretische Überlegungen
- 4.4.2.3 Psychologische Überlegungen
- 4.4.2.4 Konflikt- und Kooperationstheoretische Überlegungen
- 4.5 Zusammenfassung
- 5. Gruppen als kollektive Wissensträger
- 5.1 Gruppe, Arbeitsgruppe und Team
- 5.2 Arten von Arbeitsgruppen – Teamarbeit
- 5.2.1 Informelle Arbeitsgruppen – Wissensgemeinschaften
- 5.2.2 Formelle Arbeitsgruppen – Projektteams
- 5.2.3 Teamarbeit - Chancen und Risiken
- 5.3 Bezugsrahmen der Analyse
- 5.4 Gruppenstrukturen und Gruppenprozesse als Einflussfaktoren
- 5.4.1 Gruppenstrukturen
- 5.4.1.1 Größe
- 5.4.1.2 Rollen
- 5.4.1.3 Heterogenität - Diversität
- 5.4.1.4 Fähigkeiten
- 5.4.2 Gruppenprozesse
- 5.4.2.1 Normen
- 5.4.2.2 Gruppenkohäsion
- 5.4.3 Wechselseitige Wirkungsmechanismen und erste Implikationen
- 5.5 Zusammenfassung
- 6. Gestaltungsempfehlungen und Interventionsmaßnahmen
- 6.1 Organisationskultur – Wandel zu einer “Sharing Culture”
- 6.2 Wissensorientierte und gruppenbasierte Anreizsysteme
- 6.3 Führung und Gruppe
- 6.3.1 Leadership Development – Führungsstil
- 6.3.2 Team Member Selection
- 6.3.3 Team Building
- 6.3.4 Team Training
- 7. Schlussbetrachtung
- 7.1 Zusammenfassung und kritische Würdigung
- 7.2 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den Einfluss von Gruppenstrukturen und -prozessen auf die Bereitschaftsbarrieren zur Wissensteilung in Unternehmen. Sie verfolgt das Ziel, ein besseres Verständnis für die Entstehung und Überwindung dieser Barrieren zu entwickeln und konkrete Gestaltungsempfehlungen für die Förderung der intrakollektiven Wissens(ver)teilung zu erarbeiten.
- Die Bedeutung des Wissens als Wettbewerbsfaktor
- Die Grundlagen des Wissensmanagements und dessen theoretische Ansätze
- Die Analyse von Bereitschaftsbarrieren zur Wissensteilung und deren Ursachen
- Die Rolle von Gruppenstrukturen und -prozessen im Wissensteilungsprozess
- Die Entwicklung von Gestaltungsempfehlungen und Interventionsmaßnahmen für die Förderung der Wissens(ver)teilung in Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung und Zielsetzung des Projekts erläutert. Im zweiten Kapitel wird der Begriff „Wissen“ definiert und in Abgrenzung zu Daten und Informationen betrachtet. Anschließend werden verschiedene Wissensarten und -träger vorgestellt. Das dritte Kapitel widmet sich den Grundlagen des Wissensmanagements, wobei empirische Befunde sowie verschiedene theoretische Ansätze beleuchtet werden. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Bausteinmodell des Wissensmanagements nach Probst et al., welches die einzelnen Phasen des Wissensmanagements beschreibt.
Kapitel vier konzentriert sich auf den Baustein „Wissens(ver)teilung“ und betrachtet dessen theoretische Fundierung. Es werden die Aufgaben der Wissens(ver)teilung nach Probst et al. erläutert sowie die grundsätzlichen Fragen nach Inhalten, Zeitpunkt, Verortung und Umfang der Wissens(ver)teilung. Weiterhin werden die Auswirkungen mangelhafter und übertriebener Wissens(ver)teilung diskutiert, wobei sowohl die Gefahren und Kosten als auch der Nutzen der Wissens(ver)teilung im Vordergrund stehen.
Kapitel fünf stellt Gruppen als kollektive Wissensträger vor und analysiert verschiedene Gruppenformen sowie deren Chancen und Risiken. Anschließend werden Gruppenstrukturen und -prozesse als Einflussfaktoren auf die Bereitschaftsbarrieren zur Wissensteilung untersucht.
Das sechste Kapitel stellt Gestaltungsempfehlungen und Interventionsmaßnahmen zur Förderung der intrakollektiven Wissens(ver)teilung vor. Dabei werden Themen wie Organisationskultur, Anreizsysteme und Führungsrolle behandelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit Themen wie Wissensmanagement, Wissens(ver)teilung, Bereitschaftsbarrieren, Gruppenstrukturen, Gruppenprozesse, Teamarbeit, Anreizsysteme und Führungsstil.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Wissensteilung in Unternehmen heute so wichtig?
Wissen gilt als der „vierte Produktionsfaktor“. Durch die Fragmentierung von Fachgebieten und komplexe Produkte ist der Austausch in Teams essenziell für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit.
Welche Barrieren verhindern die freiwillige Wissensteilung?
Individuelle Barrieren können machttheoretisch (Wissen ist Macht), psychologisch (Angst vor Fehlern) oder wettbewerbsorientiert (Angst vor Ersetzbarkeit) begründet sein.
Wie beeinflussen Gruppenstrukturen den Wissensaustausch?
Faktoren wie Gruppengröße, Rollenverteilung, Heterogenität (Diversität) und die vorhandenen Fähigkeiten der Mitglieder bestimmen maßgeblich, wie effektiv Wissen in der Gruppe fließt.
Was versteht man unter einer „Sharing Culture“?
Es ist eine Organisationskultur, die den Austausch von Wissen aktiv fördert und belohnt, statt Einzelwissen als Machtinstrument zu schützen.
Welche Rolle spielt die Führung bei der Wissensteilung?
Führungskräfte müssen als Vorbilder agieren, psychologische Sicherheit schaffen und Anreizsysteme etablieren, die kollektive Beiträge zum Teamerfolg würdigen.
Details
- Titel
- Gruppenstrukturen und -prozesse als Einflussfaktoren auf die Bereitschaftsbarrieren zur Wissensteilung
- Untertitel
- Aktivierung und Förderung der intrakollektiven Wissens(ver)teilung zur wissensorientierten Unternehmensführung
- Hochschule
- Universität der Bundeswehr München, Neubiberg (Institut für Personal- und Organisationsforschung - Professur für Arbeits- und Organisationspsychologie)
- Note
- 1,0
- Autor
- Mathias Jahn (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2003
- Seiten
- 182
- Katalognummer
- V18328
- ISBN (eBook)
- 9783638226981
- ISBN (Buch)
- 9783656535829
- Dateigröße
- 1411 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Textseiten 145 (inklusive 4 Seiten Anhang) 314 Referenzen (davon 120 englischsprachige Quellen) Bietet sehr gute Möglichkeiten für weitergehende Forschungsambitionen (theoretisch wie auch empirisch)
- Schlagworte
- Gruppenstrukturen Gruppenprozesse Einflussfaktoren Bereitschaftsbarrieren Wissensteilung Aktivierung Förderung Wissens(ver)teilung Rahmen Unternehmensführung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 42,99
- Preis (Book)
- US$ 56,99
- Arbeit zitieren
- Mathias Jahn (Autor:in), 2003, Gruppenstrukturen und -prozesse als Einflussfaktoren auf die Bereitschaftsbarrieren zur Wissensteilung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/18328
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-