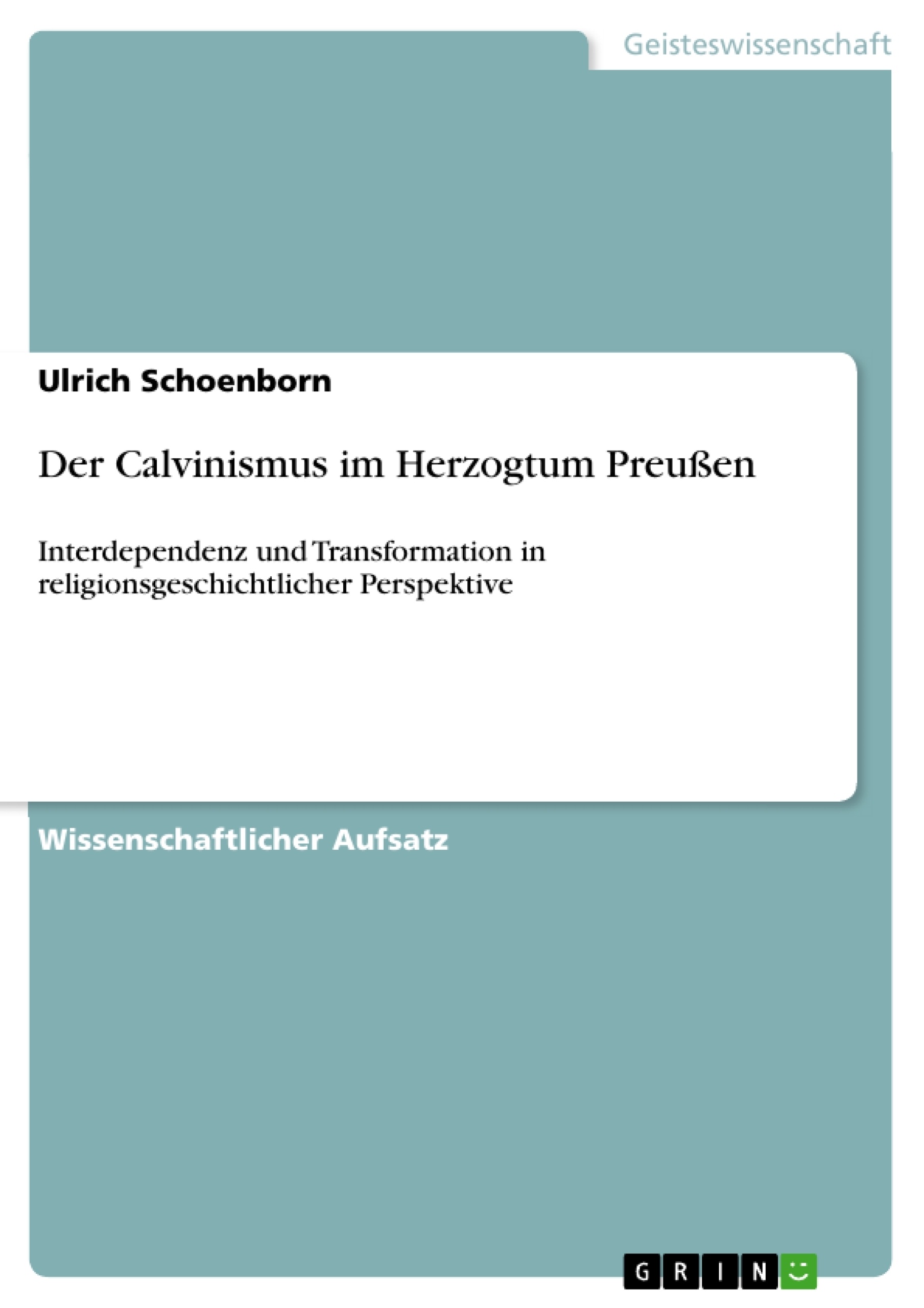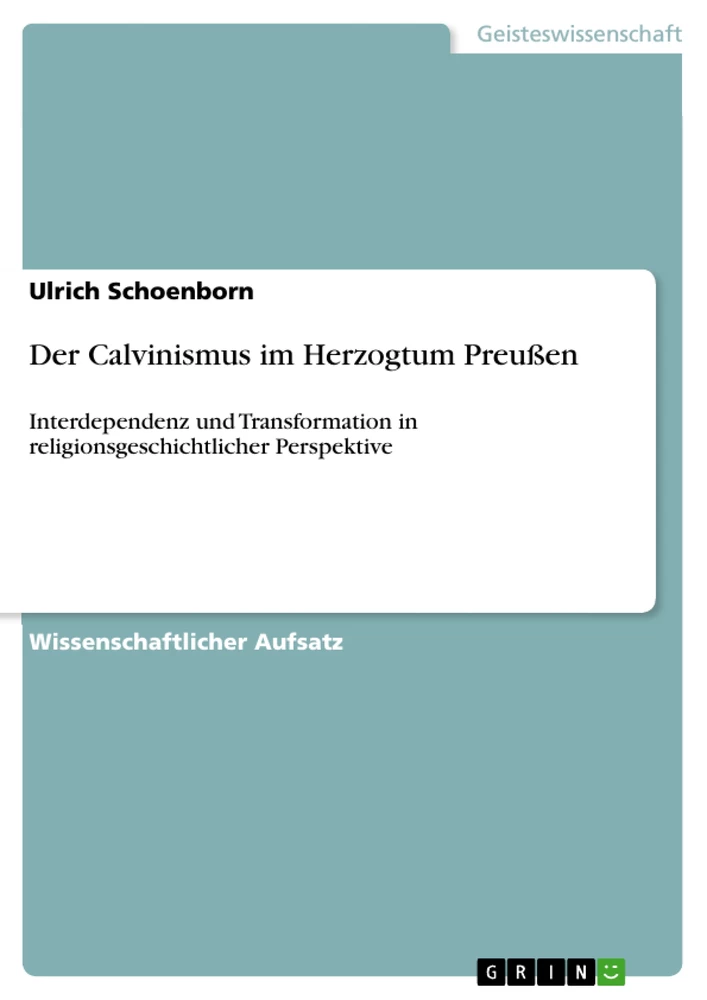
Der Calvinismus im Herzogtum Preußen
Wissenschaftlicher Aufsatz, 2011
27 Seiten
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Zur Entstehung des Herzogtums Preußen
- Was ist unter „Calvinismus“ zu verstehen?
- Im engeren Sinn
- Im weiteren Sinn
- Zur Vorgeschichte des Calvinismus in Preußen
- Die sog. „Zweite Reformation“
- Auswirkungen im Herzogtum Preußen
- Johann Sigismund
- Kurfürst Georg Wilhelm
- Kurfürst Friedrich Wilhelm
- Exkurs: Der synkretistische Streit in Königsberg
- Kurfürst Friedrich III./ König Friedrich I.
- Im ersten Viertel des 18. Jahrhunderts
- Unterwegs zur Union
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Artikel untersucht die Einführung und Entwicklung des Calvinismus im Herzogtum Preußen vom 17. Jahrhundert bis zur Union von 1817. Die Arbeit beleuchtet die Interaktion von religiösen Überzeugungen und politischer Praxis sowie die Geschichtlichkeit konfessioneller Systeme in Preußen.
- Der Einfluss des Adels auf die Verbreitung des Calvinismus
- Die Rolle der "Zweiten Reformation" und des Konfessionswechsels des brandenburgischen Herrscherhauses
- Die Konflikte zwischen Lutheranern und Calvinisten in Preußen
- Die Auswirkungen der Migration (Hugenotten, Schweizer etc.) auf die religiöse Landschaft
- Der Weg zur Union der Kirchen
Zusammenfassung der Kapitel
Zur Entstehung des Herzogtums Preußen: Der Artikel beschreibt die Umwandlung des Deutschordensstaates in ein herzogliches Preußen unter Albrecht von Brandenburg-Ansbach. Albrechts Kontakt zur Reformation und die Übernahme reformatorischer Impulse führten zur Säkularisierung des Ordens und der Entstehung eines neuen Staatswesens. Albrechts tolerante Politik, die auch Glaubensflüchtlinge anlockte, und die Neugestaltung der Kirchenstrukturen werden hervorgehoben. Trotz des Bemühens um eine konfessionell-lutherische Ordnung blieb die theologische Kontroverse ein Strukturmerkmal.
Was ist unter „Calvinismus“ zu verstehen?: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Calvinismus“, der zunächst eine polemische Bezeichnung war, und differenziert ihn vom Luthertum. Es werden die theologischen Systeme des 16. und 17. Jahrhunderts, die sich auf Johannes Calvin beziehen, aber auch dessen geschichtlichen Charakter und die Akzentverschiebungen zwischen Calvin und seinen Nachfolgern erläutert. Wichtige Elemente der Theologie Calvins, insbesondere sein theozentrischer Grundansatz, seine Realitätsauffassung und sein Kirchenverständnis werden skizziert.
Zur Vorgeschichte des Calvinismus in Preußen: Die Verbreitung des Calvinismus in Preußen vor der Konversion des brandenburgischen Herrscherhauses wird hier beleuchtet. Drei Faktoren werden genannt: die geographische Lage und der internationale Handel, die Aufnahme von Hugenotten nach der Aufhebung des Edikts von Nantes und die Konversionen eines Teils des Adels. Der Beitrag der reformierten Adelsfamilien, insbesondere der Dohnas, mit ihren Verbindungen nach Westeuropa und ihrem Engagement für die reformierte Konfession, wird ausführlich dargestellt. Trotz des Widerstands des lutherischen Adels gelang es den Dohnas, die reformierte Konfession auf ihren Gütern zu fördern.
Die sog. „Zweite Reformation“: Der Konfessionswechsel von Kurfürst Johann Sigismund von Brandenburg zum Calvinismus im Jahre 1613 wird analysiert. Der Schritt wird im Kontext der politischen und religiösen Situation in Europa und Brandenburg erläutert, insbesondere in Bezug auf die Erbfolge und die wirtschaftliche Bedeutung der reformierten Gebiete. Die unterschiedlichen Reaktionen in der Bevölkerung und die Motive hinter Sigismunds Entscheidung werden diskutiert.
Auswirkungen im Herzogtum Preußen: Dieses Kapitel beschreibt die Auswirkungen des Konfessionswechsels auf das Herzogtum Preußen. Es wird deutlich, dass die reformierte Minderheit trotz Unterstützung durch das Herrscherhaus mit erheblichen Widerständen konfrontiert war. Die Konflikte zwischen dem Herrscherhaus und dem lutherischen Adel und der Bevölkerung, sowie die Rolle der reformierten Elite im Staatsapparat, werden erläutert. Die Kapitel behandeln die Herausforderungen und Widerstände im Herzogtum durch Kurfürst Johann Sigismund und Georg Wilhelm.
Unterwegs zur Union: Dieses Kapitel beschreibt den schleichenden Prozess der „Entkonfessionalisierung“ in Preußen, der mit dem zunehmenden Einfluss des Pietismus und der zunehmenden pragmatischen Kirchenpolitik der preußischen Könige einherging. Es wird die Entwicklung der reformierten Gemeinden in Preußen nach dem Tod Alexander Graf zu Dohna geschildert, sowie deren fortschreitende Integration in das lutherisch geprägte Staatswesen und der schließlichen Union der Kirchen im Jahre 1817.
Schlüsselwörter
Calvinismus, Reformation, Herzogtum Preußen, Brandenburg, Konfessionalisierung, Konfessionskonflikt, Luthertum, Hugenotten, Adel, Politik, Religion, Toleranz, Union, Zweite Reformation, Dohna.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Der Calvinismus im Herzogtum Preußen
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text untersucht die Einführung und Entwicklung des Calvinismus im Herzogtum Preußen vom 17. Jahrhundert bis zur Union von 1817. Er beleuchtet die Interaktion von religiösen Überzeugungen und politischer Praxis sowie die Geschichtlichkeit konfessioneller Systeme in Preußen.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die Entstehung des Herzogtums Preußen, die Definition des Calvinismus im Vergleich zum Luthertum, die Vorgeschichte des Calvinismus in Preußen, die „Zweite Reformation“ (Konfessionswechsel des brandenburgischen Herrscherhauses), die Auswirkungen des Calvinismus im Herzogtum Preußen unter verschiedenen Kurfürsten (Johann Sigismund, Georg Wilhelm, Friedrich Wilhelm, Friedrich I.), den synkretistischen Streit in Königsberg, die Rolle des Adels, die Migration (Hugenotten, Schweizer), Konflikte zwischen Lutheranern und Calvinisten, und schließlich den Weg zur Kirchenunion von 1817.
Welche Personen spielen eine wichtige Rolle im Text?
Wichtige Personen sind Albrecht von Brandenburg-Ansbach (Gründer des Herzogtums), Kurfürst Johann Sigismund (Konfessionswechsel zum Calvinismus), Kurfürst Georg Wilhelm, Kurfürst Friedrich Wilhelm, Kurfürst Friedrich III./König Friedrich I., und die Familie Dohna als einflussreiche reformierte Adelsfamilie.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text ist in Kapitel gegliedert, die sich mit der Entstehung des Herzogtums Preußen, der Definition des Calvinismus, der Vorgeschichte des Calvinismus in Preußen, der Zweiten Reformation, den Auswirkungen im Herzogtum Preußen und dem Weg zur Union befassen. Jedes Kapitel wird zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Calvinismus, Reformation, Herzogtum Preußen, Brandenburg, Konfessionalisierung, Konfessionskonflikt, Luthertum, Hugenotten, Adel, Politik, Religion, Toleranz, Union, Zweite Reformation, Dohna.
Was ist die Zielsetzung des Textes?
Die Zielsetzung ist die Untersuchung der Einführung und Entwicklung des Calvinismus im Herzogtum Preußen und die Analyse der Wechselwirkung zwischen religiösen und politischen Faktoren in diesem Prozess.
Welche Rolle spielte der Adel bei der Verbreitung des Calvinismus?
Der Adel, insbesondere reformierte Adelsfamilien wie die Dohnas, spielte eine wichtige Rolle bei der Verbreitung des Calvinismus. Sie förderten die reformierte Konfession auf ihren Gütern, trotz des Widerstands des lutherischen Adels.
Welche Bedeutung hatte die „Zweite Reformation“?
Die „Zweite Reformation“, der Konfessionswechsel von Kurfürst Johann Sigismund zum Calvinismus, hatte weitreichende Auswirkungen auf das Herzogtum Preußen. Sie führte zu Konflikten mit dem lutherischen Adel und der Bevölkerung, aber auch zur Stärkung der reformierten Minderheit.
Wie verlief der Weg zur Kirchenunion?
Der Weg zur Kirchenunion war ein schleichender Prozess der „Entkonfessionalisierung“, der mit dem zunehmenden Einfluss des Pietismus und der pragmatischen Kirchenpolitik der preußischen Könige einherging. Die reformierten Gemeinden wurden schrittweise in das lutherisch geprägte Staatswesen integriert, was schließlich zur Union von 1817 führte.
Welche Konflikte gab es zwischen Lutheranern und Calvinisten?
Es gab erhebliche Konflikte zwischen Lutheranern und Calvinisten in Preußen, besonders nach dem Konfessionswechsel des Kurfürsten. Diese Konflikte betrafen sowohl die theologischen Unterschiede als auch die politische Machtverteilung.
Details
- Titel
- Der Calvinismus im Herzogtum Preußen
- Untertitel
- Interdependenz und Transformation in religionsgeschichtlicher Perspektive
- Autor
- Ulrich Schoenborn (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 27
- Katalognummer
- V183440
- ISBN (Buch)
- 9783656076667
- ISBN (eBook)
- 9783656076841
- Dateigröße
- 12399 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- calvinismus herzogtum preußen interdependenz transformation perspektive
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Ulrich Schoenborn (Autor:in), 2011, Der Calvinismus im Herzogtum Preußen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/183440
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-