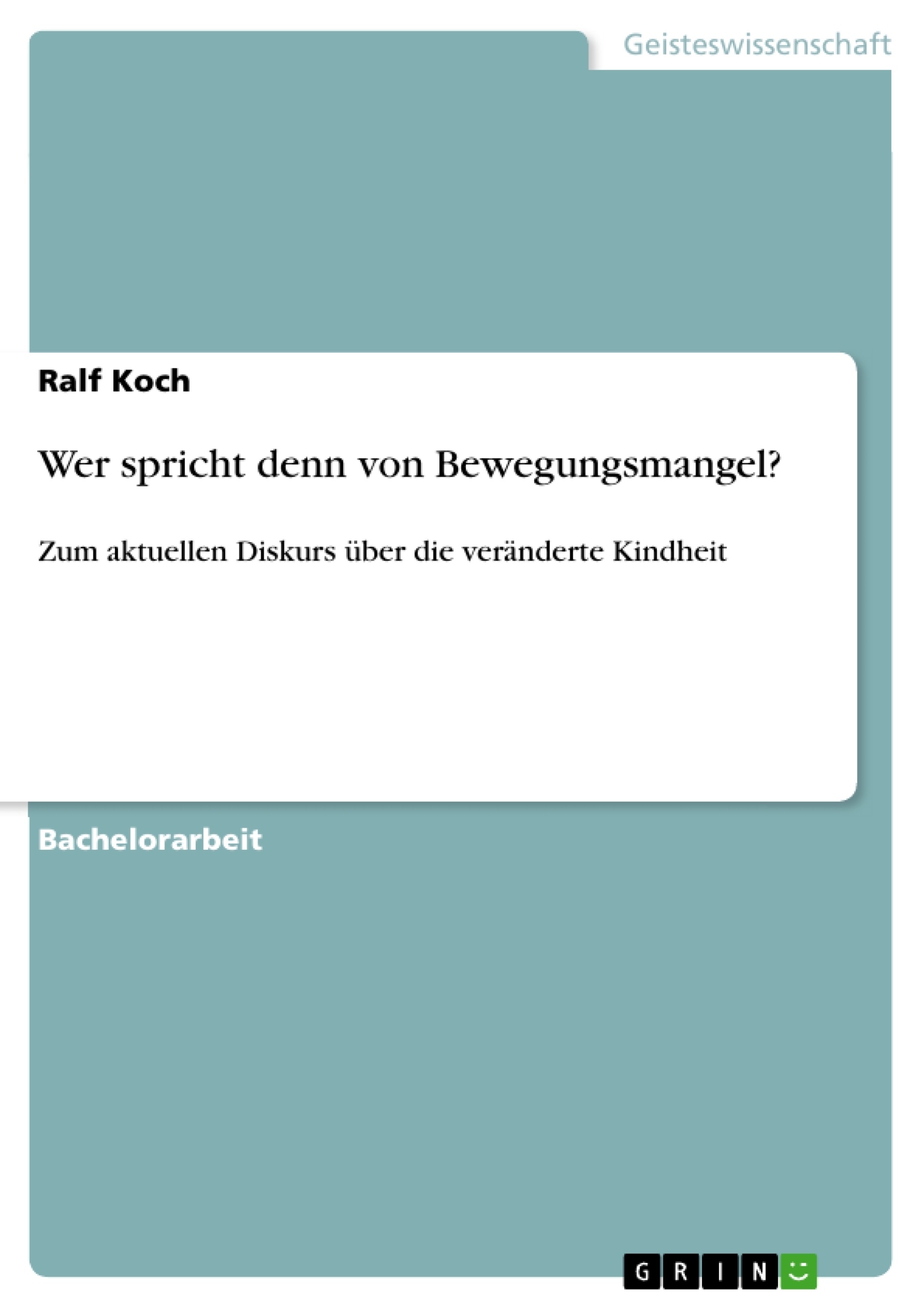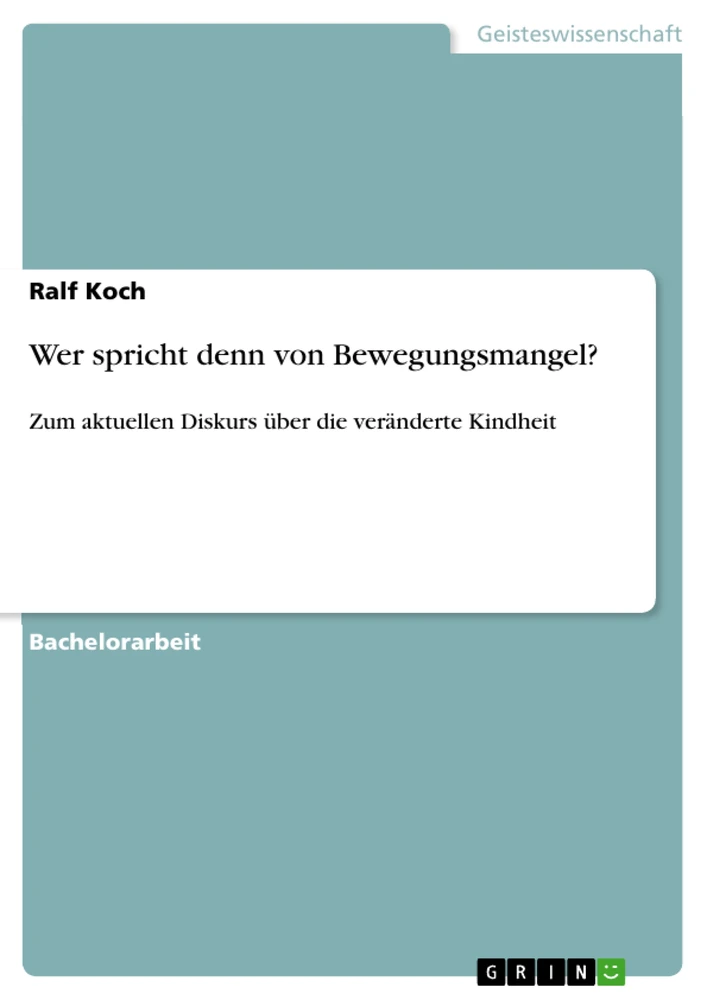
Wer spricht denn von Bewegungsmangel?
Bachelorarbeit, 2011
58 Seiten
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Kap. 1. Einleitung
- Kap. 2. Studien zur motorischen Leistungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen
- 2.1 Forschungsfeld Kindheit - Einzelstudien und Analysen
- 2.2 Übersichtsstudien (1 - 4)
- 2.3 Gibt es einen Rückgang der motorischen Leistungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen? Ein ausführlicher Blick aus Sicht von zwei konträr argumentierenden Forscher(gruppen)
- 2.3.1 Standpunkt 1: Bös et al.
- 2.3.2 Standpunkt 2: Kretschmer
- Kap. 3. Zusammenfassung und vertiefende Überlegungen
- Kap. 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem aktuellen Diskurs über die veränderte Kindheit und der Frage, ob es einen Rückgang der motorischen Leistungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen gibt. Der Verfasser analysiert verschiedene Forschungsstudien und kontrastiert die Perspektiven von Prof. Jürgen Kretschmer und Prof. Klaus Bös, um die komplexen Zusammenhänge zwischen der veränderten Kindheit und dem Bewegungsmangel zu beleuchten.
- Veränderte Sozialisationsbedingungen von Kindern
- Entwicklung der motorischen Leistungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen
- Einfluss der Medienkultur auf die Kindheit
- Kritik an vereinfachten Ursache-Wirkung-Beziehungen im Bezug auf Bewegungsmangel
- Die Rolle der Sportwissenschaft in der Kindheitsforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema ein und stellt die zentralen Fragestellungen der Arbeit vor. Es wird die Problematik des „Bewegungsmangels“ in den Medien und der öffentlichen Diskussion beleuchtet und der Anspruch auf eine differenzierte Analyse der Forschungsergebnisse im Bereich der Sportwissenschaft hervorgehoben.
Kapitel 2 bietet eine umfassende Übersicht über Studien zur motorischen Leistungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen. Es werden sowohl Einzelstudien als auch Übersichtsstudien analysiert und die unterschiedlichen Standpunkte von Prof. Kretschmer und Prof. Bös beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Kindheit, Bewegungsmangel, motorische Leistungsfähigkeit, Sportwissenschaft, Sozialisation, Medienkultur, Kindheitsforschung, Querschnittsuntersuchungen, Prof. Jürgen Kretschmer, Prof. Klaus Bös.
Häufig gestellte Fragen
Gibt es wirklich einen Bewegungsmangel bei Kindern und Jugendlichen?
Die Arbeit untersucht diese Frage kontrovers und zeigt, dass Studien je nach Interpretation sowohl Verschlechterungen als auch Verbesserungen der Motorik finden.
Welche zwei Forscherpositionen stehen sich in der Arbeit gegenüber?
Es werden die Standpunkte von Prof. Dr. Klaus Bös (Uni Karlsruhe) und dem Sportdidaktiker Prof. Jürgen Kretschmer (Hamburg) kontrastiert.
Welchen Einfluss hat die Medienkultur auf die kindliche Bewegung?
Die Arbeit analysiert, inwieweit veränderte Sozialisationsbedingungen und Medienkonsum zu einem Rückgang der motorischen Leistungsfähigkeit führen könnten.
Was wird an der öffentlichen Diskussion über Bewegungsmangel kritisiert?
Kritisiert werden oft vereinfachte Ursache-Wirkung-Beziehungen und eine verzerrte Wahrnehmung durch Erwachsene im Vergleich zu früheren Generationen.
Wie wird die motorische Leistungsfähigkeit in Studien gemessen?
Zumeist werden Querschnittsuntersuchungen genutzt, um die Fitness und Koordination verschiedener Altersgruppen miteinander zu vergleichen.
Welche Rolle spielt die Sportwissenschaft in dieser Debatte?
Sie liefert die empirischen Daten und theoretischen Modelle, um den Diskurs über die "veränderte Kindheit" auf eine wissenschaftliche Basis zu stellen.
Details
- Titel
- Wer spricht denn von Bewegungsmangel?
- Untertitel
- Zum aktuellen Diskurs über die veränderte Kindheit
- Hochschule
- Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
- Autor
- Ralf Koch (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 58
- Katalognummer
- V184173
- ISBN (Buch)
- 9783656089834
- ISBN (eBook)
- 9783656090038
- Dateigröße
- 1806 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- überarbeitete Version
- Schlagworte
- Bewegungsmangel motorische Leistungsfähigkeit Veränderte Kindheit Konstruktvalidität von motorischen Leistungsdiagnosen Bewegungsbedarf Leistungsniveau Bewegung Bewegungswelten Testsysteme Jürgen Kretschmer Klaus Bös
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Ralf Koch (Autor:in), 2011, Wer spricht denn von Bewegungsmangel?, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/184173
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-