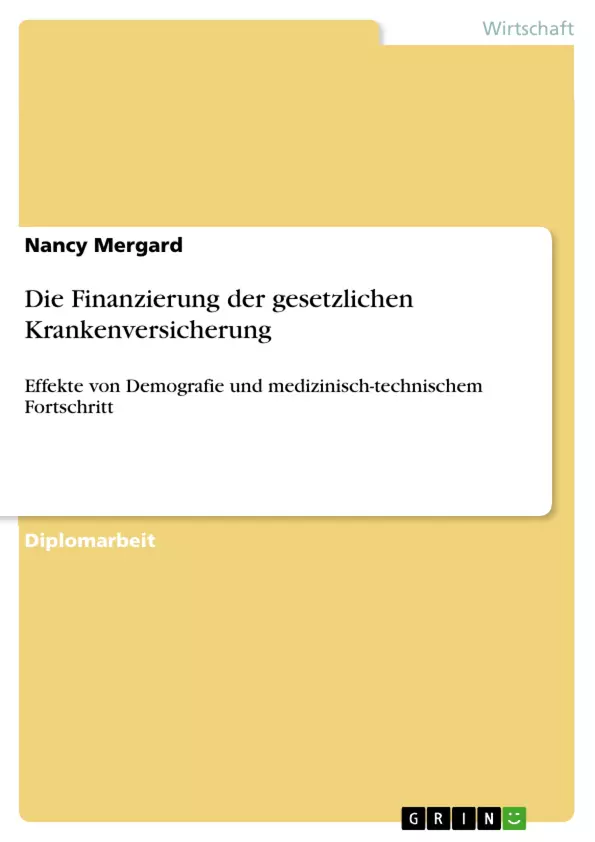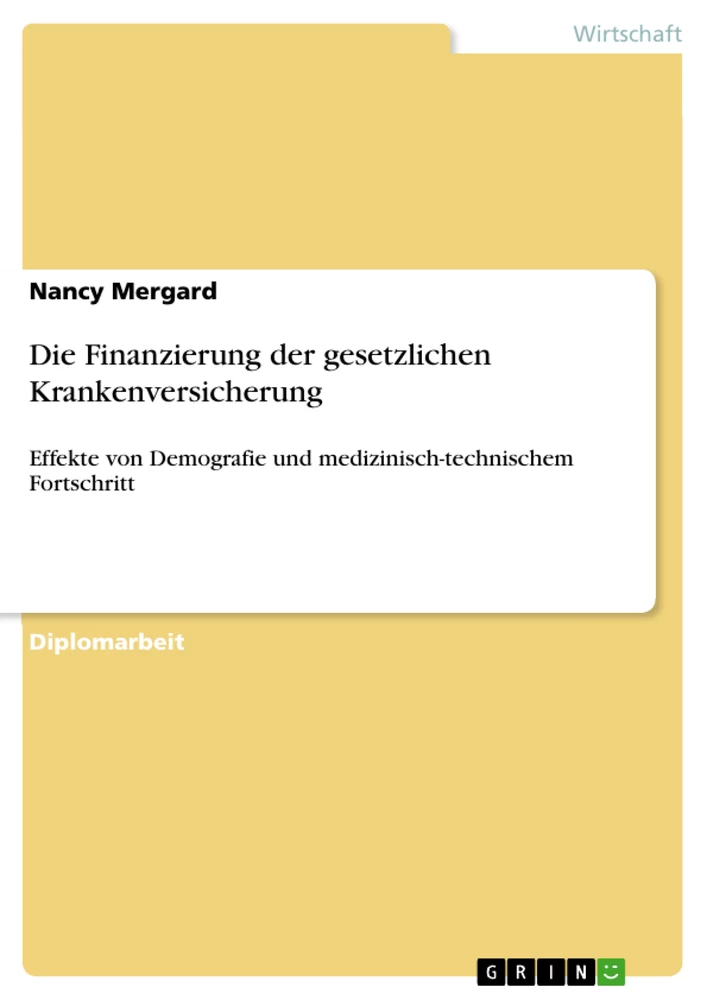
Die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung
Diplomarbeit, 2011
58 Seiten, Note: 2,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Rahmenbedingungen in der GKV
- Solidaritäts- und Sachleistungsprinzip - Philosophie der GKV
- Prinzip der Mitgliedschaft
- Bemessungsgrundlage und Beitragserhebung
- Der Generationenvertrag
- Gesundheit als Gut- ein Exkurs
- Gesundheit-ein besonderes Gut?
- Grenznutzen und Grenzkosten
- Direkte und indirekte Kosten
- Fehlanreize im Gesundheitswesen
- Freifahrereffekt und Moral-Hazard
- Steuerungsproblematik
- Zwischenfazit
- Vorbemerkung- Demografische Entwicklung
- Der demografische Finanzierungseffekt
- Direkter demografischer Ausgabeneffekt-Veränderungen im Altersaufbau, die Umlagefinanzierung und der doppelte Alterungsprozess
- Der indirekte demografische Ausgabeneffekt
- Kompressionsthese und Medikalisierungsthese
- Pro-Kopf-Altersabhängiges Risikoprofil
- Verschiebungen des Pro-Kopf-Ausgabenprofils
- Medizinisch-technischer Fortschritt-Vorbemerkung
- Untersuchungsansätze zur Effektmessung des medizinisch-technischen Fortschritts
- Die Generationenbilanzierung und die Nachhaltigkeitslücke
- Beitragssatzentwicklung unter dem Einfluss des medizinisch-technischen Fortschritts
- Reformoptionen zum derzeitigen System
- Konzept der Bürgerversicherung
- Konzept der Kopfpauschale
- Gegenüberstellung der Reformoptionen
- Bewertung der Reformoptionen
- Teilweise Kapitaldeckung
- Vollständige Kapitaldeckung
- Bewertung der Reformoptionen
- Fazit
- Zusammenfassung und Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Abschlussarbeit befasst sich mit der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in Deutschland. Sie analysiert die Auswirkungen der demografischen Entwicklung und des medizinisch-technischen Fortschritts auf die Finanzstabilität des Systems. Die Arbeit untersucht die Herausforderungen, die sich aus dem demografischen Wandel und den steigenden Gesundheitskosten ergeben, und beleuchtet verschiedene Reformoptionen, die zur Sicherung der langfristigen Finanzierbarkeit der GKV beitragen könnten.
- Die demografische Entwicklung und ihre Auswirkungen auf die GKV
- Der medizinisch-technische Fortschritt und seine Folgen für die Gesundheitskosten
- Die Herausforderungen der Finanzierung der GKV im Kontext von Demografie und medizinisch-technischem Fortschritt
- Verschiedene Reformoptionen zur Sicherung der langfristigen Finanzierbarkeit der GKV
- Die Bewertung der Reformoptionen und ihre Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitslücke
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Finanzierung der GKV ein und erläutert die Relevanz des Themas im Kontext der aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen. Die Problemstellung definiert den Fokus der Arbeit und skizziert die zentralen Fragestellungen, die im weiteren Verlauf untersucht werden.
Das Kapitel "Rahmenbedingungen in der GKV" beleuchtet die grundlegenden Prinzipien der GKV, wie das Solidaritäts- und Sachleistungsprinzip, sowie die Prinzipien der Mitgliedschaft und die Beitragserhebung. Es wird zudem der Generationenvertrag als zentrales Element der GKV-Finanzierung vorgestellt.
Das Kapitel "Gesundheit als Gut- ein Exkurs" widmet sich der Frage, inwiefern Gesundheit als ein besonderes Gut betrachtet werden kann. Es werden die Konzepte des Grenznutzens und der Grenzkosten sowie die direkten und indirekten Kosten im Gesundheitswesen erläutert.
Das Kapitel "Fehlanreize im Gesundheitswesen" analysiert die Problematik von Freifahrereffekten und Moral-Hazard im Gesundheitswesen. Es werden die Ursachen und Folgen dieser Fehlanreize sowie die Steuerungsproblematik im Gesundheitswesen diskutiert.
Das Kapitel "Vorbemerkung- Demografische Entwicklung" gibt einen Überblick über die demografische Entwicklung in Deutschland und erläutert die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die GKV-Finanzierung. Es werden die Begriffe des doppelten Alterungsprozesses und der Umlagefinanzierung erläutert.
Das Kapitel "Der demografische Finanzierungseffekt" analysiert die direkten und indirekten Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf die GKV-Finanzierung. Es werden die Kompressionsthese und die Medikalisierungsthese sowie die Verschiebungen des Pro-Kopf-Ausgabenprofils im Kontext der demografischen Entwicklung diskutiert.
Das Kapitel "Medizinisch-technischer Fortschritt-Vorbemerkung" beleuchtet die Bedeutung des medizinisch-technischen Fortschritts für die GKV-Finanzierung. Es werden verschiedene Untersuchungsansätze zur Effektmessung des medizinisch-technischen Fortschritts vorgestellt.
Das Kapitel "Reformoptionen zum derzeitigen System" stellt verschiedene Reformoptionen zur Sicherung der langfristigen Finanzierbarkeit der GKV vor. Es werden die Konzepte der Bürgerversicherung, der Kopfpauschale sowie der teilweisen und vollständigen Kapitaldeckung diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), die demografische Entwicklung, den medizinisch-technischen Fortschritt, die Gesundheitskosten, die Nachhaltigkeitslücke, die Reformoptionen und die Generationenbilanzierung. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen, die sich aus dem demografischen Wandel und den steigenden Gesundheitskosten für die GKV ergeben, und beleuchtet verschiedene Reformoptionen, die zur Sicherung der langfristigen Finanzierbarkeit des Systems beitragen könnten.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die zentralen Prinzipien der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)?
Die GKV basiert auf dem Solidaritätsprinzip, dem Sachleistungsprinzip und dem Generationenvertrag.
Wie wirkt sich der demografische Wandel auf die GKV aus?
Der doppelte Alterungsprozess führt zu sinkenden Einnahmen bei gleichzeitig steigenden Ausgaben, was die langfristige Finanzstabilität des Umlageverfahrens gefährdet.
Was ist der Unterschied zwischen Medikalisierungs- und Kompressionsthese?
Die Medikalisierungsthese nimmt an, dass die Lebenserwartung steigt, aber die Jahre in Krankheit zunehmen, während die Kompressionsthese besagt, dass sich Krankheiten auf die letzte Lebensphase konzentrieren.
Welche Reformoptionen werden für die GKV diskutiert?
Diskutiert werden unter anderem das Konzept der Bürgerversicherung, die Kopfpauschale sowie Modelle der teilweisen oder vollständigen Kapitaldeckung.
Was versteht man unter "Moral Hazard" im Gesundheitswesen?
Es beschreibt das Risiko, dass Versicherte aufgrund der Absicherung weniger auf ihre Gesundheit achten oder Leistungen übermäßig in Anspruch nehmen (Vollkaskomentalität).
Details
- Titel
- Die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung
- Untertitel
- Effekte von Demografie und medizinisch-technischem Fortschritt
- Hochschule
- Hanseatische Verwaltungs- und Wirtschafts- Akademie VWA gemeinnützige GmbH, Studienzentrum Hamburg
- Veranstaltung
- BWL - Wirtschaftspolitik,Gesundheitspolitik,Gesundheitsökonomie
- Note
- 2,0
- Autor
- Nancy Mergard (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 58
- Katalognummer
- V184600
- ISBN (eBook)
- 9783656093817
- ISBN (Buch)
- 9783656093923
- Dateigröße
- 1150 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Krankenversicherung Demografie Medizin
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 32,99
- Arbeit zitieren
- Nancy Mergard (Autor:in), 2011, Die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/184600
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-