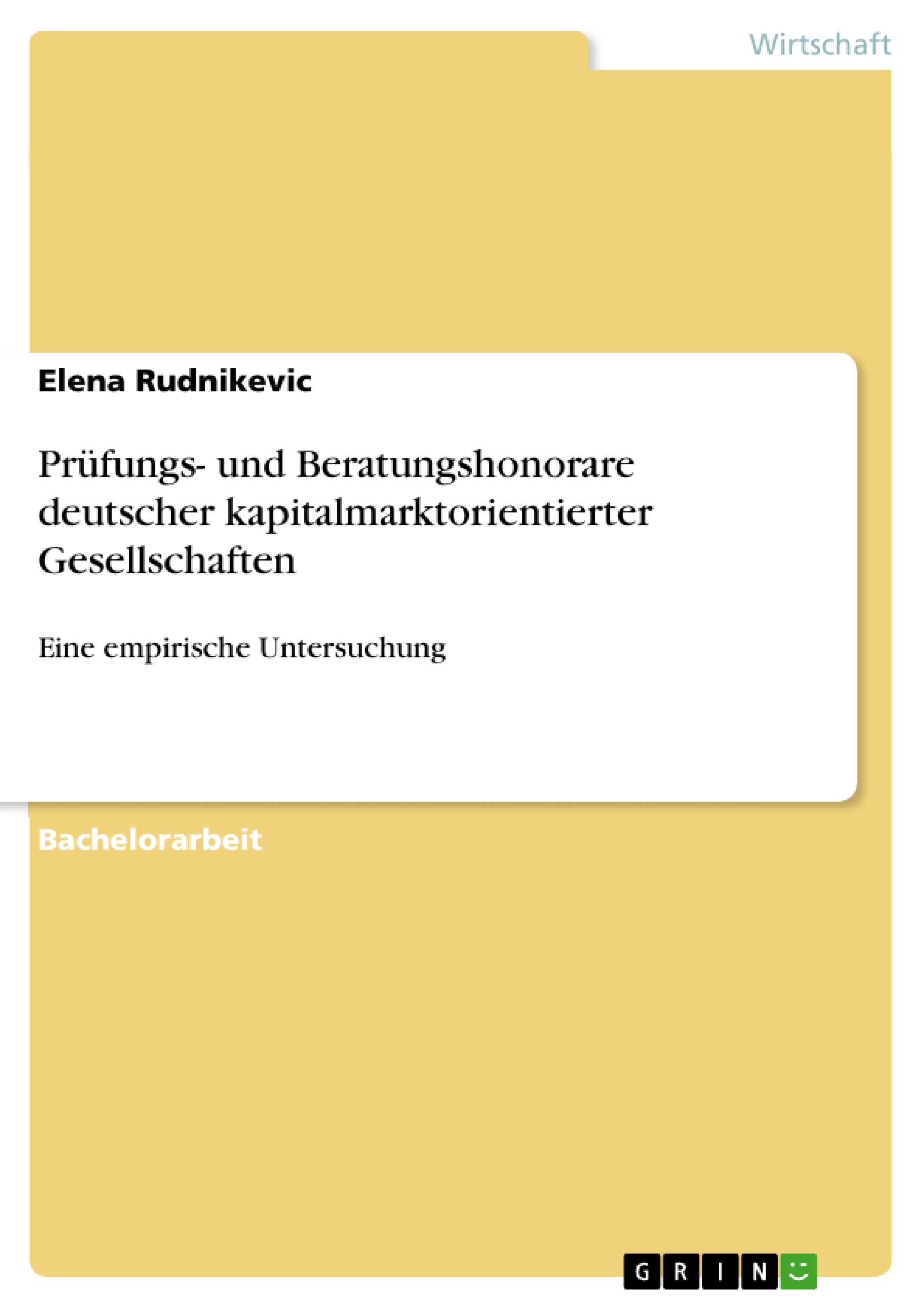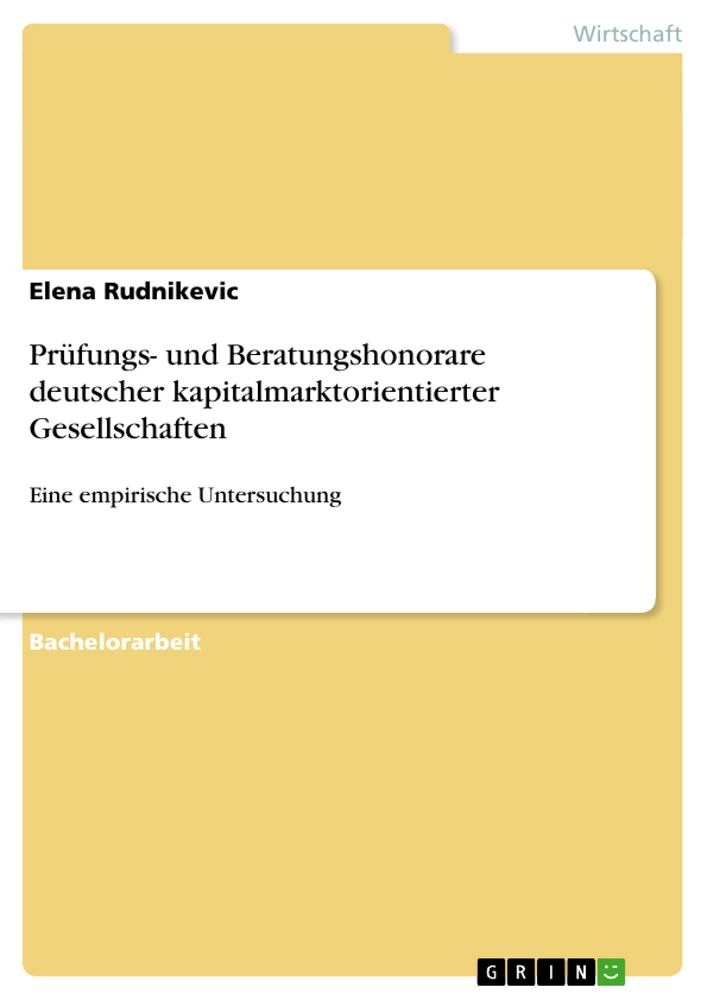
Prüfungs- und Beratungshonorare deutscher kapitalmarktorientierter Gesellschaften
Bachelorarbeit, 2010
70 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Definitionen und Grundlagen
- 1. Begriffsabgrenzung
- 2. Definition der Prüfungs- und Beratungshonorare
- 3. Akteure des Prüfungsmarktes
- 3.1. Angebotsseite: Prüfungsgesellschaften
- 3.2. Nachfrageseite: Unternehmen
- 4. Statistische Methoden
- 4.1. Regressions- und Korrelationsanalyse
- 4.2. Einfaktorielle Varianzanalyse
- III. Analyse der Prüfungs- und Beratungshonorare
- 1. Einflussfaktoren
- 1.1. Unternehmensgröße der Mandanten
- 1.2. Branchenzugehörigkeit der Mandanten
- 1.3. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
- 1.4. Zusammenfassung
- 2. Interdependenzanalyse der Honorarkomponenten
- 2.1. DAX 30
- 2.2. MDAX
- 2.3. SDAX
- 2.4. Zusammenfassung
- 3. Prüfungs- und Beratungshonorare im Zeitverlauf
- 3.1. DAX 30
- 3.2. MDAX
- 3.3. SDAX
- 3.4. Zusammenfassung
- IV. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht empirisch die Prüfungs- und Beratungshonorare deutscher kapitalmarktorientierter Gesellschaften. Ziel ist es, die Einflussfaktoren auf die Höhe der Honorare zu identifizieren und deren Interdependenzen zu analysieren. Die Arbeit betrachtet dabei die Entwicklung der Honorare im Zeitverlauf.
- Einflussfaktoren auf die Höhe der Prüfungs- und Beratungshonorare
- Interdependenzen zwischen verschiedenen Honorarkomponenten
- Entwicklung der Honorare über die Zeit hinweg
- Unterschiede in den Honoraren zwischen verschiedenen Börsensegmenten (DAX, MDAX, SDAX)
- Rolle der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Prüfungs- und Beratungshonorare ein und erläutert die Relevanz der Untersuchung. Sie beschreibt den Aufbau der Arbeit und die gewählte Methodik. Die Einleitung skizziert die Forschungsfrage und die zu erwartenden Ergebnisse, um den Leser auf die folgenden Kapitel vorzubereiten und einen roten Faden für die gesamte Arbeit zu etablieren. Der Fokus liegt auf der Begründung der Bedeutung des Themas im Kontext der deutschen Kapitalmarktlandschaft.
II. Definitionen und Grundlagen: Dieses Kapitel legt die begrifflichen Grundlagen für die empirische Untersuchung fest. Es definiert präzise den Begriff der Prüfungs- und Beratungshonorare und grenzt ihn von anderen verwandten Begriffen ab. Es beschreibt die relevanten Akteure am Prüfungsmarkt, sowohl auf der Angebots- (Prüfungsgesellschaften) als auch auf der Nachfrageseite (Unternehmen). Zudem werden die statistischen Methoden vorgestellt, die im weiteren Verlauf der Arbeit angewendet werden, um die Daten auszuwerten und die Forschungsfragen zu beantworten. Die detaillierte Beschreibung der statistischen Ansätze dient als Grundlage für das Verständnis der Analyseergebnisse in den folgenden Kapiteln.
III. Analyse der Prüfungs- und Beratungshonorare: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und präsentiert die empirischen Ergebnisse. Es analysiert die Einflussfaktoren auf die Prüfungs- und Beratungshonorare, untersucht die Interdependenzen der verschiedenen Honorarkomponenten und betrachtet die Entwicklung der Honorare im Zeitverlauf für die Börsensegmente DAX 30, MDAX und SDAX. Die Ergebnisse werden anhand von Tabellen, Diagrammen und statistischen Kennzahlen detailliert dargestellt und interpretiert. Dabei wird auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der einzelnen Segmente eingegangen. Die Kapitel analysieren umfassend die Daten, um zu fundierten Schlussfolgerungen zu gelangen.
Schlüsselwörter
Prüfungs- und Beratungshonorare, Kapitalmarkt, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, DAX, MDAX, SDAX, Regressionsanalyse, Korrelationsanalyse, Einfaktorielle Varianzanalyse, Unternehmensgröße, Branchenzugehörigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Prüfungs- und Beratungshonorare deutscher kapitalmarktorientierter Gesellschaften
Was ist der Gegenstand der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht empirisch die Prüfungs- und Beratungshonorare deutscher kapitalmarktorientierter Gesellschaften. Sie analysiert die Einflussfaktoren auf die Höhe der Honorare, deren Interdependenzen und die Entwicklung der Honorare im Zeitverlauf.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Einflussfaktoren auf die Höhe der Prüfungs- und Beratungshonorare zu identifizieren und deren Interdependenzen zu analysieren. Dabei wird die Entwicklung der Honorare im Zeitverlauf betrachtet.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Einflussfaktoren auf die Höhe der Prüfungs- und Beratungshonorare, Interdependenzen zwischen verschiedenen Honorarkomponenten, Entwicklung der Honorare über die Zeit, Unterschiede in den Honoraren zwischen DAX, MDAX und SDAX, und die Rolle der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.
Welche Börsensegmente werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Prüfungs- und Beratungshonorare für die Börsensegmente DAX 30, MDAX und SDAX.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet statistische Methoden wie Regressions- und Korrelationsanalyse sowie die Einfaktorielle Varianzanalyse zur Auswertung der Daten.
Welche Einflussfaktoren auf die Honorare werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Unternehmensgröße der Mandanten, Branchenzugehörigkeit der Mandanten und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften auf die Höhe der Honorare.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel zu Definitionen und Grundlagen, einem Hauptkapitel zur Analyse der Prüfungs- und Beratungshonorare und einem Fazit mit Ausblick. Die Einleitung erläutert das Thema, den Aufbau und die Methodik. Das zweite Kapitel definiert wichtige Begriffe und stellt die Akteure am Prüfungsmarkt vor. Das Hauptkapitel präsentiert die empirischen Ergebnisse. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Prüfungs- und Beratungshonorare, Kapitalmarkt, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, DAX, MDAX, SDAX, Regressionsanalyse, Korrelationsanalyse, Einfaktorielle Varianzanalyse, Unternehmensgröße, Branchenzugehörigkeit.
Wo finde ich eine detaillierte Übersicht des Inhalts?
Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis ist im HTML-Dokument enthalten, das die einzelnen Kapitel und Unterkapitel auflistet.
Welche Zusammenfassung der einzelnen Kapitel gibt es?
Die Zusammenfassung der Kapitel im HTML-Dokument gibt einen Überblick über die Inhalte der Einleitung, der Definitionen und Grundlagen, der Analyse der Prüfungs- und Beratungshonorare und des Fazits.
Details
- Titel
- Prüfungs- und Beratungshonorare deutscher kapitalmarktorientierter Gesellschaften
- Untertitel
- Eine empirische Untersuchung
- Hochschule
- Hochschule Ansbach - Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Ansbach
- Note
- 1,0
- Autor
- Elena Rudnikevic (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2010
- Seiten
- 70
- Katalognummer
- V184668
- ISBN (eBook)
- 9783656154563
- ISBN (Buch)
- 9783656154587
- Dateigröße
- 3111 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Prüfungswesen Prüfungshonorare Auditing Wirtschaftsprüfung DAX Empirie MDAX SDAX Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfungsgesellschaften KPMG Ernst&Young Big Four Deloitte PricewaterhouseCoopers PWC Empirische Untersuchung Bachelorarbeit Ansbach Hochschule Ansbach deutsche kapitalmarktorientierte Gesellschaften Beratungshonorare
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 31,99
- Preis (Book)
- US$ 41,99
- Arbeit zitieren
- Elena Rudnikevic (Autor:in), 2010, Prüfungs- und Beratungshonorare deutscher kapitalmarktorientierter Gesellschaften, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/184668
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-