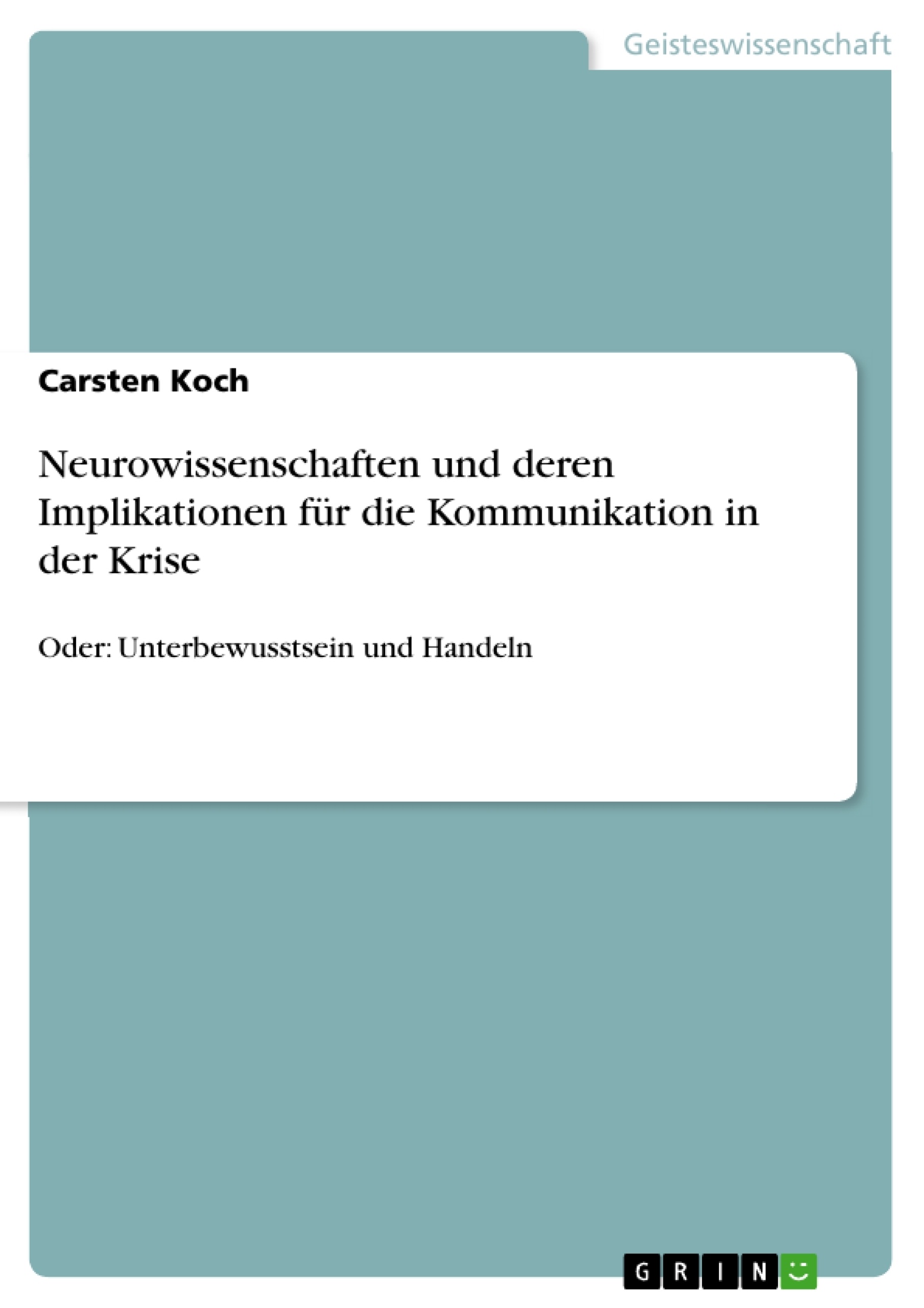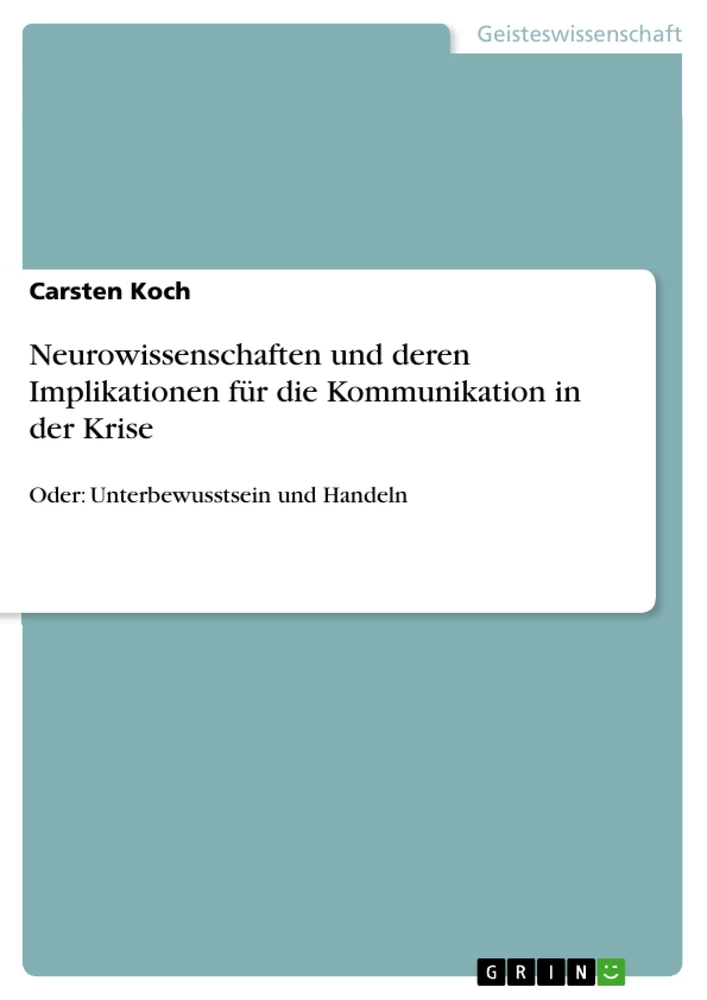
Neurowissenschaften und deren Implikationen für die Kommunikation in der Krise
Fachbuch, 2012
29 Seiten
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Bewusstsein und das Unterbewusstsein
- Das Bewusstsein
- Das Unterbewusstsein
- Das limbische System
- Die Theorie der somatischen Marker
- Der Einfluss des Unterbewusstseins auf das Handeln
- Implikationen der Neurowissenschaften für die Krisenkommunikation
- Relevanz der Neurowissenschaften für die Krisenkommunikation
- Altruistische Bestrafung
- Priming Effekt
- Framing Effekt
- Motive und Motivsysteme
- Drei Grundmotive
- Die Big 3
- Limbic Map
- Gehirngerichtete Kommunikation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss neurowissenschaftlicher Erkenntnisse auf die Krisenkommunikation. Ziel ist es, aufzuzeigen, wie ein vertieftes Verständnis des menschlichen Bewusstseins und insbesondere des Unterbewusstseins die Gestaltung und den Erfolg von Kommunikationsmaßnahmen in Krisensituationen verbessern kann.
- Das Zusammenspiel von Bewusstsein und Unterbewusstsein bei der Informationsverarbeitung
- Die Rolle des limbischen Systems und der somatischen Marker bei der emotionalen Reaktion auf Krisen
- Der Einfluss von Priming und Framing auf die Wahrnehmung und Interpretation von Botschaften
- Die Bedeutung von Motiven und Motivsystemen für die Gestaltung wirksamer Krisenkommunikation
- Die Anwendung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse für eine gehirngerechte Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in die Thematik und die Forschungsfrage. Kapitel 2 legt die Grundlagen, indem es Bewusstsein und Unterbewusstsein definiert und das limbische System, die Theorie der somatischen Marker und den Einfluss des Unterbewusstseins auf unser Handeln erläutert. Kapitel 3 befasst sich mit den Implikationen der Neurowissenschaften für die Krisenkommunikation, indem es verschiedene Effekte wie Altruistische Bestrafung, Priming und Framing beleuchtet sowie Motive und Motivsysteme und deren Darstellung in der Limbic Map beschreibt und einen Ausblick auf gehirngerechte Kommunikation gibt.
Schlüsselwörter
Bewusstsein, Unterbewusstsein, limbisches System, somatische Marker, Neurowissenschaften, Krisenkommunikation, Priming, Framing, Motive, Motivsysteme, Limbic Map, gehirngerechte Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflussen Neurowissenschaften die Krisenkommunikation?
Da Kommunikation immer auch das Unterbewusstsein anspricht, helfen neurowissenschaftliche Erkenntnisse dabei, Kriseninstrumente so zu gestalten, dass sie die wahren Bedürfnisse und Motive der Zielgruppen treffen.
Was sind „somatische Marker“?
Somatische Marker sind emotionale Erfahrungsberichte des Gehirns, die uns helfen, blitzschnell Entscheidungen zu treffen, indem sie Reize als positiv oder negativ bewerten.
Was bewirken Priming- und Framing-Effekte?
Priming beeinflusst die unbewusste Verarbeitung nachfolgender Reize. Framing setzt Informationen in einen bestimmten Deutungsrahmen, was die Wahrnehmung einer Krise maßgeblich verändern kann.
Was ist die „Limbic Map“?
Die Limbic Map ordnet menschliche Motive und Emotionssysteme (z.B. Balance, Dominanz, Stimulanz) zu und dient als Werkzeug für eine zielgruppengerechte, „gehirngerechte“ Kommunikation.
Warum ist das Unterbewusstsein in Krisen so entscheidend?
In Stress- und Krisensituationen reagiert das menschliche Gehirn oft impulsiv und emotional über das limbische System, bevor das rationale Bewusstsein eingreifen kann.
Details
- Titel
- Neurowissenschaften und deren Implikationen für die Kommunikation in der Krise
- Untertitel
- Oder: Unterbewusstsein und Handeln
- Autor
- Diplom Kaufmann (FH) Carsten Koch (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2012
- Seiten
- 29
- Katalognummer
- V186988
- ISBN (Buch)
- 9783656102311
- ISBN (eBook)
- 9783656102342
- Dateigröße
- 4524 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Neurowissenschaft Neurowissenschaften Neurokommunikation Neurokrisenkommunikation Krisenkommunikation Kommunikation Krise implizit explizit Emotion Motiv Limbic Map Unterbewusstsein Bewusstsein Neuromarketing Marketing Gedächtnis Unternehmenskommunikation Neuroökonomie limbisches System limbisch somatische Maker altruistische Bestrafung Priming Effekt Priming Framing Effekt Framing drei Grundmotive Big 3 gehirngerichtete Kommunikation
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 19,99
- Arbeit zitieren
- Diplom Kaufmann (FH) Carsten Koch (Autor:in), 2012, Neurowissenschaften und deren Implikationen für die Kommunikation in der Krise, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/186988
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-