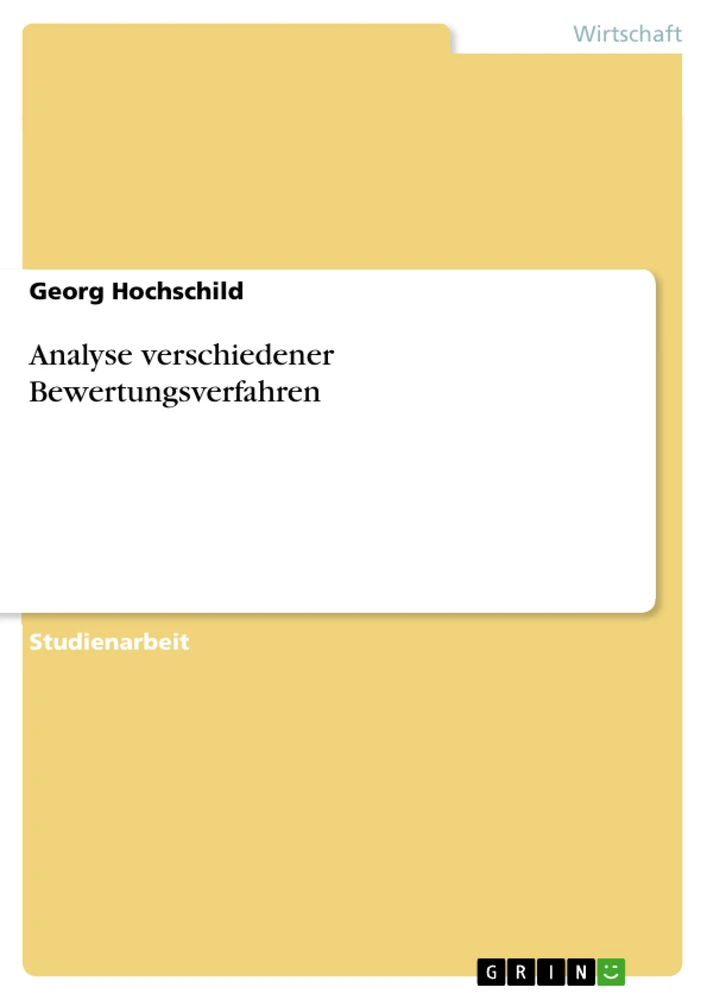
Analyse verschiedener Bewertungsverfahren
Studienarbeit, 2011
59 Seiten, Note: 2.3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Systematisierung der Entscheidungstheorien
- 2.1 Klassische Systematisierung von Entscheidungstheorien
- 2.2 Alternative Systematisierung von Entscheidungstheorien
- 2.3 Eigene Systematisierungen von Entscheidungstheorien
- 3. Vorstellung verschiedener Verfahren
- 3.1 Analytic Hierarchy Process
- 3.2 PROMETHEE
- 3.3 TOPSIS
- 4. Beurteilung der Bewertungsmethoden
- 4.1 Kriterien zur Beurteilung von Bewertungsmethoden
- 4.2 Stärke-Schwächen-Analyse der Bewertungsmethoden
- 5. Fazit
- 6 Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Analyse und Bewertung von Entscheidungshilfsverfahren, insbesondere AHP, TOPSIS und PROMETHEE. Sie zielt darauf ab, die Methoden detailliert darzustellen, ihre Stärken und Schwächen aufzuzeigen und sie anhand von Beispielen zu veranschaulichen. Hierfür wurde eine Systematisierung von Bewertungsverfahren entwickelt, die als Grundlage für die Analyse dient.
- Systematisierung von Bewertungsverfahren
- Detaillierte Darstellung von AHP, TOPSIS und PROMETHEE
- Analyse der Stärken und Schwächen der Methoden
- Entwicklung von Kriterien zur Bewertung der Verfahren
- Veranschaulichung der Methoden anhand von Beispielen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung - Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und erläutert den Hintergrund sowie die Zielsetzung der Analyse.
- Kapitel 2: Systematisierung der Entscheidungstheorien - Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Systematisierungen von Entscheidungstheorien, um einen theoretischen Rahmen für die Analyse der Verfahren zu schaffen. Es werden sowohl klassische als auch alternative Ansätze diskutiert, um die Vielfalt der Entscheidungsmodelle zu beleuchten.
- Kapitel 3: Vorstellung verschiedener Verfahren - In diesem Kapitel werden die drei Bewertungsmethoden AHP, TOPSIS und PROMETHEE detailliert vorgestellt. Die Funktionsweise jeder Methode wird anhand von Beispielen erläutert, um die Anwendung und die Besonderheiten der Verfahren zu veranschaulichen.
- Kapitel 4: Beurteilung der Bewertungsmethoden - Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Bewertung der drei Verfahren. Es werden Kriterien zur Beurteilung der Methoden definiert und eine Stärke-Schwächen-Analyse durchgeführt, um die Vor- und Nachteile der Verfahren aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Entscheidungstheorie, Bewertungsverfahren, Multikriterielle Entscheidungsfindung, AHP (Analytic Hierarchy Process), TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) und PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation). Wichtige Aspekte der Arbeit umfassen die Systematisierung von Bewertungsverfahren, die Analyse der Stärken und Schwächen der Verfahren und die Entwicklung von Kriterien zur Bewertung der Methoden. Die Arbeit bietet eine umfassende Analyse der ausgewählten Verfahren und trägt dazu bei, ein besseres Verständnis für die Anwendung von Entscheidungshilfsmethoden in der Praxis zu entwickeln.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Unterschiede zwischen AHP, TOPSIS und PROMETHEE?
Es sind multikriterielle Entscheidungsverfahren, die sich in ihrer mathematischen Logik und der Art der Alternativenbewertung unterscheiden.
Wie funktioniert der Analytic Hierarchy Process (AHP)?
Entscheidungen werden in eine Hierarchie zerlegt und Kriterien durch paarweise Vergleiche gewichtet, um eine Prioritätenliste zu erstellen.
Was ist das Ziel des TOPSIS-Verfahrens?
TOPSIS sucht die Alternative, die den kürzesten Abstand zur idealen Lösung und den größten Abstand zur negativ-idealen Lösung hat.
Was zeichnet die PROMETHEE-Methode aus?
Sie nutzt Präferenzfunktionen, um Alternativen paarweise zu vergleichen und ein Ranking basierend auf Netto-Flüssen zu erstellen.
Warum ist eine Systematisierung von Entscheidungstheorien sinnvoll?
Sie bietet einen theoretischen Rahmen, um für komplexe Probleme das jeweils am besten geeignete Bewertungsverfahren auszuwählen.
Details
- Titel
- Analyse verschiedener Bewertungsverfahren
- Hochschule
- Brandenburgische Technische Universität Cottbus
- Veranstaltung
- Qualitätsmanagement
- Note
- 2.3
- Autor
- Georg Hochschild (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 59
- Katalognummer
- V187383
- ISBN (eBook)
- 9783656110330
- ISBN (Buch)
- 9783656110552
- Dateigröße
- 828 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Promethee AHP TOPSIS
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Georg Hochschild (Autor:in), 2011, Analyse verschiedener Bewertungsverfahren, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/187383
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









