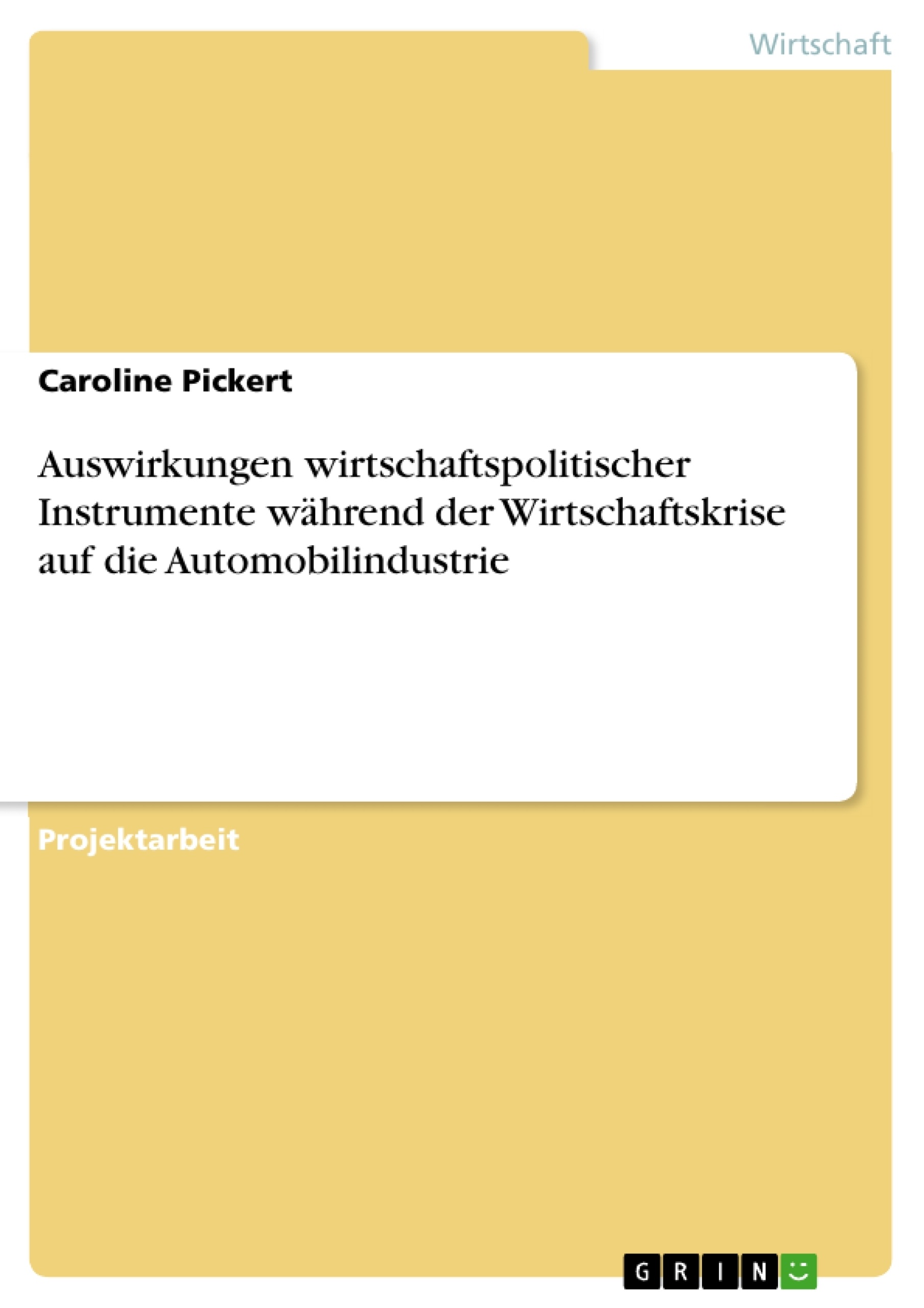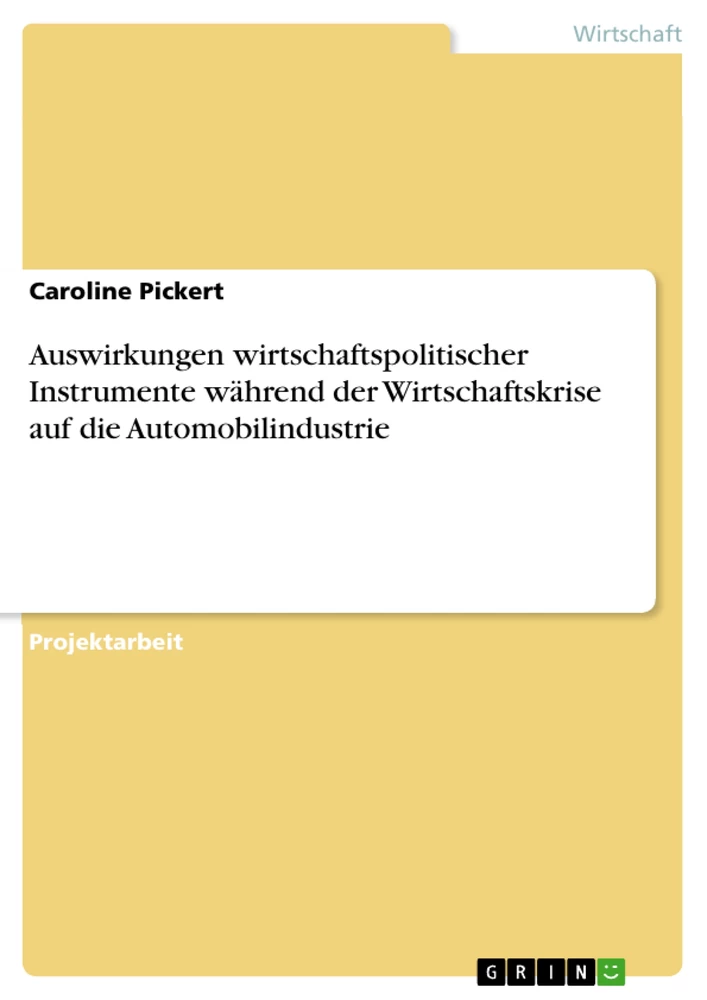
Auswirkungen wirtschaftspolitischer Instrumente während der Wirtschaftskrise auf die Automobilindustrie
Projektarbeit, 2011
60 Seiten
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Wirtschaftskrise
- Chronologie der Wirtschaftskrise von 2007 bis 2009
- Deutsche Konjunkturprogramme
- Konjunkturpaket I
- Konjunkturpaket II
- Wirtschaftspolitische Instrumente zur Konjunkturstabilisierung
- Neuregelung der KFZ-Steuer
- Förderung anwendungsorientierter Forschung im Bereich Mobilität
- Stärkung der PKW-Nachfrage - die Umweltprämie
- Die Auswirkungen der wirtschaftspolitischen Instrumente auf einzelne Marktsegmente
- Auswirkungen auf die Automobilhersteller und -händler
- Marktsituation vor und während der Krise
- Auswertung von Geschäftsberichten und wirtschaftlichen Kennzahlen
- Auswertungen von Verkaufs- und Zulassungszahlen
- Auswirkungen auf Preispolitik und Wettbewerb
- Aktuelle Marktsituation
- Auswirkungen auf die Automobilzulieferer am Beispiel der Continental AG
- Die Geschichte der Continental AG
- Marktsituation vor und während der Wirtschaftskrise
- Auswertung von Geschäftsberichten und wirtschaftlichen Kennzahlen
- Aktuelle Marktsituation
- Auswirkungen auf Auto-Werkstätten und Autoverwerter
- Gewinner und Verlierer der wirtschaftspolitischen Instrumente
- Branchenentwicklung und Prognose der Automobilindustrie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen wirtschaftspolitischer Instrumente während der Wirtschaftskrise 2007-2009 auf die deutsche Automobilindustrie. Ziel ist es, die Effektivität der staatlichen Maßnahmen zur Konjunkturstabilisierung in diesem Sektor zu analysieren.
- Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die Automobilindustrie
- Analyse der deutschen Konjunkturpakete und ihrer wirtschaftspolitischen Instrumente
- Wirkungen auf verschiedene Marktsegmente (Hersteller, Zulieferer, Werkstätten)
- Bewertung der Maßnahmen hinsichtlich ihrer Effizienz und Auswirkungen auf den Wettbewerb
- Branchenentwicklung und Prognose
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beleuchtet den Zusammenhang zwischen Wirtschaftsliberalismus und Marktversagen am Beispiel der Automobilindustrie während der Finanzkrise. Das Kapitel über die Wirtschaftskrise beschreibt die Chronologie des Krisenverlaufs und die staatlichen Reaktionen in Deutschland. Das folgende Kapitel analysiert die wirtschaftspolitischen Instrumente, einschließlich der Neuregelung der KFZ-Steuer, der Förderung der Forschung im Mobilitätsbereich und der Umweltprämie. Die Auswirkungen auf verschiedene Marktsegmente werden im Anschluss detailliert untersucht, wobei die Analyse der Automobilhersteller und -händler sowie der Automobilzulieferer (am Beispiel der Continental AG) im Vordergrund stehen. Die Auswirkungen auf Autowerkstätten und Autoverwerter werden ebenfalls beleuchtet.
Schlüsselwörter
Wirtschaftskrise 2007-2009, Automobilindustrie, Konjunkturpakete, wirtschaftspolitische Instrumente, KFZ-Steuer, Forschungsförderung, Umweltprämie, Marktsegmente, Continental AG, Wettbewerb, Branchenentwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Wie wirkte sich die Wirtschaftskrise 2008 auf die Automobilindustrie aus?
Die Krise führte zu einem dramatischen Einbruch der Neuwagenverkäufe weltweit, da Verbraucher aufgrund von Zukunftsängsten auf teure Konsumgüter verzichteten.
Was war das Ziel der deutschen Umweltprämie (Abwrackprämie)?
Die Umweltprämie sollte die Nachfrage nach Neuwagen künstlich ankurbeln, um den drohenden Kollaps der Automobilhersteller und -händler zu verhindern und die Konjunktur zu stabilisieren.
Welche wirtschaftspolitischen Instrumente wurden zur Krisenbewältigung eingesetzt?
Zu den Maßnahmen gehörten die Konjunkturpakete I und II, die Neuregelung der Kfz-Steuer, Subventionen für Forschungsprojekte im Bereich neuer Antriebstechnologien und die Umweltprämie.
Wer waren die Gewinner und Verlierer der Fördermaßnahmen?
Die Arbeit zieht eine kritische Bilanz und untersucht, ob Hersteller von Kleinwagen profitierten, während andere Segmente oder Zulieferer trotz Subventionen vor großen Herausforderungen standen.
Hätte sich der Automobilmarkt auch ohne staatliche Eingriffe reguliert?
Dies ist eine zentrale Frage der Arbeit. Es wird erörtert, ob die massiven Eingriffe notwendig waren oder ob sie lediglich Marktbereinigungen verzögert und Wettbewerbsverzerrungen verursacht haben.
Details
- Titel
- Auswirkungen wirtschaftspolitischer Instrumente während der Wirtschaftskrise auf die Automobilindustrie
- Hochschule
- Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Frankfurt
- Autor
- Caroline Pickert (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 60
- Katalognummer
- V187452
- ISBN (eBook)
- 9783656107965
- ISBN (Buch)
- 9783656108498
- Dateigröße
- 974 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Wirtschaftskrise Automobilindustrie Umweltprämie Abwrackprämie Auto Finanzkrise Markversagen Automobil Automarkt Weltwirtschaft Konjunktur Konjunkturpaket Konjunkturprogramm
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 31,99
- Arbeit zitieren
- Caroline Pickert (Autor:in), 2011, Auswirkungen wirtschaftspolitischer Instrumente während der Wirtschaftskrise auf die Automobilindustrie, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/187452
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-