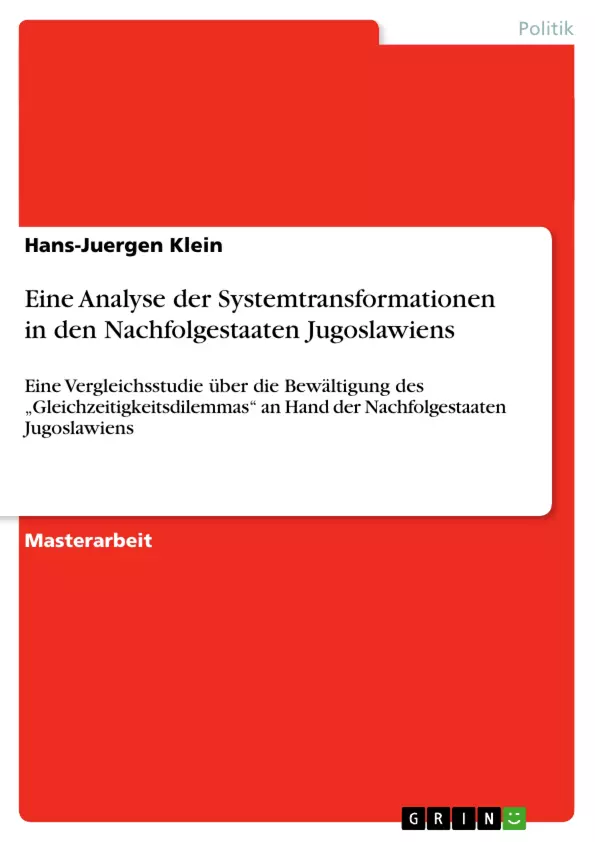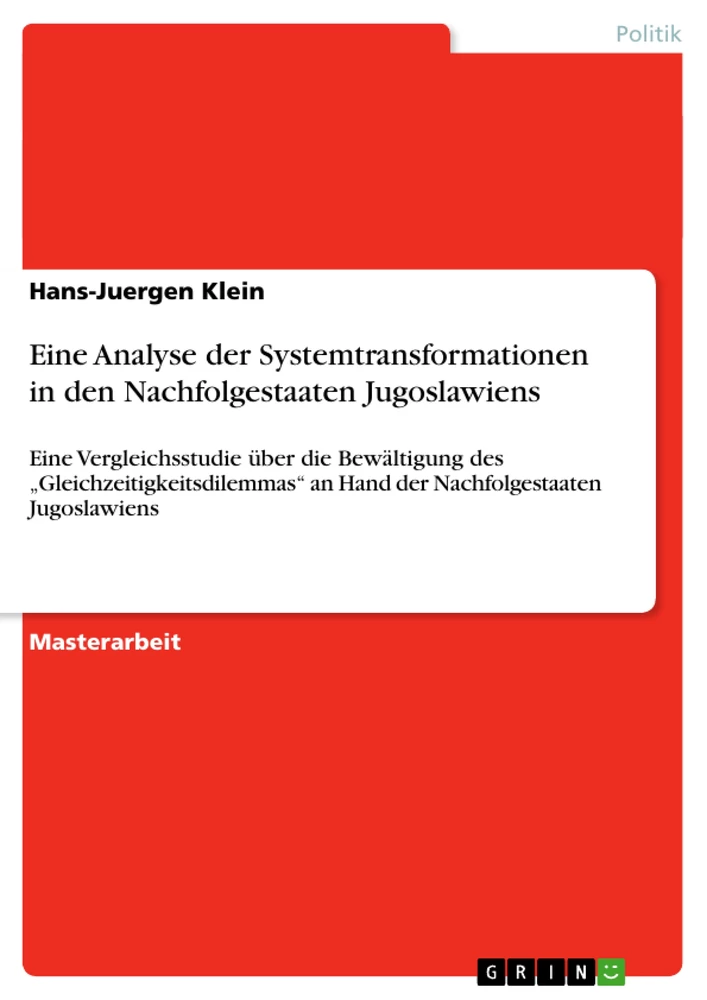
Eine Analyse der Systemtransformationen in den Nachfolgestaaten Jugoslawiens
Masterarbeit, 2011
86 Seiten, Note: 2,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- A. EINLEITENDE GEDANKEN
- A.1 Ausgangsproblem und wissenschaftliches Erkenntnisinteresse
- A.2 Erarbeitung einer wissenschaftlichen Fragestellung und Hypothesen
- A.3 Erarbeitung eines wissenschaftlichen Vorgehensplans
- B. HAUPTTEIL
- B.1 Entwicklung und Diskussion der zentralen Definitionen „Transition“ und „Transformation“
- B.2 Entwicklung des theoretischen Rahmens
- B.2.1 Theorien der Systemtransformationen
- B.2.1.1 Der Prozess der Systemtransformation
- B.2.1.1.1 Zentrale Funktion des Teilprozesses der politisch-administrativen Transformation
- B.2.1.1.2 Zentrale Funktion des Teilprozesses der gesellschaftlichen Transformation
- B.2.1.1.3 Zentrale Funktion des Teilprozesses der ökonomischen Transformation
- B.2.1.1.4 Zwischenfazit
- B.2.1.2 Bedeutung der „embedded democracy“ im Rahmen der Systemtransformation und deren Kriterien für diese Analyse
- B.2.1.1 Der Prozess der Systemtransformation
- B.2.2 Dilemma der Gleichzeitigkeit
- B.2.2.1 Dilemma der Gleichzeitigkeit nach Offe
- B.2.2.2 Dilemma der Gleichzeitigkeit nach Elster
- B.2.2.3 Bedeutung der Ausgangssituation vor Beginn der Transformation nach Mackow
- B.2.2.4 Zwischenfazit und Darstellung des entwickelten Analyserahmens
- B.2.3 Demokratiemessung
- B.2.3.1 Historische Entwicklung der Demokratiemessung
- B.2.3.2 Präsentation der vier prominentesten Demokratiemessinstrumente
- B.2.3.1 Begründung für die Auswahl des „Bertelsmann Transformation Index“
- B.2.3.3 Der ,,Bertelsmann Transformation Index“
- B.2.3.4 Kritik am ,,Bertelsmann Transformation Index“
- B.2.1 Theorien der Systemtransformationen
- B.3 Entwicklung des Analyseobjekts
- B.3.1 Der Untergang Jugoslawiens
- B.3.2 Horizontale Messung der Systemtransformation über alle Nachfolgestaaten Jugoslawiens hinweg und Ermittlung des am weitesten und des am wenigsten transformierten Staates mit Hilfe des ,,Bertelsmann Transformation Index“
- B.3.3 Detaillierte Darstellung des Transformationsprozesses in Slowenien mit Hilfe des ,,Bertelsmann Transformation Index“
- B.3.4 Detaillierte Darstellung des Transformationsprozesses in Bosnien und Herzegowina mit Hilfe des „Bertelsmann Transformation Index“
- B.3.5 Zwischenfazit und Verortung von Slowenien und Bosnien und Herzegowina innerhalb des „Prozesses der Systemtransformation“
- B.4 Analyse
- B.4.1 Vertikale Messung der Systemtransformation von Slowenien mittels einer vergleichenden Analyse anhand der Kriterien nach Elster und Offe, sowie der Ausgangssituation nach Mackow
- B.4.1.1 Zwischenfazit der gewonnenen Erkenntnisse
- B.4.2 Vertikale Messung der Systemtransformation von Bosnien und Herzegowina mittels einer vergleichenden Analyse anhand der Kriterien nach Elster und Offe, sowie der Ausgangssituation nach Mackow
- B.4.2 1 Zwischenfazit der gewonnenen Erkenntnisse
- B.4.3 Diskussion der gewonnenen Erkenntnisse
- B.4.1 Vertikale Messung der Systemtransformation von Slowenien mittels einer vergleichenden Analyse anhand der Kriterien nach Elster und Offe, sowie der Ausgangssituation nach Mackow
- B.5 Gesamtfazit
- C. ABSCHLIEBENDE GEDANKEN
- D. TABELLENVERZEICHNIS
- E. VERZEICHNIS DER GRAPHIKEN
- F. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
- G. QUELLENVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit analysiert den Transformationsprozess in den Nachfolgestaaten Jugoslawiens. Der Fokus liegt auf der Bewältigung des "Gleichzeitigkeitsdilemmas", welches die parallel ablaufenden politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Transformationsprozesse beschreibt. Die Arbeit befasst sich mit den Theorien der Systemtransformation und untersucht, inwiefern diese auf die Nachfolgestaaten Jugoslawiens anwendbar sind. Der Vergleich verschiedener Staaten ermöglicht es, die Erfolgsfaktoren und Hindernisse der Transformationsprozesse zu identifizieren.
- Systemtransformationen in den Nachfolgestaaten Jugoslawiens
- Das "Gleichzeitigkeitsdilemma" im Kontext von Transformationsprozessen
- Theorien der Systemtransformation und deren Anwendung auf die Nachfolgestaaten Jugoslawiens
- Analyse der Transformationsprozesse in Slowenien und Bosnien und Herzegowina
- Vergleichende Analyse der Transformationsprozesse anhand von Kriterien nach Elster und Offe, sowie der Ausgangssituation nach Mackow
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird das Ausgangsproblem der Arbeit dargestellt, welches die systematische Transformation der Nachfolgestaaten Jugoslawiens nach dem Zerfall des Landes im Jahr 1991 betrifft. Das "Gleichzeitigkeitsdilemma" wird als zentrales Problem der Transformationsprozesse identifiziert und in den Kontext der dritten Demokratisierungswelle eingeordnet. Die Arbeit stellt die wissenschaftliche Fragestellung und die Hypothesen auf, die im weiteren Verlauf der Arbeit untersucht werden.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Entwicklung eines theoretischen Rahmens für die Analyse der Systemtransformation. Zunächst werden die zentralen Definitionen von "Transition" und "Transformation" diskutiert. Anschließend werden verschiedene Theorien der Systemtransformation, insbesondere in Bezug auf das "Gleichzeitigkeitsdilemma", vorgestellt und deren Anwendbarkeit auf die Nachfolgestaaten Jugoslawiens untersucht. Das Kapitel beleuchtet zudem die Bedeutung von "embedded democracy" im Kontext von Transformationsprozessen und erläutert die dafür relevanten Kriterien.
Kapitel drei fokussiert auf die Entwicklung des Analyseobjekts, den Untergang Jugoslawiens. Der Fokus liegt auf der horizontalen Messung der Systemtransformation über alle Nachfolgestaaten hinweg, wobei das "Bertelsmann Transformation Index" als Messinstrument verwendet wird. Die beiden am weitesten und am wenigsten transformierten Staaten, Slowenien und Bosnien und Herzegowina, werden anhand des Index dargestellt und ihre Position innerhalb des Transformationsprozesses betrachtet.
In Kapitel vier wird eine vertikalere Analyse der Transformationsprozesse in Slowenien und Bosnien und Herzegowina durchgeführt. Die Kapitel untersuchen die einzelnen Transformationsschritte anhand der Kriterien von Elster und Offe sowie der Ausgangssituation nach Mackow. Die Kapitel analysieren die jeweiligen Entwicklungen und zeichnen ein Bild der Herausforderungen und Erfolge der Transformationsprozesse.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Systemtransformation, "Gleichzeitigkeitsdilemma", "embedded democracy", Demokratiemessung, "Bertelsmann Transformation Index", Nachfolgestaaten Jugoslawiens, Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Elster, Offe, Mackow.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das "Gleichzeitigkeitsdilemma" bei Systemtransformationen?
Es beschreibt die Herausforderung, politische Demokratisierung, wirtschaftliche Markteinführung und gesellschaftlichen Wandel zeitgleich bewältigen zu müssen.
Wie verlief die Transformation in den Nachfolgestaaten Jugoslawiens?
Im Gegensatz zu anderen Ostblockstaaten war sie oft von blutigen Bürgerkriegen und massiver externer Steuerung durch internationale Organisationen geprägt.
Was misst der Bertelsmann Transformation Index (BTI)?
Der BTI bewertet den Stand von Demokratie und Marktwirtschaft sowie die Qualität des politischen Managements in Transformationsländern.
Warum gilt Slowenien als erfolgreiches Transformationsbeispiel?
Slowenien konnte die Transformation aufgrund einer stabilen Ausgangslage und einer schnellen Integration in westliche Strukturen vergleichsweise friedlich und effizient vollziehen.
Welche Rolle spielt die "externe Demokratisierung"?
Internationale Organisationen wie die EU, VN und OSZE steuern und überwachen den Demokratisierungsprozess in Konfliktregionen wie Bosnien und Herzegowina.
Details
- Titel
- Eine Analyse der Systemtransformationen in den Nachfolgestaaten Jugoslawiens
- Untertitel
- Eine Vergleichsstudie über die Bewältigung des „Gleichzeitigkeitsdilemmas“ an Hand der Nachfolgestaaten Jugoslawiens
- Hochschule
- FernUniversität Hagen (Politikwissenschaft)
- Note
- 2,0
- Autor
- M.A. "Governance" und Dipl.-Betrw. FH Hans-Juergen Klein (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 86
- Katalognummer
- V188366
- ISBN (Buch)
- 9783656120575
- ISBN (eBook)
- 9783656120629
- Dateigröße
- 876 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Schlagworte
- Demokratieforschung Systemtransformation Gleichzeitigkeitsdilemma Jugoslawien
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 39,99
- Preis (Book)
- US$ 50,99
- Arbeit zitieren
- M.A. "Governance" und Dipl.-Betrw. FH Hans-Juergen Klein (Autor:in), 2011, Eine Analyse der Systemtransformationen in den Nachfolgestaaten Jugoslawiens, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/188366
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-