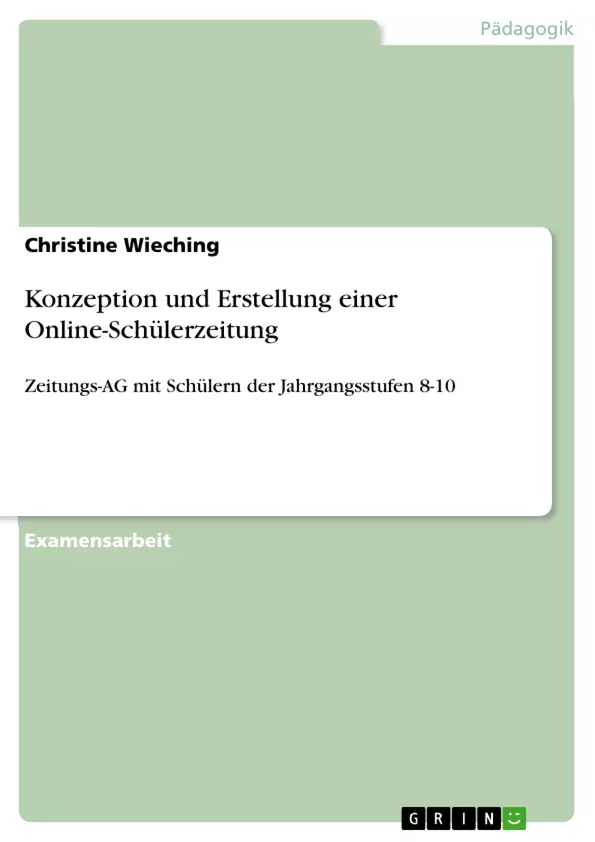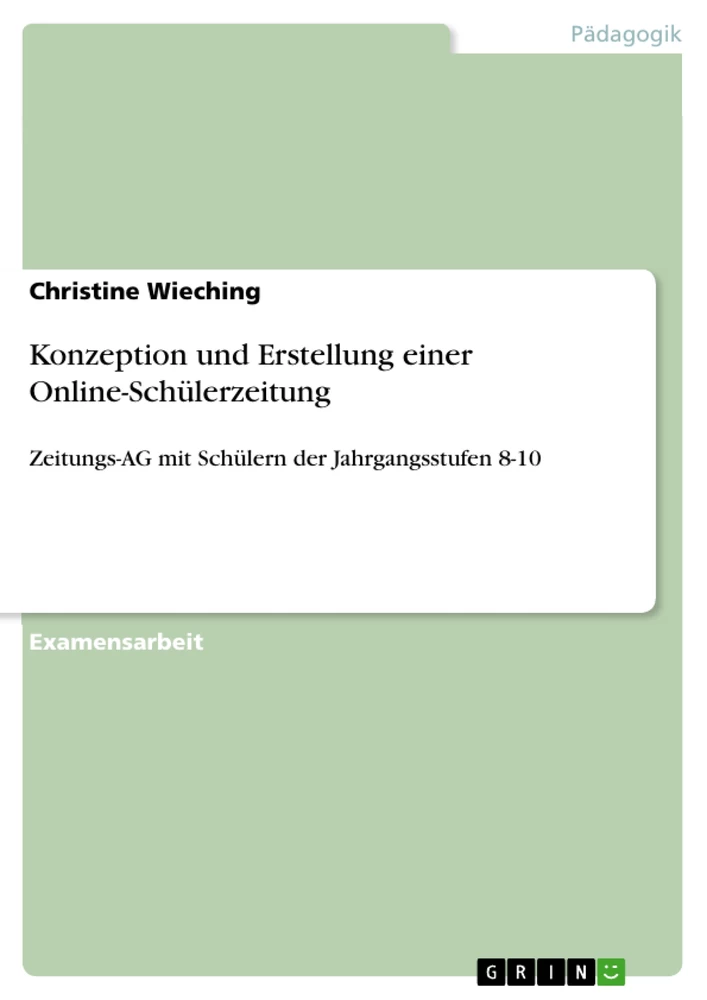
Konzeption und Erstellung einer Online-Schülerzeitung
Examensarbeit, 2011
46 Seiten, Note: 1,0
Didaktik für das Fach Deutsch - Pädagogik, Sprachwissenschaft
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Neue Medien in der Schule
- Definition „Neue Medien“
- Neue Medien und Schülerzeitung
- Vorteile einer Online-Schülerzeitung
- Nachteile der Online-Schülerzeitung
- Bezug zum Kernlehrplan für die Realschule in Nordrhein-Westfalen
- Konsequenzen für die Schülerzeitung
- Ziele des Konzepts der Online-Schülerzeitung
- Organisation und Rahmenbedingungen
- Kooperation mit der Lokalzeitung
- Modul „Technik im Web“
- Modul „Journalistische Arbeit“
- Recherche
- Artikel schreiben
- Gesetzliche Grundlagen
- Modul „So wird eine Zeitung gemacht“
- Evaluation
- Evaluation der Lehrerfunktionen
- Übertragbarkeit des Konzepts und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit konzipiert und beschreibt die Erstellung einer Online-Schülerzeitung für die Jahrgangsstufen 8-10. Ziel ist die Entwicklung eines praktikablen Konzepts, das die Vorteile neuer Medien nutzt und die Herausforderungen einer traditionellen Schülerzeitung umgeht. Die Arbeit berücksichtigt dabei den Kernlehrplan und die Zusammenarbeit mit einer Lokalzeitung.
- Integration neuer Medien im schulischen Kontext
- Vorteile und Herausforderungen einer Online-Schülerzeitung
- Praktische Umsetzung und Organisation der Schülerzeitung
- Kooperation mit lokalen Medien
- Evaluation des Konzepts und Ausblick
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit, indem sie den Wandel zur Wissensgesellschaft und die Bedeutung neuer Medien, insbesondere für Jugendliche, hervorhebt. Sie führt das Problem der traditionellen Schülerzeitung an der XXX-Schule an, deren Druckausgaben nicht mehr verkauft wurden, und begründet damit die Notwendigkeit einer Online-Schülerzeitung als zeitgemäße und effektive Alternative.
Neue Medien in der Schule: Dieses Kapitel definiert zunächst den Begriff „Neue Medien“ im Gegensatz zu traditionellen Medien und hebt deren spezifische Eigenschaften hervor, wie die weltweite Verfügbarkeit, Interaktivität und die nicht-lineare Zugänglichkeit von Informationen. Es diskutiert die Vorteile einer Online-Schülerzeitung im Vergleich zu Printmedien, insbesondere die Geschwindigkeit der Veröffentlichung, die höhere Kapazität an Inhalten und die geringeren Kosten. Die Einbindung in den Kernlehrplan wird ebenfalls angesprochen.
Organisation und Rahmenbedingungen: Dieses Kapitel beschreibt die organisatorischen Aspekte der Online-Schülerzeitung, die Rahmenbedingungen ihrer Erstellung und die Einbindung in den Schulalltag. Es befasst sich wahrscheinlich mit der Struktur der Redaktion, der Arbeitsteilung unter den Schülern und der technischen Infrastruktur. Konkrete Details fehlen im Ausgangstext.
Kooperation mit der Lokalzeitung: Dieses Kapitel erläutert die Zusammenarbeit mit der Lokalzeitung, möglicherweise im Bereich der journalistischen Anleitung, des Austausches von Informationen oder der gemeinsamen Berichterstattung über lokale Ereignisse. Der Ausgangstext bietet keine detaillierte Beschreibung.
Modul „Technik im Web“: Dieses Kapitel behandelt die technischen Aspekte der Erstellung und des Betriebs der Online-Schülerzeitung. Es erklärt vermutlich die verwendeten Software-Tools, die Webseite-Entwicklung und die technische Betreuung. Im Ausgangstext sind dazu keine Einzelheiten aufgeführt.
Modul „Journalistische Arbeit“: Dieses Kapitel fokussiert auf die journalistischen Aspekte der Schülerzeitung, von der Recherche über das Schreiben von Artikeln bis hin zu den rechtlichen Grundlagen. Es wird wahrscheinlich verschiedene journalistische Techniken und Arbeitsabläufe erläutern. Auch hier sind im Ausgangstext keine Einzelheiten verfügbar.
Modul „So wird eine Zeitung gemacht“: Dieses Kapitel vermittelt wahrscheinlich grundlegende Kenntnisse über den Herstellungsprozess einer Zeitung, sowohl im Online- als auch im Printbereich. Es umfasst möglicherweise Aspekte der Redaktionsplanung, des Layouts und der Gestaltung. Keine weiteren Details sind im Ausgangstext vorhanden.
Evaluation: Dieses Kapitel beschreibt die Evaluation der Online-Schülerzeitung, möglicherweise anhand von Kriterien wie der Nutzung durch Schüler, der Qualität der Artikel und der technischen Funktionalität. Im Ausgangstext sind keine konkreten Evaluierungsmethoden genannt.
Evaluation der Lehrerfunktionen: Dieses Kapitel analysiert die Rolle der Lehrer bei der Betreuung und Anleitung der Schüler während der Erstellung der Online-Schülerzeitung. Es könnte verschiedene Aspekte der Lehrertätigkeit beleuchten, wie die Unterstützung der Schüler, die Gestaltung des Lernprozesses und die Evaluation der Schülerleistungen. Der Ausgangstext gibt keine Details an.
Übertragbarkeit des Konzepts und Ausblick: Dieses Kapitel diskutiert die Übertragbarkeit des entwickelten Konzepts auf andere Schulen und betrachtet zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten der Online-Schülerzeitung. Es könnte mögliche Verbesserungen oder Erweiterungen des Konzepts vorschlagen. Im gegebenen Text fehlen konkrete Ausführungen.
Schlüsselwörter
Online-Schülerzeitung, Neue Medien, Wissensgesellschaft, Journalismus, Kernlehrplan, Kooperation, Lokalzeitung, Schulprogramm, Schülerbeteiligung, Medienkompetenz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Online-Schülerzeitung
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit beschreibt die Konzeption und Erstellung einer Online-Schülerzeitung für die Jahrgangsstufen 8-10 einer Realschule in Nordrhein-Westfalen. Ziel ist die Entwicklung eines praktikablen Konzepts, das die Vorteile neuer Medien nutzt und die Herausforderungen einer traditionellen Schülerzeitung umgeht. Ein wichtiger Aspekt ist die Zusammenarbeit mit einer Lokalzeitung und die Einbindung in den Kernlehrplan.
Welche Ziele werden mit der Online-Schülerzeitung verfolgt?
Die Online-Schülerzeitung soll die Vorteile neuer Medien nutzen, wie z.B. schnellere Veröffentlichung, höhere Inhaltskapazität und geringere Kosten im Vergleich zu einer Print-Schülerzeitung. Sie soll die Schüler aktiv beteiligen und ihre Medienkompetenz fördern. Die Einbindung in den Kernlehrplan und die Kooperation mit einer Lokalzeitung sind weitere Ziele.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel Einleitung, Neue Medien in der Schule, Organisation und Rahmenbedingungen, Kooperation mit der Lokalzeitung, Modul „Technik im Web“, Modul „Journalistische Arbeit“, Modul „So wird eine Zeitung gemacht“, Evaluation, Evaluation der Lehrerfunktionen und Übertragbarkeit des Konzepts und Ausblick. Jedes Kapitel befasst sich mit einem spezifischen Aspekt der Konzeption und Umsetzung der Online-Schülerzeitung.
Wie wird der Begriff „Neue Medien“ definiert?
Der Begriff „Neue Medien“ wird im Gegensatz zu traditionellen Medien definiert und umfasst Eigenschaften wie weltweite Verfügbarkeit, Interaktivität und nicht-lineare Zugänglichkeit von Informationen.
Welche Vorteile bietet eine Online-Schülerzeitung gegenüber einer Print-Schülerzeitung?
Vorteile sind die schnellere Veröffentlichung, die höhere Kapazität an Inhalten, die geringeren Kosten und die größere Reichweite durch die Online-Verfügbarkeit.
Welche Rolle spielt der Kernlehrplan?
Der Kernlehrplan für die Realschule in Nordrhein-Westfalen wird berücksichtigt, um die Einbindung der Online-Schülerzeitung in den regulären Unterricht sicherzustellen.
Wie gestaltet sich die Kooperation mit der Lokalzeitung?
Die Kooperation mit der Lokalzeitung umfasst möglicherweise journalistische Anleitung, Informationsaustausch oder gemeinsame Berichterstattung über lokale Ereignisse. Konkrete Details werden in der Arbeit beschrieben.
Welche technischen Aspekte werden behandelt?
Das Modul „Technik im Web“ behandelt die technischen Aspekte der Erstellung und des Betriebs der Online-Schülerzeitung, einschließlich der verwendeten Software und der Webseite-Entwicklung.
Welche journalistischen Aspekte werden behandelt?
Das Modul „Journalistische Arbeit“ fokussiert auf Recherche, Artikel schreiben und die gesetzlichen Grundlagen des Journalismus.
Wie wird die Online-Schülerzeitung evaluiert?
Die Evaluation der Online-Schülerzeitung umfasst Kriterien wie die Nutzung durch Schüler, die Qualität der Artikel und die technische Funktionalität. Konkrete Evaluierungsmethoden werden in der Arbeit dargelegt.
Welche Rolle spielen die Lehrer?
Die Evaluation der Lehrerfunktionen analysiert die Rolle der Lehrer bei der Betreuung und Anleitung der Schüler, einschließlich der Unterstützung der Schüler, der Gestaltung des Lernprozesses und der Evaluation der Schülerleistungen.
Wie ist die Übertragbarkeit des Konzepts?
Das Kapitel „Übertragbarkeit des Konzepts und Ausblick“ diskutiert die Übertragbarkeit des entwickelten Konzepts auf andere Schulen und betrachtet zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten der Online-Schülerzeitung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Online-Schülerzeitung, Neue Medien, Wissensgesellschaft, Journalismus, Kernlehrplan, Kooperation, Lokalzeitung, Schulprogramm, Schülerbeteiligung und Medienkompetenz.
Details
- Titel
- Konzeption und Erstellung einer Online-Schülerzeitung
- Untertitel
- Zeitungs-AG mit Schülern der Jahrgangsstufen 8-10
- Note
- 1,0
- Autor
- Christine Wieching (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 46
- Katalognummer
- V188394
- ISBN (eBook)
- 9783656120995
- ISBN (Buch)
- 9783656121398
- Dateigröße
- 668 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Diese Arbeit bietet einen Leitfaden über die Erstellung einer Online-Schülerzeitung. Es werden unterschiedliche Module wie "Technik im Web", "Rechtliche Grundlagen" und "Journalistische Arbeit" explizit ausgearbeitet,undzwar mit besonderem Augenmerk auf handlungsorientierte Erarbeitungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler dieser Module. Außerdem werden im Rahmen dieser Arbeit von mir erstellte Unterrichtsmaterialien veröffentlicht.
- Schlagworte
- themen konzeption erstellung online-schülerzeitung rahmen zeitungs-ag schülerinnen schülern jahrgangsstufen berücksichtigung lokalzeitung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 15,99
- Preis (Book)
- US$ 25,99
- Arbeit zitieren
- Christine Wieching (Autor:in), 2011, Konzeption und Erstellung einer Online-Schülerzeitung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/188394
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-