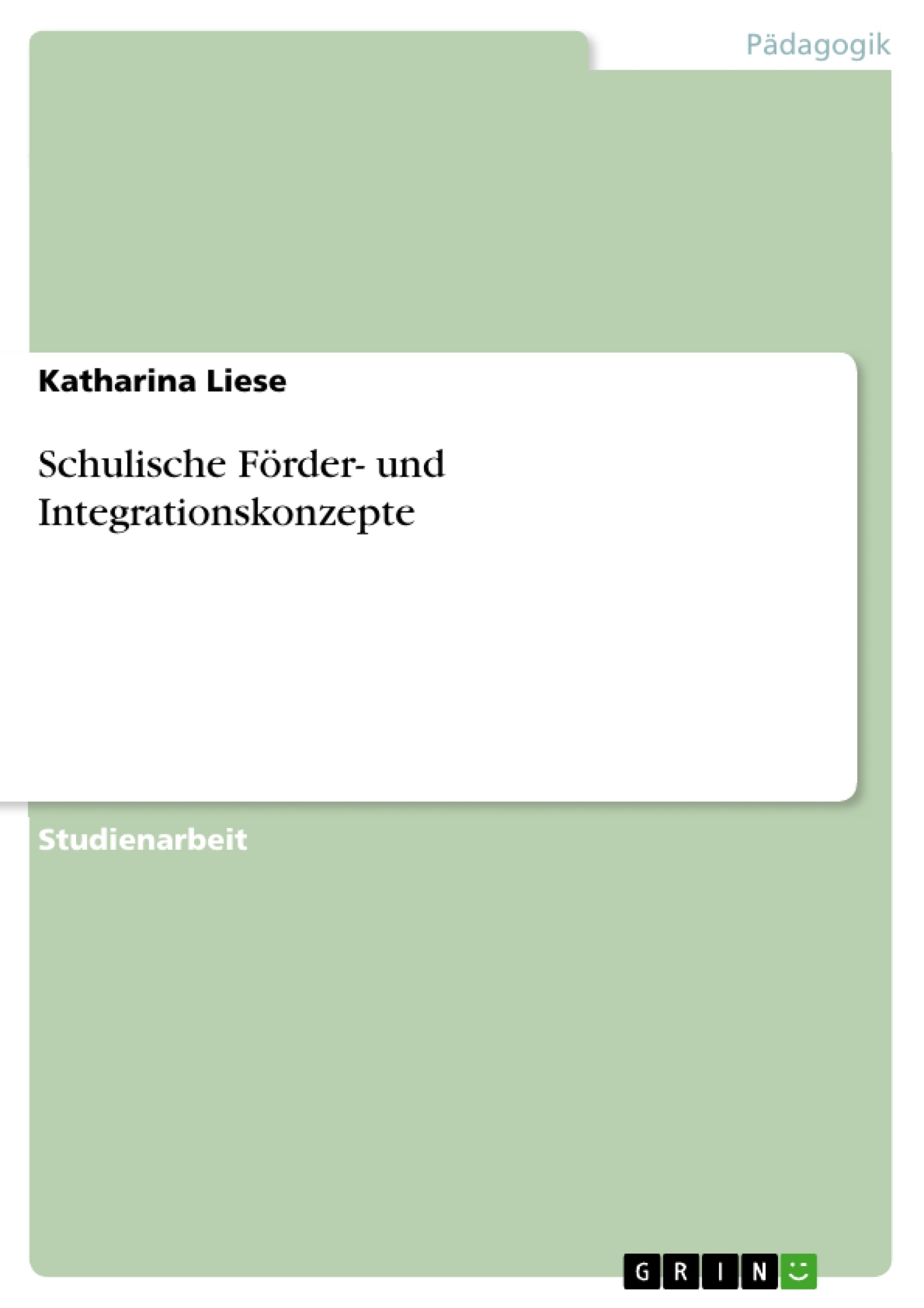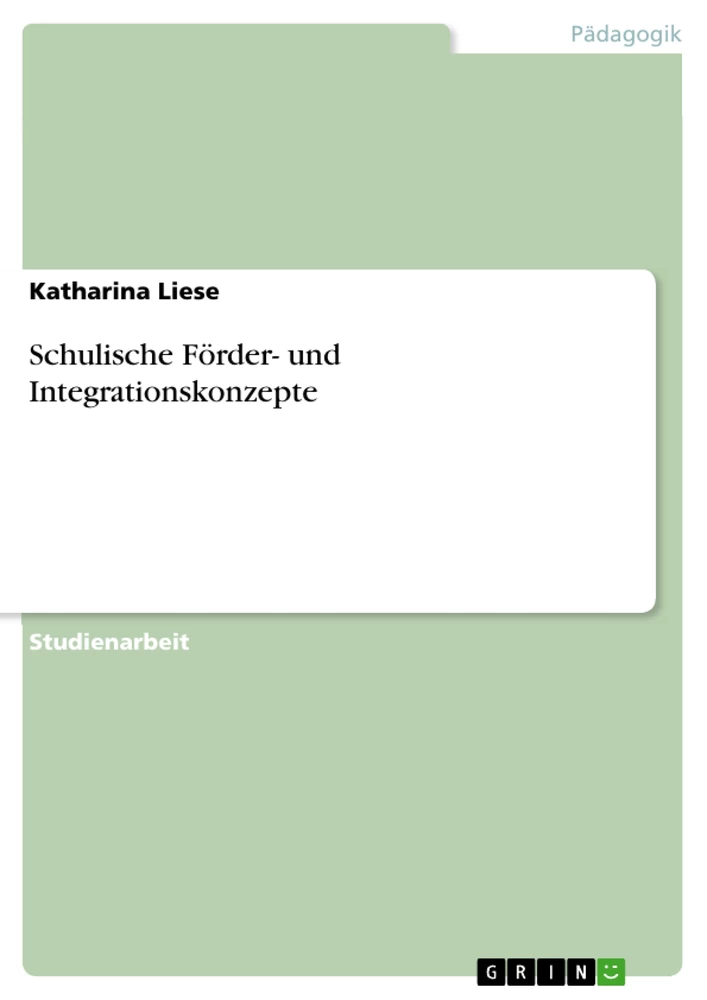
Schulische Förder- und Integrationskonzepte
Hausarbeit, 2010
15 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Individuelle Förderung: Definition und Verankerung im Schulgesetz
- 2. Schwerpunkte der individuellen Förderung
- 2.1. Hochbegabtenförderung
- 2.2. Förderung bei Lernschwierigkeiten
- 2.3. Geschlechterspezifische Förderung
- 2.4. Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund
- 2.5. Förderung der sozialen, moralischen und demokratischen Kompetenzen
- 3. Konzepte der individuellen Förderung
- 3.1. Differenzierende Maßnahmen
- 3.2. Wochenplanarbeit
- 3.3. Kooperatives Lernen
- 4. Integration
- 4.1. Das Projekt „Insel“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema der individuellen Förderung im schulischen Kontext und analysiert die Bedeutung des Begriffs, seine Verankerung im Schulgesetz und die verschiedenen Schwerpunkte der Förderung. Sie beleuchtet verschiedene Konzepte der individuellen Förderung, wie beispielsweise differenzierende Maßnahmen, Wochenplanarbeit und kooperatives Lernen, und betrachtet die Integration von Schülern mit besonderen Bedürfnissen.
- Definition und Verankerung der individuellen Förderung im Schulgesetz
- Schwerpunkte der individuellen Förderung: Hochbegabtenförderung, Förderung bei Lernschwierigkeiten, geschlechterspezifische Förderung, Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund und Förderung sozialer, moralischer und demokratischer Kompetenzen
- Konzepte der individuellen Förderung: differenzierende Maßnahmen, Wochenplanarbeit, kooperatives Lernen
- Integration von Schülern mit besonderen Bedürfnissen
- Kritischer Blick auf die Kategorisierung von förderbedürftigen Gruppen und deren Vereinbarkeit mit der Grundidee der individuellen Förderung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel definiert die individuelle Förderung und erläutert deren Verankerung im Schulgesetz des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Es wird hervorgehoben, dass alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen von dieser Förderung profitieren sollen. Das zweite Kapitel widmet sich den Schwerpunkten der individuellen Förderung und betrachtet verschiedene Gruppen, die besondere Unterstützung benötigen, wie Hochbegabte, Schüler mit Lernschwierigkeiten und Kinder mit Migrationshintergrund. Außerdem werden die Förderung geschlechterspezifischer Kompetenzen und die Förderung sozialer, moralischer und demokratischer Kompetenzen behandelt. Das dritte Kapitel geht auf Konzepte der individuellen Förderung ein, darunter differenzierende Maßnahmen, Wochenplanarbeit und kooperatives Lernen. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit dem Thema Integration und stellt das Projekt „Insel“ vor.
Schlüsselwörter
Individuelle Förderung, Schulgesetz, Hochbegabtenförderung, Lernschwierigkeiten, Geschlechterspezifische Förderung, Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund, soziale, moralische und demokratische Kompetenzen, differenzierende Maßnahmen, Wochenplanarbeit, kooperatives Lernen, Integration, Projekt „Insel“.
Details
- Titel
- Schulische Förder- und Integrationskonzepte
- Hochschule
- Universität Münster (Soziologie)
- Veranstaltung
- Seminar: Miteinander leben
- Note
- 1,0
- Autor
- Katharina Liese (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2010
- Seiten
- 15
- Katalognummer
- V188736
- ISBN (eBook)
- 9783656125815
- ISBN (Buch)
- 9783656127000
- Dateigröße
- 533 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Inklusion Fördern Fordern Förderkonzepte Forderkonzepte Hochbegabung Migrationshintergrund Schule Lernschwierigkeiten Integrationskonzepte Kooperatives Lernen Differenzierung Individuelle Förderung Soziologie Erziehungswissenschaften Integration Integrativ inklusiv
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 14,99
- Preis (Book)
- US$ 17,99
- Arbeit zitieren
- Katharina Liese (Autor:in), 2010, Schulische Förder- und Integrationskonzepte, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/188736
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-