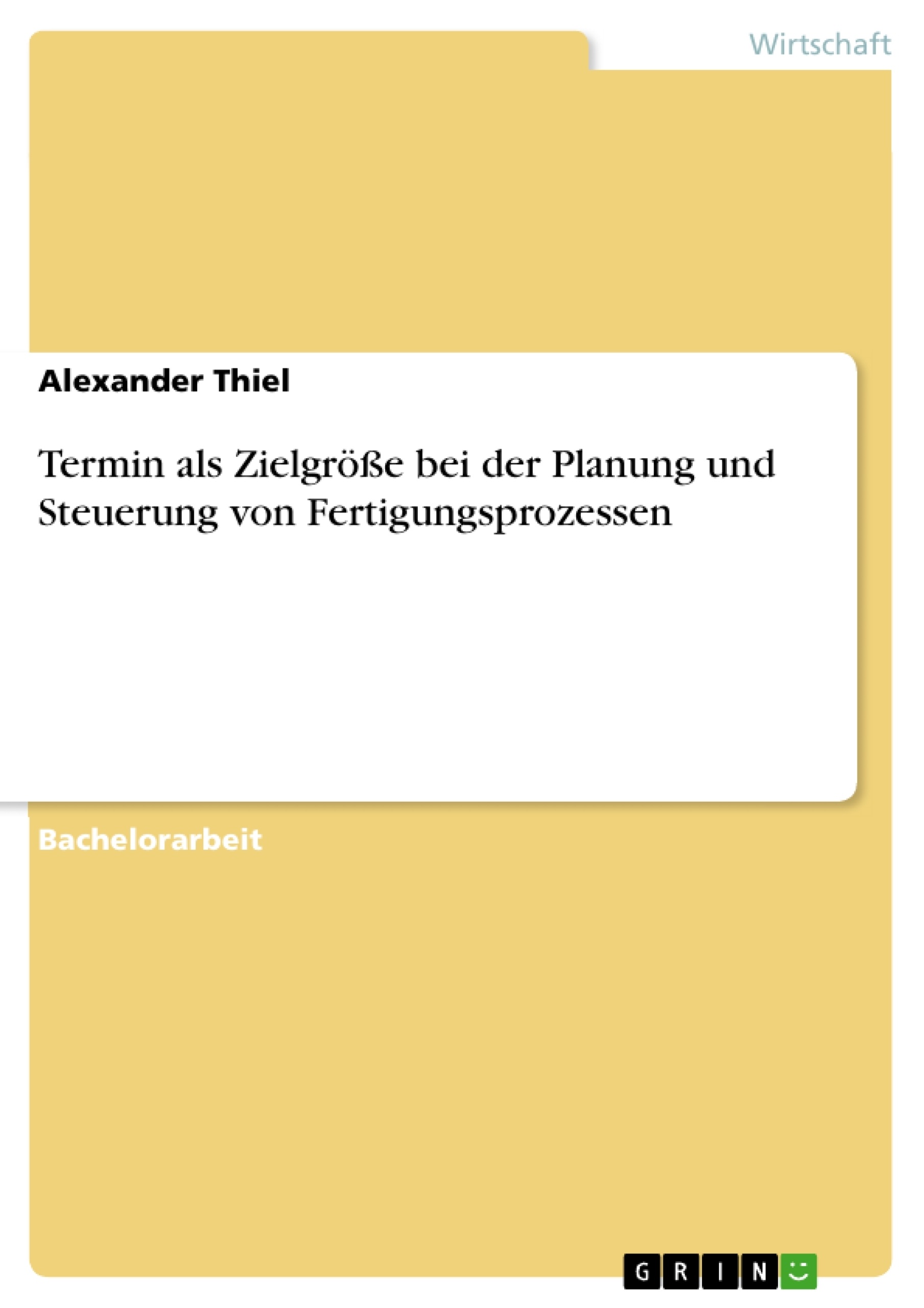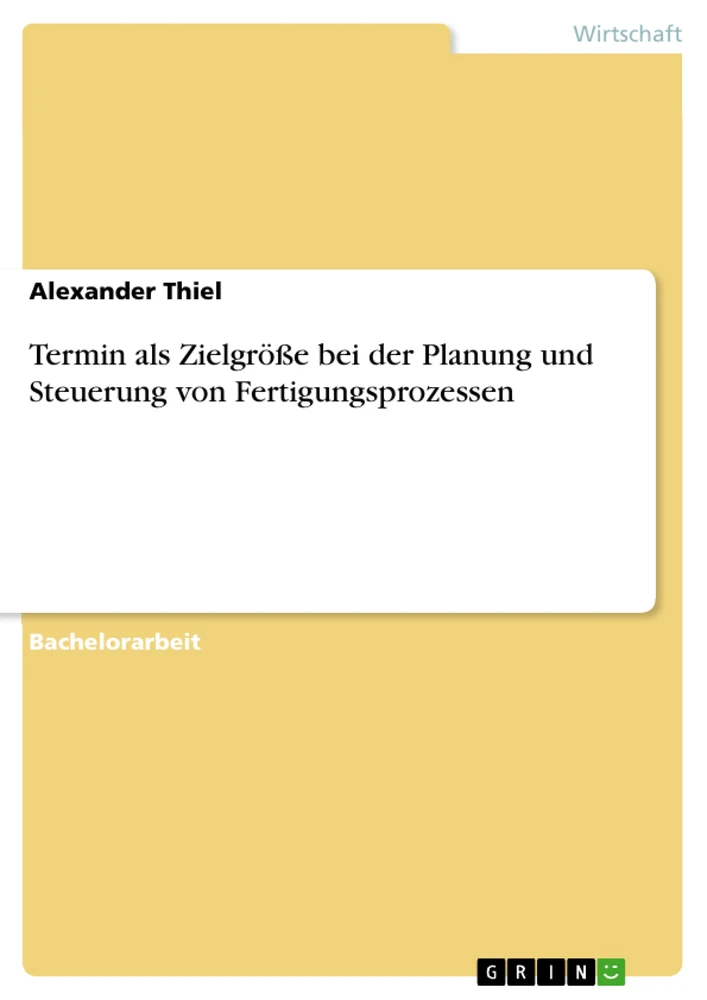
Termin als Zielgröße bei der Planung und Steuerung von Fertigungsprozessen
Bachelorarbeit, 2012
36 Seiten, Note: 2,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Konzeption und Zielstellung
- Relevante Grundlagen und Grundbegriffe
- Fertigungsprozess
- Planung
- Steuerung
- Produktionsplanung und -steuerung (PPS)
- Ziel
- Termin
- Termineinhaltung
- Terminabweichung
- Termintreue
- Einfluss auf Termin als messbare Zielgröße und ihre Probleme
- Beeinflussung der Termintreue als logistische Zielgröße
- Organisatorische Wirkungen des Termins
- Ökonomische Wirkungen des Termins
- Messbarkeit von Terminabweichung
- Messbarkeit von Termintreue
- Probleme bei der Quantifizierung
- Ansatzpunkte und Maßnahmen zur besseren Terminerfüllung
- Ansatzpunkte zur besseren Terminbeherrschung
- Systematisierung der Störungen aus Sicht der Produktionsfaktoren
- Ein Verfahren der Fertigungssteuerung
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Bedeutung des Termins als Zielgröße in der Planung und Steuerung von Fertigungsprozessen. Sie untersucht den Einfluss des Termins auf die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und analysiert die Herausforderungen und Möglichkeiten, die mit der Einhaltung von Terminen verbunden sind.
- Die Bedeutung von Terminen für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen
- Die Auswirkungen von Terminabweichungen auf die Effizienz von Fertigungsprozessen
- Die Herausforderungen bei der Messung und Quantifizierung von Termintreue
- Ansatzpunkte und Maßnahmen zur Verbesserung der Terminerfüllung
- Die Rolle von Produktionsplanung und -steuerung (PPS) bei der Terminbeherrschung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die Konzeption und Zielstellung der Arbeit und stellt die Bedeutung von Terminen für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen dar. Das zweite Kapitel erläutert wichtige Grundlagen und Grundbegriffe, die für die Untersuchung von Terminen in der Fertigung relevant sind. Es werden Themen wie Fertigungsprozess, Planung, Steuerung, Produktionsplanung und -steuerung (PPS), Ziel und Termin sowie deren Unterkategorien behandelt. Das dritte Kapitel widmet sich dem Einfluss des Termins als messbare Zielgröße auf die Effizienz von Fertigungsprozessen. Es analysiert die Beeinflussung der Termintreue als logistische Zielgröße, die organisatorischen und ökonomischen Wirkungen von Terminen sowie die Messbarkeit von Terminabweichung und Termintreue. Abschließend werden die Probleme bei der Quantifizierung von Terminabweichungen aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die Bachelorarbeit konzentriert sich auf die Schlüsselbegriffe Termin, Termintreue, Terminabweichung, Produktionsplanung und -steuerung (PPS), Fertigungsprozess und Wettbewerbsfähigkeit. Die Arbeit untersucht die Bedeutung dieser Themen für die effiziente Steuerung von Fertigungsprozessen und die Optimierung der Termintreue als logistische Zielgröße.
Details
- Titel
- Termin als Zielgröße bei der Planung und Steuerung von Fertigungsprozessen
- Hochschule
- Universität Rostock
- Veranstaltung
- Produktionswirtschaft
- Note
- 2,7
- Autor
- Alexander Thiel (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2012
- Seiten
- 36
- Katalognummer
- V189249
- ISBN (eBook)
- 9783656133612
- ISBN (Buch)
- 9783656133957
- Dateigröße
- 1421 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Termin Zielgröße Fertigungsprozess PPS
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 17,99
- Preis (Book)
- US$ 19,99
- Arbeit zitieren
- Alexander Thiel (Autor:in), 2012, Termin als Zielgröße bei der Planung und Steuerung von Fertigungsprozessen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/189249
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-