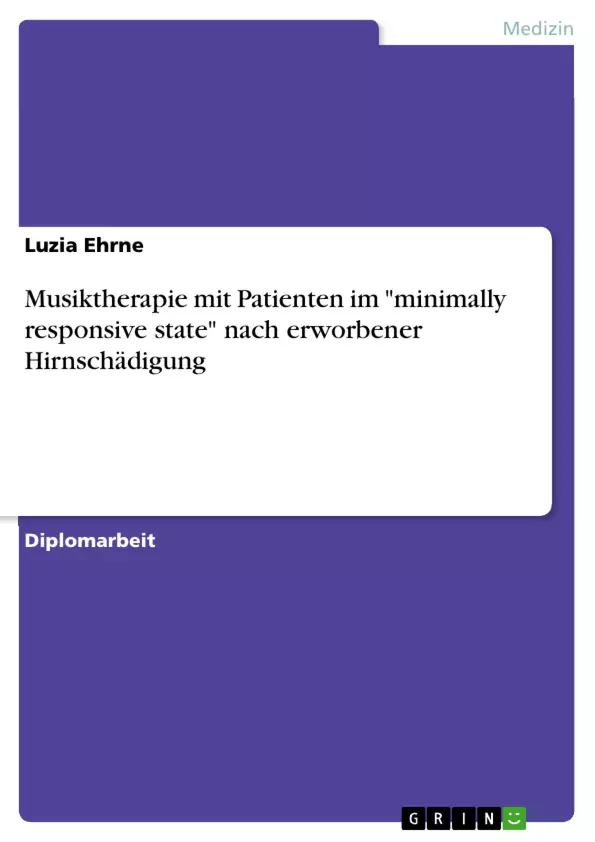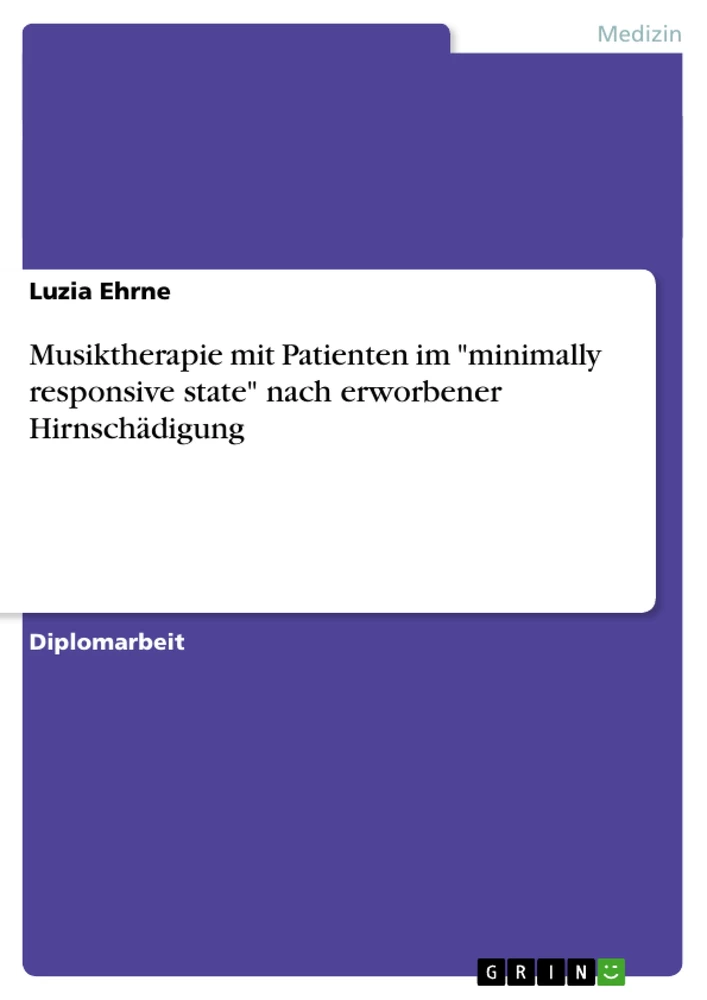
Musiktherapie mit Patienten im "minimally responsive state" nach erworbener Hirnschädigung
Diplomarbeit, 2009
107 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Akut erworbene Hirnschädigungen
- Schädel-Hirn-Trauma
- Verletzungsformen
- Schweregradeinteilung
- Schlaganfall
- Ischämie
- Intrazerebrale Blutung
- Subarachnoidalblutung
- Zerebrale Hypoxie
- Neurologische Folgen und Rehabilitation
- Neurologische Funktionsstörungen
- Phasenmodell der neurologischen Rehabilitation
- Versorgungssituation in Österreich
- Minimally Responsive State
- Das apallische Syndrom – eine mögliche „Vorstufe“ zum minimally responsive state
- Die Remissionsstadien des apallischen Syndroms nach Gerstenbrand
- Primitiv-psychomotorische Phase
- Phase des Nachgreifens
- Klüver-Bucy-Phase
- Korsakow-Phase
- Integrationsstadium
- Der Patient im minimally responsive state
- Von der Kommunikationsanbahnung zur therapeutischen Beziehung
- Begriffsklärung
- Kommunikation und Beziehungsaufbau mit Patienten im minimally responsive state
- Die Bewusstseinslage des Patienten
- Das Modell des Dialogaufbaus nach Zieger
- Körpersprache als Kommunikationsmittel
- Biomedizin versus Beziehungsmedizin – Wie die Grundhaltung zum Patienten das Beziehungsgeschehen beeinflusst
- Objektivität versus Subjektivität – Zur Darstellung von zwischenmenschlichem Beziehungsgeschehen in der Therapie
- Musiktherapie mit Patienten im minimally responsive state
- Musik
- Wahrnehmung und Verarbeitung von Musik
- Wirkfaktoren der Musik
- Elemente der Musik
- Methodische Vorgehensweisen zum Aufbau von Kommunikation und Beziehung in der Musiktherapie
- Therapeutische Grundhaltung
- Körperliche Berührung im musiktherapeutischen Kontext
- Atem und Stimme
- Den Patienten in der Musik spiegeln und ihm Resonanz geben
- Geführtes Instrumentalspiel
- Das Verwenden von Tonträgern
- Orientierungsreaktionen des Patienten erkennen und deuten
- Falldarstellungen
- Musiktherapieverlauf von Herrn K.
- Ausgangssituation
- Angewendete Methodik und weiterer Verlauf
- Musiktherapieverlauf von Frau B.
- Ausgangssituation
- Angewendete Methodik und weiterer Verlauf
- Reflexion nach Abschluss der musiktherapeutischen Praxiserfahrungen
- Resümee und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die musiktherapeutische Arbeit mit Patienten im minimally responsive state nach erworbener Hirnschädigung. Ziel ist es, Wege aufzuzeigen, wie Kontakt, Kommunikation und Beziehung zu diesen Patienten aufgebaut werden können. Die Arbeit verknüpft theoretische Grundlagen mit praktischen Erfahrungen.
- Kommunikationsanbahnung im minimally responsive state
- Beziehungsaufbau zu Patienten mit eingeschränkter Kommunikationsfähigkeit
- Wirkfaktoren der Musik in der Neurologischen Rehabilitation
- Methodische Vorgehensweisen der Musiktherapie bei Hirnschädigung
- Fallbeispiele aus der musiktherapeutischen Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Diplomarbeit ein und beschreibt den persönlichen Zugang der Autorin zum Thema. Sie skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit.
Akut erworbene Hirnschädigungen: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über verschiedene Arten akut erworbener Hirnschädigungen wie Schädel-Hirn-Traumata, Schlaganfälle und zerebrale Hypoxien. Es werden Verletzungsformen, Schweregradeinteilungen und neurologische Folgen detailliert beschrieben. Der Fokus liegt auf den Auswirkungen dieser Schädigungen auf das Nervensystem und die daraus resultierenden Beeinträchtigungen. Das Kapitel erläutert zudem das Phasenmodell der neurologischen Rehabilitation und die Versorgungssituation in Österreich.
Minimally Responsive State: Dieses Kapitel definiert den minimally responsive state und beschreibt ihn im Kontext des apallischen Syndroms als mögliche Vorstufe. Die verschiedenen Remissionsstadien des apallischen Syndroms nach Gerstenbrand werden erläutert, um das Verständnis für den Zustand der Patienten zu vertiefen. Es wird detailliert auf die Charakteristika des minimally responsive states eingegangen und der Unterschied zu anderen Bewusstseinszuständen herausgearbeitet.
Von der Kommunikationsanbahnung zur therapeutischen Beziehung: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Aufbau von Kommunikation und Beziehung zu Patienten im minimally responsive state. Es werden wichtige Begriffe wie Kontakt, Begegnung und therapeutische Beziehung definiert und im Kontext der Arbeit erläutert. Das Kapitel beschreibt die Bedeutung von Körpersprache und den Herausforderungen bei der Interpretation von zwischenmenschlichen Interaktionen in diesem Kontext. Es werden verschiedene Ansätze des Dialogaufbaus und der Bedeutung der therapeutischen Grundhaltung diskutiert.
Musiktherapie mit Patienten im minimally responsive state: Dieses Kapitel beschreibt die Anwendung von Musiktherapie bei Patienten im minimally responsive state. Es beleuchtet die Wahrnehmung und Verarbeitung von Musik bei diesen Patienten und diskutiert die Wirkfaktoren der Musik im therapeutischen Kontext. Es werden verschiedene methodische Vorgehensweisen der Musiktherapie detailliert beschrieben, darunter die Bedeutung der therapeutischen Grundhaltung, der Einsatz von Körperberührung, Atem- und Stimmübungen, geführtes Instrumentalspiel und die Verwendung von Tonträgern. Die Interpretation von Orientierungsreaktionen der Patienten spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
Falldarstellungen: Dieses Kapitel präsentiert Fallbeispiele aus der musiktherapeutischen Praxis der Autorin. Es werden die Ausgangssituationen, die angewandte Methodik und der Verlauf der Therapie bei zwei Patienten (Herr K. und Frau B.) detailliert dargestellt. Diese Fallbeispiele veranschaulichen die im vorherigen Kapitel beschriebenen methodischen Vorgehensweisen und deren praktische Anwendung. Eine abschließende Reflexion der Praxiserfahrungen rundet das Kapitel ab.
Schlüsselwörter
Akut erworbene Hirnschädigung, minimally responsive state, Musiktherapie, Neurologische Rehabilitation, Kommunikationsanbahnung, Beziehungsaufbau, Wirkfaktoren der Musik, therapeutische Grundhaltung, Falldarstellung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Musiktherapie mit Patienten im minimally responsive state nach erworbener Hirnschädigung
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht den Einsatz von Musiktherapie bei Patienten im minimally responsive state (MRS) nach einer erworbenen Hirnschädigung. Der Fokus liegt auf dem Aufbau von Kontakt, Kommunikation und therapeutischer Beziehung zu diesen Patienten.
Welche Arten von Hirnschädigungen werden betrachtet?
Die Arbeit behandelt verschiedene Arten akut erworbener Hirnschädigungen, darunter Schädel-Hirn-Traumata (SHT), Schlaganfälle (ischämisch und hämorrhagisch) und zerebrale Hypoxien. Die Auswirkungen dieser Schädigungen auf das Nervensystem und die daraus resultierenden Beeinträchtigungen werden beschrieben.
Was ist der minimally responsive state (MRS)?
Der MRS wird definiert und im Kontext des apallischen Syndroms als mögliche Vorstufe erklärt. Die verschiedenen Remissionsstadien des apallischen Syndroms nach Gerstenbrand werden erläutert, um das Verständnis für den Zustand der Patienten zu vertiefen. Die Charakteristika des MRS und der Unterschied zu anderen Bewusstseinszuständen werden herausgearbeitet.
Wie wird die Kommunikationsanbahnung und der Beziehungsaufbau beschrieben?
Die Arbeit beschreibt den Aufbau von Kommunikation und Beziehung zu Patienten im MRS. Es werden wichtige Begriffe wie Kontakt, Begegnung und therapeutische Beziehung definiert. Die Bedeutung der Körpersprache und die Herausforderungen bei der Interpretation zwischenmenschlicher Interaktionen werden diskutiert. Verschiedene Ansätze des Dialogaufbaus und die Bedeutung der therapeutischen Grundhaltung werden beleuchtet.
Welche methodischen Vorgehensweisen der Musiktherapie werden vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt die Anwendung von Musiktherapie im MRS. Die Wahrnehmung und Verarbeitung von Musik bei diesen Patienten und die Wirkfaktoren der Musik im therapeutischen Kontext werden beleuchtet. Es werden methodische Vorgehensweisen detailliert beschrieben, darunter die therapeutische Grundhaltung, der Einsatz von Körperberührung, Atem- und Stimmübungen, geführtes Instrumentalspiel und die Verwendung von Tonträgern. Die Interpretation von Orientierungsreaktionen der Patienten wird ebenfalls behandelt.
Welche Fallbeispiele werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert Fallbeispiele aus der musiktherapeutischen Praxis der Autorin. Es werden die Ausgangssituationen, die angewandte Methodik und der Verlauf der Therapie bei zwei Patienten (Herr K. und Frau B.) detailliert dargestellt. Diese Fallbeispiele veranschaulichen die beschriebenen methodischen Vorgehensweisen und deren praktische Anwendung. Eine abschließende Reflexion der Praxiserfahrungen ist enthalten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Akut erworbene Hirnschädigung, minimally responsive state, Musiktherapie, Neurologische Rehabilitation, Kommunikationsanbahnung, Beziehungsaufbau, Wirkfaktoren der Musik, therapeutische Grundhaltung, Falldarstellung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Diplomarbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Wege aufzuzeigen, wie Kontakt, Kommunikation und Beziehung zu Patienten im MRS aufgebaut werden können. Sie verknüpft theoretische Grundlagen mit praktischen Erfahrungen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Kommunikationsanbahnung im MRS, den Beziehungsaufbau zu Patienten mit eingeschränkter Kommunikationsfähigkeit, die Wirkfaktoren der Musik in der neurologischen Rehabilitation, methodische Vorgehensweisen der Musiktherapie bei Hirnschädigung und Fallbeispiele aus der musiktherapeutischen Praxis.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zu akut erworbenen Hirnschädigungen, dem MRS, der Kommunikationsanbahnung und Beziehungsarbeit, der Musiktherapie im MRS, Falldarstellungen und ein Resümee mit Ausblick. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis ist im Dokument enthalten.
Details
- Titel
- Musiktherapie mit Patienten im "minimally responsive state" nach erworbener Hirnschädigung
- Hochschule
- Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (Institut für Musik- und Bewegungserziehung sowie Musiktherapie)
- Note
- 1,0
- Autor
- Luzia Ehrne (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2009
- Seiten
- 107
- Katalognummer
- V190914
- ISBN (eBook)
- 9783656157434
- ISBN (Buch)
- 9783656157885
- Dateigröße
- 842 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- minimally responsive state minimally conscious state neurologische Rehabilitation Musiktherapie Kommunikationsanbahnung Beziehungsaufbau Wirkfaktoren der Musik therapeutische Grundhaltung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Luzia Ehrne (Autor:in), 2009, Musiktherapie mit Patienten im "minimally responsive state" nach erworbener Hirnschädigung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/190914
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-