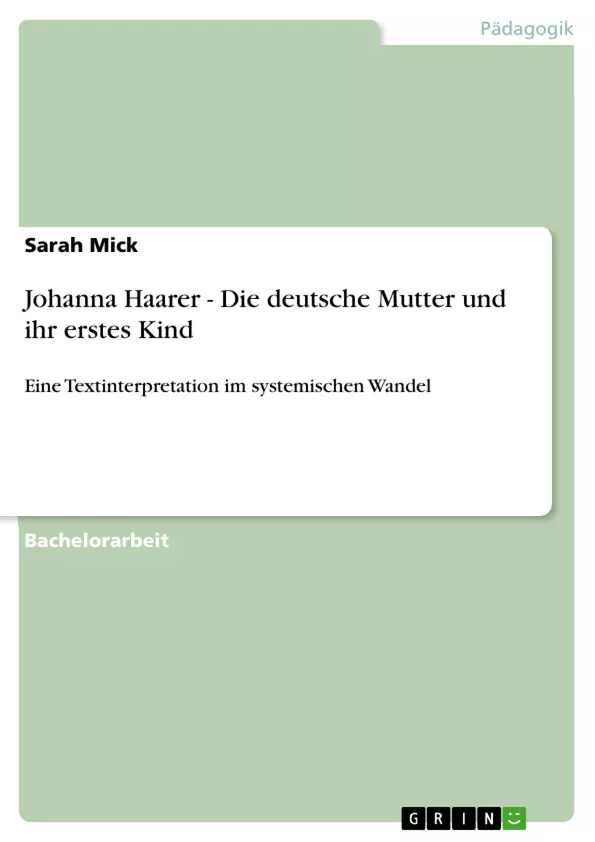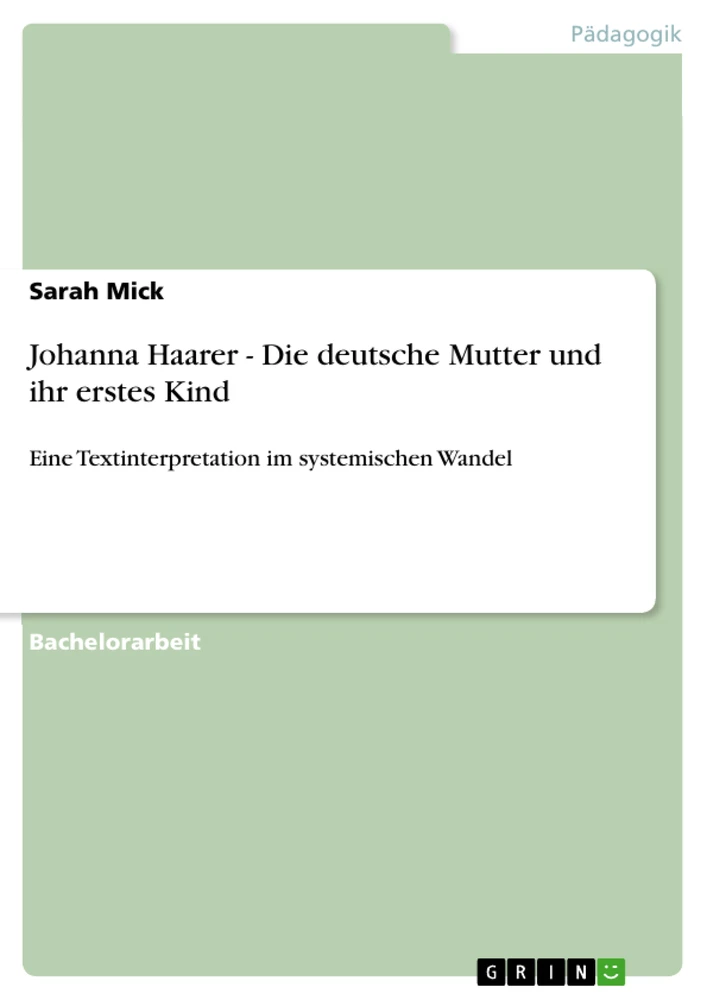
Johanna Haarer - Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind
Bachelorarbeit, 2010
30 Seiten, Note: 2,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundsätze nationalsozialistischer Erziehung
- Das Leben der Johanna Haarer
- Das Buch „Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind“
- Geschichte des Buches
- Der J.F. Lehmanns Verlag
- Folgewerke der Autorin
- Umsetzung der nationalsozialistischen Ideen im Buch
- Analyse der Vorworte des Buches
- Die Mutter-Kind-Beziehung im Wandel
- Die idealisierte Mutterfigur
- Das Kind als ewige Herausforderung
- Die Rolle des Vaters im Wandel – vom Erbanlagenspender zum Familienvater
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit analysiert und interpretiert die Bücher „Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind“ von Johanna Haarer aus den Jahren 1934, 1937, 1953, 1963, 1978 und 1987, um den Wandel der Mutter- und Vaterrolle im Kontext der nationalsozialistischen Erziehung zu untersuchen.
- Die Grundsätze der nationalsozialistischen Erziehung und deren Einfluss auf die Werke von Johanna Haarer
- Die Entwicklung des Buches „Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind“ und die Veränderungen in den verschiedenen Ausgaben
- Die idealisierte Mutterrolle und das Kind als Herausforderung in den Werken
- Der Wandel der Vaterrolle von der Rolle des Erbanlagenspenders hin zum Familienvater
- Die Rezeption und Auswirkungen der Werke von Johanna Haarer auf die Erziehungsdebatte in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Bachelorarbeit ein und beleuchtet die Relevanz des gewählten Themas im Kontext der nationalsozialistischen Erziehung.
- Grundsätze nationalsozialistischer Erziehung: Dieses Kapitel stellt die grundlegenden Prinzipien der nationalsozialistischen Erziehung vor, die in Adolf Hitlers Werk „Mein Kampf“ deutlich werden. Hier werden die Aspekte der Rassenhygiene, der körperlichen und seelischen Erziehung, der geschlechtsspezifischen Erziehung und des Führerprinzips betrachtet.
- Das Leben der Johanna Haarer: Hier wird die Biographie der Autorin Johanna Haarer beleuchtet und ihr Werdegang im Kontext der Zeit des Nationalsozialismus untersucht.
- Das Buch „Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind“: Dieser Abschnitt geht auf die Geschichte des Buches, den J.F. Lehmanns Verlag und die Folgewerke der Autorin ein.
- Umsetzung der nationalsozialistischen Ideen im Buch: Dieses Kapitel analysiert, inwiefern die Grundsätze der nationalsozialistischen Erziehung in den Werken von Johanna Haarer umgesetzt wurden.
- Analyse der Vorworte des Buches: Hier werden die Vorworte der verschiedenen Ausgaben des Buches und deren Wandel interpretiert.
- Die Mutter-Kind-Beziehung im Wandel: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Idealbild der Mutter und der Herausforderung, die das Kind für sie darstellt.
- Die Rolle des Vaters im Wandel – vom Erbanlagenspender zum Familienvater: In diesem Abschnitt wird die Entwicklung der Vaterrolle im Kontext der Erziehungsratgeber von Johanna Haarer betrachtet.
Schlüsselwörter
Die vorliegenden Arbeit befasst sich mit den Themen nationalsozialistische Erziehung, Säuglingspflege, Rassenhygiene, Mutter-Kind-Beziehung, Geschlechterrollen, Vaterrolle, Johanna Haarer, "Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind", Erziehungsratgeber, Ideologiekritik, und historische Analyse.
Details
- Titel
- Johanna Haarer - Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind
- Untertitel
- Eine Textinterpretation im systemischen Wandel
- Hochschule
- Friedrich-Schiller-Universität Jena (Institut für Erziehungswissenschaften)
- Note
- 2,0
- Autor
- Sarah Mick (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2010
- Seiten
- 30
- Katalognummer
- V191143
- ISBN (Buch)
- 9783656158660
- ISBN (eBook)
- 9783656158752
- Dateigröße
- 511 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- johanna haarer mutter kind eine textinterpretation wandel
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Sarah Mick (Autor:in), 2010, Johanna Haarer - Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/191143
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-