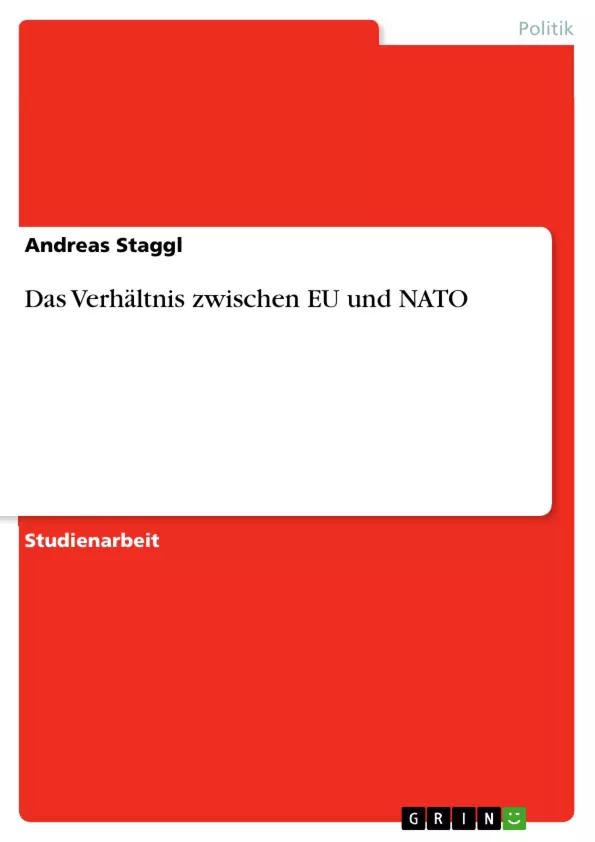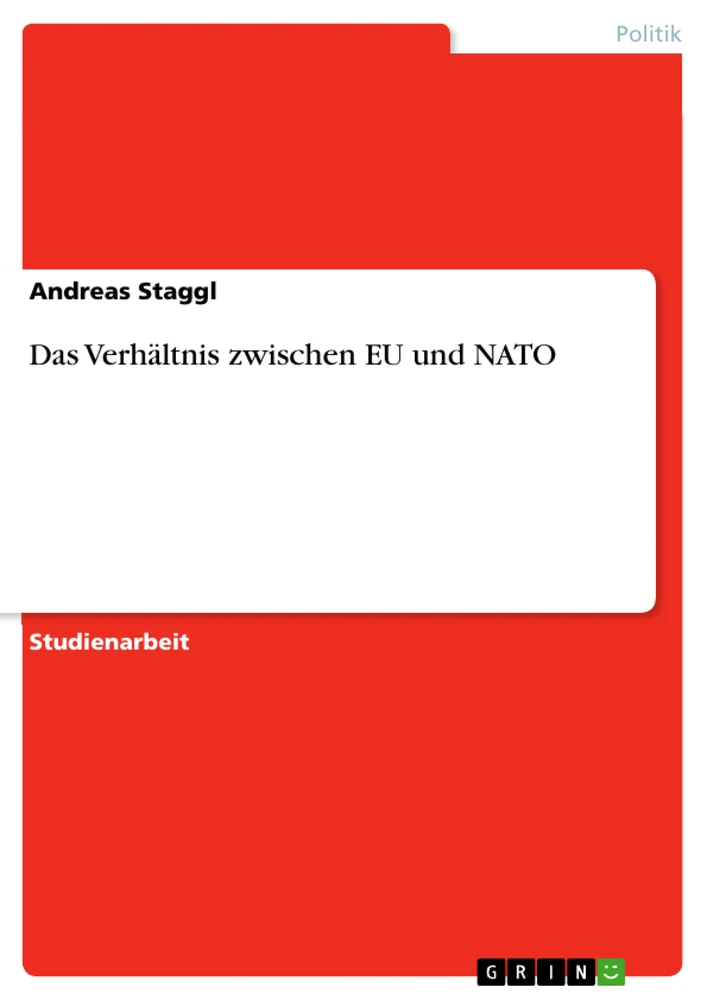
Das Verhältnis zwischen EU und NATO
Seminararbeit, 2009
15 Seiten
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die NATO nach dem Kalten Krieg
- Gegenwärtiger Stand der ESVP
- Ziele und Strategien
- Fähigkeiten
- Unterschiedliche europäische Interessen
- Zusammenarbeit zwischen NATO und ESVP
- Fazit/Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das Verhältnis zwischen der Europäischen Union (EU) und der Nordatlantischen Vertragsorganisation (NATO) im Kontext der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP). Es soll geklärt werden, ob die ESVP auf dem Weg zu einer Konkurrenz der NATO ist, insbesondere im Hinblick auf die Fähigkeiten im militärischen Konfliktmanagement. Die Arbeit untersucht, ob die EU eine eigenständige Militärmacht ist und welche Rolle die USA im transatlantischen Verhältnis spielt.
- Die Entwicklung der NATO nach dem Kalten Krieg
- Die Ziele und Strategien der ESVP
- Die Fähigkeiten der ESVP im militärischen Konfliktmanagement
- Unterschiedliche Interessen innerhalb der EU
- Die Zusammenarbeit zwischen NATO und ESVP
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Der Aufsatz untersucht die Frage, ob die ESVP auf dem Weg zu einer Konkurrenz der NATO ist, insbesondere im Hinblick auf die Fähigkeiten im militärischen Konfliktmanagement.
- Die NATO nach dem Kalten Krieg: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der NATO nach dem Ende des Kalten Krieges, insbesondere die Ausweitung des Handlungsgebiets, die Aufnahme neuer Mitglieder und den Aufbau ziviler Mittel des Konfliktmanagements.
- Gegenwärtiger Stand der ESVP: Dieses Kapitel skizziert die Ziele und Strategien der ESVP sowie die Fähigkeiten der EU im militärischen Konfliktmanagement. Es wird untersucht, ob die EU eine eigenständige Militärmacht ist.
- Unterschiedliche europäische Interessen: Dieses Kapitel analysiert die unterschiedlichen Interessen von drei „Großmächten“ innerhalb der EU (Großbritannien, Frankreich und Deutschland) im Hinblick auf die ESVP und die NATO.
- Zusammenarbeit zwischen NATO und ESVP: Dieses Kapitel untersucht die gegenwärtige Zusammenarbeit zwischen der NATO und der ESVP.
Schlüsselwörter
Europäische Union (EU), Nordatlantische Vertragsorganisation (NATO), Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP), Militärmacht, Konfliktmanagement, transatlantische Beziehungen, Interessenvertretung.
Häufig gestellte Fragen
Ist die EU (ESVP) eine Konkurrenz für die NATO?
Die Arbeit untersucht, ob die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) eigene militärische Fähigkeiten aufbaut, die die NATO ergänzen oder herausfordern.
Kann die EU als eigenständige Militärmacht agieren?
Unter Militärmacht wird die Fähigkeit verstanden, Interessen im Bedarfsfall mit eigenen militärischen Mitteln durchzusetzen; die Arbeit prüft, ob die EU diesen Status erreicht hat.
Worin unterscheiden sich die Interessen von Deutschland, Frankreich und Großbritannien?
Frankreich strebt oft nach europäischer Autonomie, Großbritannien setzt traditionell stärker auf die NATO, und Deutschland sucht meist einen Ausgleich zwischen beiden Polen.
Wie hat sich die NATO nach dem Kalten Krieg verändert?
Die NATO erweiterte ihr Handlungsgebiet, nahm neue Mitglieder auf und baute verstärkt zivile sowie militärische Mittel für das globale Konfliktmanagement auf.
Welchen Einfluss hatte der Irak-Krieg auf das transatlantische Verhältnis?
Die Differenzen über den Irak-Krieg führten zu Spannungen und verstärkten den Wunsch nach einer eigenständigen europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
Details
- Titel
- Das Verhältnis zwischen EU und NATO
- Hochschule
- Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
- Autor
- Andreas Staggl (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2009
- Seiten
- 15
- Katalognummer
- V191671
- ISBN (eBook)
- 9783656166207
- ISBN (Buch)
- 9783656166696
- Dateigröße
- 419 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- NATO GASP ESVP EU Europa soft power battle groups Transatlantische beziehungen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 14,99
- Preis (Book)
- US$ 16,99
- Arbeit zitieren
- Andreas Staggl (Autor:in), 2009, Das Verhältnis zwischen EU und NATO, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/191671
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-