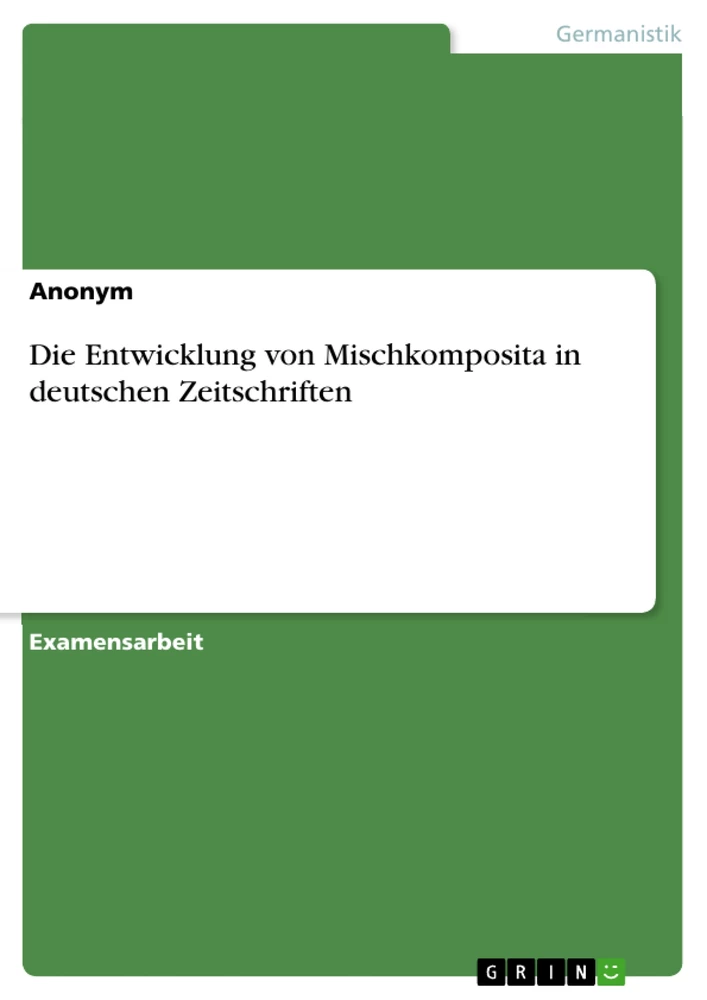
Die Entwicklung von Mischkomposita in deutschen Zeitschriften
Examensarbeit, 2011
47 Seiten, Note: 2,,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition Mischkompositum
- Ziel und Aufbau der Arbeit
- Mischkomposita im System der Wortbildung
- Forschungsstand
- Analyse
- Vorgehen
- Beschreibung des Datenmaterials
- Auffälligkeiten und Schwierigkeiten
- Ergebnisse
- Interpretation der Ergebnisse
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Entwicklung der Häufigkeit von Mischkomposita in der deutschen Presse. Sie analysiert die Entwicklung dieser Wortbildungsform unter Berücksichtigung des Einflusses der englischen Sprache auf den deutschen Wortschatz im 20. und 21. Jahrhundert.
- Die Definition und Charakterisierung von Mischkomposita
- Die Rolle von Mischkomposita im System der deutschen Wortbildung
- Die Entwicklung der Häufigkeit von Mischkomposita in der Presse
- Die Analyse von Mischkomposita in verschiedenen Zeitschriften
- Die Interpretation der Ergebnisse im Hinblick auf den Einfluss der englischen Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Relevanz der Untersuchung der Entwicklung von Mischkomposita in der Presse dar. Sie führt in die Thematik ein und erläutert die Bedeutung von Wortbildung im Allgemeinen und Mischkomposita im Besonderen.
- Das Kapitel "Definition Mischkompositum" liefert eine präzise Definition des Begriffs Mischkompositum und erläutert die Merkmale dieser Wortbildungsform.
- Das Kapitel "Ziel und Aufbau der Arbeit" legt die Forschungsziele und die methodische Vorgehensweise der Arbeit dar. Es beschreibt den Umfang der Untersuchung und die verwendete Methodik.
- Das Kapitel "Mischkomposita im System der Wortbildung" beleuchtet die Einordnung von Mischkomposita in das System der deutschen Wortbildung und stellt ihre Funktion im Kontext der Wortbildungsprozesse dar.
- Das Kapitel "Forschungsstand" gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der Forschung zum Thema Mischkomposita. Es stellt die wichtigsten Studien und Ergebnisse der bisherigen Forschung dar.
- Das Kapitel "Analyse" beschreibt die Methodik der Datenerhebung und -analyse. Es erläutert die Vorgehensweise bei der Auswahl der Zeitschriften und die Methoden zur Analyse der Mischkomposita.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Entwicklung von Mischkomposita in der deutschen Presse, die Bedeutung der englischen Sprache für den deutschen Wortschatz, Wortbildung, Fremdwörter, Lexik, Sprachwandel, Presse, Zeitschriften, Quantitative Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Mischkompositum?
Ein Mischkompositum ist ein zusammengesetztes Wort, das aus mindestens einer deutschen und einer fremdsprachigen (meist englischen) Komponente besteht.
Warum nehmen Komposita in der deutschen Sprache zu?
Gründe sind der Benennungsbedarf für neue Dinge, das Streben nach Prägnanz (Sprachökonomie) und stilistische Verdichtung, besonders in der Presse.
Welche Rolle spielt die englische Sprache für den deutschen Wortschatz?
Englische Einflüsse führen zur Bildung zahlreicher neuer Wörter, die oft als Mischkomposita in Zeitschriften und Zeitungen auftauchen.
Warum werden Mischkomposita besonders häufig in Zeitschriften verwendet?
Sie ermöglichen es, komplexe Sachverhalte in Überschriften kompakt zusammenzufassen und Informationen für den Leser schnell konsumierbar zu machen.
Wie wird die Entwicklung von Mischkomposita wissenschaftlich untersucht?
Durch quantitative Analysen von Datenmaterial aus verschiedenen Presseerzeugnissen über einen längeren Zeitraum hinweg.
Details
- Titel
- Die Entwicklung von Mischkomposita in deutschen Zeitschriften
- Hochschule
- Universität Stuttgart
- Note
- 2,,0
- Autor
- Anonym (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 47
- Katalognummer
- V191798
- ISBN (eBook)
- 9783656178668
- ISBN (Buch)
- 9783656178798
- Dateigröße
- 676 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- entwicklung mischkomposita zeitschriften
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2011, Die Entwicklung von Mischkomposita in deutschen Zeitschriften, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/191798
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









