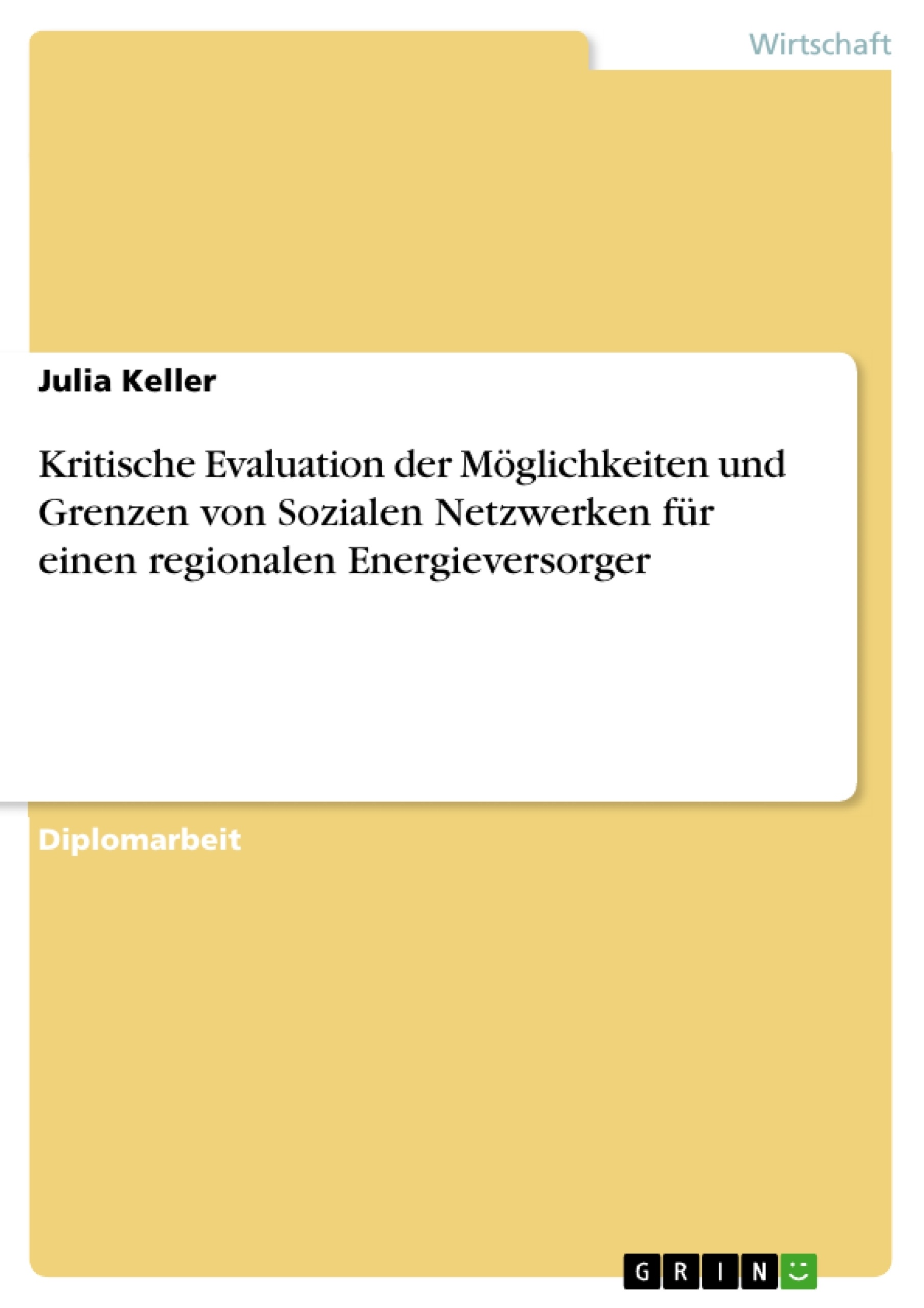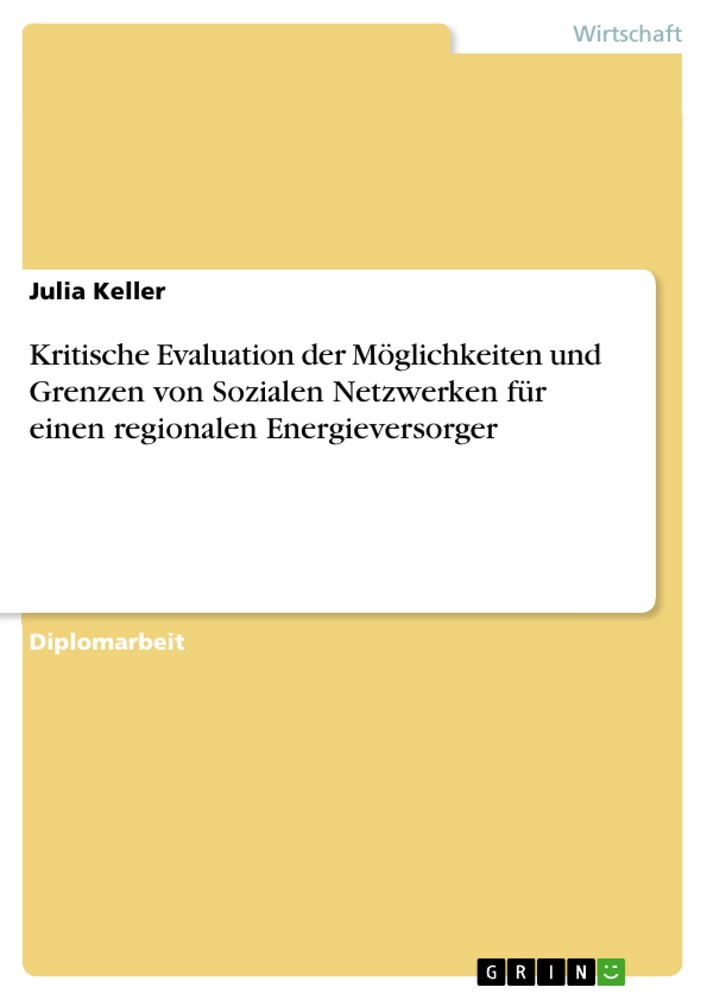
Kritische Evaluation der Möglichkeiten und Grenzen von Sozialen Netzwerken für einen regionalen Energieversorger
Diplomarbeit, 2011
77 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung und Problemstellung sowie die daraus resultierende Forschungsfrage
- 2 Energiewirtschaftliche Grundlagen
- 2.1 Beschreibung des Referenzunternehmens
- 2.2 Charakteristika der Energiewirtschaft in Deutschland
- 2.3 Zielgruppen der Energiewirtschaft
- 3 Charakteristika „Soziale Netzwerke“ im Web 2.0.
- 3.1 Begriffsdiskussion „Soziales Netzwerk“
- 3.2 Anforderungen und Kriterien an Soziale Netzwerke aus unternehmerischer Sicht
- 3.3 Analyse und Beschreibung von geeigneten „Sozialen Netzwerken“
- 4 Analyse von Sozialen Netzwerken als Kommunikations- und/oder Absatzinstrument
- 4.1 Ziele der Erhebung
- 4.2 Angewandte Methode zur Durchführung der Erhebung
- 4.3 Anforderungen und Vorgehensweise der Analyse
- 4.4 Auswertung der Ergebnisse
- 5 Möglichkeiten der Nutzung von sozialen Netzwerken als Kommunikations- und Absatzkanal
- 5.1 Online-Werbung
- 5.2 Unternehmensprofil
- 5.3 Möglichkeiten der Gestaltung von Unternehmensprofilen und Gruppen
- 6 Grenzen der Nutzung von sozialen Netzwerken als Kommunikations- und Absatzkanal
- 6.1 Verlust von Informationshoheit
- 6.2 Rechtliche Grenzen des Social Media Marketings
- 6.3 Etablierung eines Community-Managements
- 7 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der kritischen Evaluation der Möglichkeiten und Grenzen von sozialen Netzwerken im Kontext eines regionalen Energieversorgers. Sie analysiert die Einsatzmöglichkeiten und Herausforderungen von sozialen Netzwerken als Kommunikations- und Absatzinstrument in der Energiewirtschaft.
- Begriffsdefinition und Charakteristika von Sozialen Netzwerken im Web 2.0.
- Analyse von sozialen Netzwerken aus unternehmerischer Sicht, mit Fokus auf die Energiewirtschaft.
- Potenziale und Herausforderungen der Nutzung von Sozialen Netzwerken als Kommunikations- und Absatzkanal.
- Rechtliche und strategische Aspekte des Social Media Marketings.
- Etablierung eines Community-Managements für effektive Social Media Präsenz.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung und einer präzisen Problemstellung, die die Forschungsfrage der Arbeit formuliert. Kapitel 2 beleuchtet die energiewirtschaftlichen Grundlagen, indem es das Referenzunternehmen beschreibt, die Charakteristika der Energiewirtschaft in Deutschland beleuchtet und die Zielgruppen der Branche analysiert. Kapitel 3 widmet sich den "Sozialen Netzwerken" im Web 2.0., indem es den Begriff diskutiert, Anforderungen und Kriterien aus unternehmerischer Sicht herausarbeitet und geeignete Plattformen analysiert. Kapitel 4 untersucht die Nutzung von Sozialen Netzwerken als Kommunikations- und Absatzinstrument, indem es die Ziele der Erhebung, die angewandte Methode, die Anforderungen und die Auswertung der Ergebnisse beschreibt. Kapitel 5 erörtert verschiedene Möglichkeiten der Nutzung von Sozialen Netzwerken als Kommunikations- und Absatzkanal, einschließlich Online-Werbung, Unternehmensprofile und Möglichkeiten der Gestaltung. Kapitel 6 widmet sich den Grenzen der Nutzung von Sozialen Netzwerken, darunter der Verlust von Informationshoheit, rechtliche Grenzen und die Etablierung eines Community-Managements. Die Arbeit endet mit einem Fazit, das die wichtigsten Ergebnisse und Schlussfolgerungen zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Soziale Netzwerke, Web 2.0., Energiewirtschaft, Kommunikationsinstrumente, Absatzkanäle, Online-Werbung, Unternehmensprofil, Community-Management, Rechtliche Rahmenbedingungen, Social Media Marketing.
Häufig gestellte Fragen
Können Energieversorger soziale Netzwerke als Absatzkanal nutzen?
Die Arbeit untersucht genau diese Forschungsfrage und beleuchtet die Möglichkeiten und Grenzen von Social Media für die Energiewirtschaft sowohl als Kommunikations- als auch als Absatzinstrument.
Was sind die Hauptvorteile von Social Media für Energieunternehmen?
Möglichkeiten liegen in der Online-Werbung, der Gestaltung von Unternehmensprofilen zur Kontaktpflege und dem direkten Interessensaustausch mit einer breiten Masse an Konsumenten.
Welche Risiken birgt Social Media Marketing für Versorger?
Zu den Grenzen gehören der Verlust der Informationshoheit, rechtliche Hürden und der hohe Aufwand für die Etablierung eines professionellen Community-Managements.
Wie viele Deutsche nutzen soziale Netzwerke?
Laut zitierten Daten von 2011 nutzen etwa 40 Millionen Deutsche soziale Netzwerke, wobei jeder Nutzer im Durchschnitt bei 2,4 Netzwerken angemeldet ist.
Was ist für ein erfolgreiches Community-Management wichtig?
Es müssen klare Strategien entwickelt werden, um auf Nutzerinteraktionen angemessen zu reagieren und die Marke des Energieversorgers positiv zu positionieren.
Details
- Titel
- Kritische Evaluation der Möglichkeiten und Grenzen von Sozialen Netzwerken für einen regionalen Energieversorger
- Hochschule
- Private Fachhochschule Göttingen
- Note
- 1,7
- Autor
- Julia Keller (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 77
- Katalognummer
- V192071
- ISBN (eBook)
- 9783656350415
- ISBN (Buch)
- 9783656350750
- Dateigröße
- 1935 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Social Media Soziale Netzwerke Energieversorgung Facebook Xing
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 36,99
- Arbeit zitieren
- Julia Keller (Autor:in), 2011, Kritische Evaluation der Möglichkeiten und Grenzen von Sozialen Netzwerken für einen regionalen Energieversorger, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/192071
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-