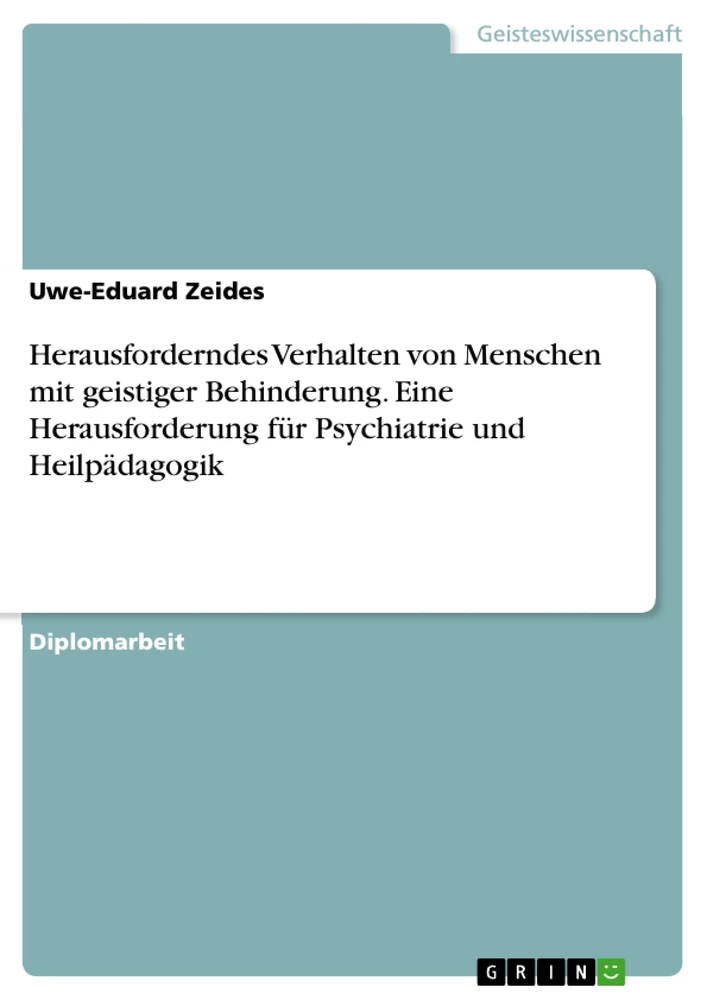
Herausforderndes Verhalten von Menschen mit geistiger Behinderung. Eine Herausforderung für Psychiatrie und Heilpädagogik
Diplomarbeit, 2003
158 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Szenen aus dem Alltag
- 2.1 Warum interessiert mich dieses Thema?
- 2.2 Konkrete Szenerie
- 2.2.1 Bericht über Hr. X (Geb. 1954)
- 2.2.2 Bericht über Hr. Y (Geb. 1981)
- 2.3 Szenen aus der Literatur
- 2.3.1 Hans
- 2.3.2 Henny
- 3 Auffälliges Verhalten, eine Sammelkategorie
- 3.1 Verhaltensstörung
- 3.2 Aggression
- 3.2.1 Fremdaggression
- 3.2.2 Autoaggression
- 3.3 Herausforderndes Verhalten
- 4 Diagnoseschlüssel
- 4.1 ICD-10
- 4.2 DSM-IV
- 5 Ausgewählte Behandlungskonzepte
- 5.1 Soziotherapie
- 5.2 Psychopharmakontherapie
- 5.2.1 Neuroleptika
- 5.2.2 Tranquilizer
- 5.2.3 Antidepressiva
- 5.2.4 Thymoprophylaktika
- 5.2.5 Empfohlene Dosierungsstrategie und Bewertung des Therapieerfolgs
- 5.3 Psychotherapie
- 5.3.1 Klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie
- 5.3.2 Individualpsychologische Psychotherapie
- 5.3.3 Psychoanalytisch orientierte Therapie
- 5.3.4 Verhaltenstherapeutische Ansätze
- 5.3.4.1 Löschung (extinction)
- 5.3.4.2 Ausschlussverfahren (time-out)
- 5.3.4.3 Korrekturverfahren
- 5.3.4.4 Operantes Konditionieren
- 5.3.4.5 Lernen am Modell
- 5.3.5 Körperorientierte Psychotherapiemethoden - Gestaltstherapie
- 5.3.6 Systemische Therapie
- 5.3.6.1 Systemisches Denken
- 5.3.6.2 Zur Bedeutung für die Therapie
- 5.4 Verstehende Diagnostik
- 5.5 Maßnahmen psychiatrischer Pflege und heilpädagogischer Umgang
- 6 Behandlungs- und Betreuungsplanung aus dem psychiatrischen und heilpädagogischen Alltag
- 6.1 Heilpädagogisches Heim Viersen/Süchteln
- 6.1.1 Zur Konzeption
- 6.1.2 Zusammenarbeit zwischen HPH und Psychiatrie aus der Sicht des Abteilungsleiters
- 6.1.3 Das „Konsulententeam“
- 6.1.4 Zusammenfassung HPH Viersen/Süchteln
- 6.2 Wohngruppe in Hephata e.V. Stiftung Mönchengladbach
- 6.2.1 Zur Konzeption
- 6.2.2 Individuelle Betreuungs- und Zukunftsplanung
- 6.2.3 Verhaltensplan der Mitarbeiter
- 6.2.4 Selbstverteidigungskurs
- 6.2.5 Transaktionsanalyse
- 6.2.6 Leitlinien für die Kommunikation
- 6.2.7 Zusammenfassung Wohngruppe Hephata Mönchengladbach
- 6.3 Rheinische Kliniken Mönchengladbach
- 6.3.1 Zur Konzeption
- 6.3.2 Pflegerische Tätigkeit
- 6.3.2.1 Bezugspflege
- 6.3.2.2 Pflegeplanung
- 6.3.3 Therapeutische Tätigkeit
- 6.3.3.1 Ergotherapie (Arbeits- und Beschäftigungstherapie)
- 6.3.3.2 Physikalische Therapie (Bäderabteilung)
- 6.3.4 Ärztliche Tätigkeit
- 6.3.5 Zusammenfassung Rheinische Kliniken Mönchengladbach
- 7 Drei Fallgeschichten und eigene Folgerungen
- 7.1 Hr. X (Geb. 1954)
- 7.1.1 Vorgeschichte
- 7.1.2 Warum ist André in der Klinik?
- 7.1.3 Diagnose
- 7.1.4 Verlauf
- 7.1.5 Welche Rolle hat der Sozialarbeiter gespielt?
- 7.1.6 In der Wohngruppe
- 7.1.7 Autismus?
- 7.1.8 Folgerungen
- 7.2 Hr. Z (Geb. 1976)
- 7.2.1 Vorgeschichte
- 7.2.2 Warum ist Till in der Klinik?
- 7.2.3 Diagnose
- 7.2.4 Verlauf
- 7.2.5 Welche Rolle hat der Sozialarbeiter gespielt?
- 7.2.6 Folgerungen
- 7.3 Hr. Y (Geb. 1981)
- 7.3.1 Vorgeschichte
- 7.3.2 Warum ist Peter in der Klinik?
- 7.3.3 Diagnose
- 7.3.4 Verlauf
- 7.3.5 Welche Rolle hat der Sozialarbeiter gespielt?
- 7.3.6 Folgerungen
- 7.4 Resümee
- 8 Worin besteht die Herausforderung für die Soziale Arbeit bei herausforderndem Verhalten von Menschen mit geistiger Behinderung?
- 8.1 Empowerment
- 8.2 Kriseninterventionen
- 8.2.1 Zum Begriff der Krisenintervention
- 8.2.2 Krisenbegleitung
- 8.2.3 Akutintervention
- 8.3 TEACCH-Programm
- 8.4 Video-Interaktions-Begleitung
- 8.5 Deeskalationsstrategien
- 8.5.1 Sieben Strategien
- 8.5.2 Deeskalationsstrategien unter dem Gesichtspunkt eines Klinikaufenthalts
- 8.5.3 Trainingprogramme in Deeskalationsstrategien für Mitarbeiter in helfenden Berufen
- 9 Fazit
- 10 Literaturverzeichnis
- 11 Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht herausforderndes Verhalten von Menschen mit geistiger Behinderung und die damit verbundenen Herausforderungen für Psychiatrie und Heilpädagogik. Ziel ist es, verschiedene Behandlungsansätze und Betreuungskonzepte zu beleuchten und deren Wirksamkeit zu diskutieren.
- Herausforderndes Verhalten bei Menschen mit geistiger Behinderung
- Diagnostik und Klassifizierung von Verhaltensauffälligkeiten
- Behandlungs- und Betreuungskonzepte in Psychiatrie und Heilpädagogik
- Zusammenarbeit zwischen Psychiatrie und Heilpädagogik
- Rollen der Sozialarbeit in diesem Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema herausforderndes Verhalten bei Menschen mit geistiger Behinderung ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie begründet die Relevanz des Themas und die gewählte Methodik.
2 Szenen aus dem Alltag: Dieses Kapitel präsentiert Fallbeispiele aus dem Alltag, die das Thema veranschaulichen. Es werden konkrete Situationen beschrieben und die damit verbundenen Herausforderungen für die Betroffenen und ihre Bezugspersonen beleuchtet. Die Kapitel 2.1 und 2.2 erläutern die persönliche Motivation der Autorin, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Außerdem werden Berichte über zwei betroffene Personen (Herr X und Herr Y) vorgestellt, um einen Einblick in ihre Lebensrealität und die damit verbundenen Schwierigkeiten zu geben.
3 Auffälliges Verhalten, eine Sammelkategorie: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und Einordnung von auffälligem Verhalten. Es werden verschiedene Kategorien wie Verhaltensstörung, Aggression (Fremd- und Autoaggression) und herausforderndes Verhalten abgegrenzt und differenziert, wobei die Komplexität und die Vielschichtigkeit der Verhaltensweisen herausgestellt werden.
4 Diagnoseschlüssel: In diesem Kapitel werden die gängigen Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-IV im Kontext der Diagnostik von Verhaltensauffälligkeiten bei Menschen mit geistiger Behinderung vorgestellt und kritisch beleuchtet. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Systeme werden herausgestellt und ihre Anwendbarkeit in der Praxis diskutiert.
5 Ausgewählte Behandlungskonzepte: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über verschiedene Behandlungsansätze, die in der Psychiatrie und Heilpädagogik angewendet werden. Es werden sowohl medikamentöse (Psychopharmakontherapie) als auch nicht-medikamentöse Verfahren (Psychotherapie, soziotherapeutische Maßnahmen etc.) detailliert beschrieben, einschliesslich verschiedener Therapieformen wie klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie, verhaltenstherapeutische Ansätze, systemische Therapie und körperorientierte Verfahren. Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Ansätze werden kritisch gewürdigt und die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtungsweise betont.
6 Behandlungs- und Betreuungsplanung aus dem psychiatrischen und heilpädagogischen Alltag: Dieses Kapitel präsentiert Fallbeispiele aus drei verschiedenen Einrichtungen (Heilpädagogisches Heim Viersen/Süchteln, Wohngruppe in Hephata e.V. Stiftung Mönchengladbach, Rheinische Kliniken Mönchengladbach). Es wird die jeweilige Konzeption der Einrichtungen, die Zusammenarbeit zwischen Psychiatrie und Heilpädagogik, sowie die konkreten Maßnahmen der Behandlungs- und Betreuungsplanung beschrieben und analysiert. Hier wird aufgezeigt, wie die in Kapitel 5 vorgestellten Behandlungskonzepte in der Praxis umgesetzt werden.
7 Drei Fallgeschichten und eigene Folgerungen: Drei detaillierte Fallgeschichten veranschaulichen die Komplexität der Thematik und die individuellen Herausforderungen in der Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung und herausforderndem Verhalten. Der Verlauf der Erkrankung, die eingesetzten Maßnahmen und die Rolle der Sozialarbeit werden analysiert, und daraus werden Schlussfolgerungen für die Praxis gezogen.
8 Worin besteht die Herausforderung für die Soziale Arbeit bei herausforderndem Verhalten von Menschen mit geistiger Behinderung?: In diesem Kapitel werden die Herausforderungen für die Soziale Arbeit im Umgang mit herausforderndem Verhalten von Menschen mit geistiger Behinderung ausführlich diskutiert. Es werden Strategien wie Empowerment, Krisenintervention (inkl. Akutintervention und Krisenbegleitung), das TEACCH-Programm, Video-Interaktions-Begleitung und Deeskalationsstrategien im Detail analysiert und kritisch bewertet. Dabei wird auch die Bedeutung von Trainingsprogrammen für Mitarbeiter in helfenden Berufen im Umgang mit Deeskalationsstrategien hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Geistige Behinderung, herausforderndes Verhalten, Aggression, Verhaltensstörung, Diagnostik (ICD-10, DSM-IV), Behandlungskonzepte, Psychopharmakotherapie, Psychotherapie, Soziotherapie, Heilpädagogik, Psychiatrie, Sozialarbeit, Krisenintervention, Deeskalationsstrategien, Empowerment, TEACCH-Programm, Zusammenarbeit, Fallbeispiele.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Herausforderndes Verhalten von Menschen mit geistiger Behinderung
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht herausforderndes Verhalten bei Menschen mit geistiger Behinderung und die damit verbundenen Herausforderungen für Psychiatrie und Heilpädagogik. Sie beleuchtet verschiedene Behandlungsansätze und Betreuungskonzepte und diskutiert deren Wirksamkeit.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, verschiedene Behandlungsansätze und Betreuungskonzepte für Menschen mit geistiger Behinderung und herausforderndem Verhalten zu beleuchten und deren Wirksamkeit zu diskutieren. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Zusammenarbeit zwischen Psychiatrie und Heilpädagogik sowie der Rolle der Sozialarbeit in diesem Kontext.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Herausforderndes Verhalten bei Menschen mit geistiger Behinderung, Diagnostik und Klassifizierung von Verhaltensauffälligkeiten, Behandlungs- und Betreuungskonzepte in Psychiatrie und Heilpädagogik, Zusammenarbeit zwischen Psychiatrie und Heilpädagogik und die Rolle der Sozialarbeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Szenen aus dem Alltag (mit Fallbeispielen von Herrn X und Herrn Y), Auffälliges Verhalten als Sammelkategorie, Diagnoseschlüssel (ICD-10 und DSM-IV), Ausgewählte Behandlungskonzepte (Psychopharmakotherapie, Psychotherapie, Soziotherapie etc.), Behandlungs- und Betreuungsplanung in verschiedenen Einrichtungen (Heilpädagogisches Heim, Wohngruppe, Klinik), Drei Fallgeschichten mit Folgerungen (Herr X, Herr Y, Herr Z), Herausforderungen für die Soziale Arbeit (Empowerment, Krisenintervention, TEACCH-Programm, Deeskalationsstrategien), Fazit, Literaturverzeichnis und Anhang.
Welche Behandlungskonzepte werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt verschiedene medikamentöse und nicht-medikamentöse Behandlungsansätze. Zu den medikamentösen Ansätzen gehört die Psychopharmakotherapie (Neuroleptika, Tranquilizer, Antidepressiva, Thymoprophylaktika). Die nicht-medikamentösen Ansätze umfassen verschiedene Psychotherapieformen (klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie, individualpsychologische Psychotherapie, psychoanalytisch orientierte Therapie, verhaltenstherapeutische Ansätze, körperorientierte Methoden, systemische Therapie) sowie Soziotherapie.
Welche Einrichtungen werden in der Arbeit vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert Fallbeispiele aus drei verschiedenen Einrichtungen: dem Heilpädagogischen Heim Viersen/Süchteln, einer Wohngruppe in Hephata e.V. Stiftung Mönchengladbach und den Rheinischen Kliniken Mönchengladbach. Die jeweilige Konzeption der Einrichtungen, die Zusammenarbeit zwischen Psychiatrie und Heilpädagogik sowie die konkreten Maßnahmen der Behandlungs- und Betreuungsplanung werden analysiert.
Welche Rolle spielt die Sozialarbeit?
Die Arbeit untersucht die wichtige Rolle der Sozialarbeit im Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung und herausforderndem Verhalten. Sie beleuchtet die Herausforderungen der Sozialarbeit und analysiert Strategien wie Empowerment und Krisenintervention.
Welche Strategien für den Umgang mit herausforderndem Verhalten werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Strategien, darunter Empowerment, Krisenintervention (Akutintervention und Krisenbegleitung), das TEACCH-Programm, Video-Interaktions-Begleitung und Deeskalationsstrategien. Die Bedeutung von Trainingsprogrammen für Mitarbeiter in helfenden Berufen wird ebenfalls hervorgehoben.
Welche Klassifikationssysteme werden verwendet?
Die Arbeit verwendet die gängigen Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-IV zur Diagnostik von Verhaltensauffälligkeiten bei Menschen mit geistiger Behinderung. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Systeme werden herausgestellt und ihre Anwendbarkeit in der Praxis diskutiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Geistige Behinderung, herausforderndes Verhalten, Aggression, Verhaltensstörung, Diagnostik (ICD-10, DSM-IV), Behandlungskonzepte, Psychopharmakotherapie, Psychotherapie, Soziotherapie, Heilpädagogik, Psychiatrie, Sozialarbeit, Krisenintervention, Deeskalationsstrategien, Empowerment, TEACCH-Programm, Zusammenarbeit, Fallbeispiele.
Details
- Titel
- Herausforderndes Verhalten von Menschen mit geistiger Behinderung. Eine Herausforderung für Psychiatrie und Heilpädagogik
- Hochschule
- Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach (Fachbereich Sozialwesen Studiengang Sozialarbeit)
- Note
- 1,3
- Autor
- Uwe-Eduard Zeides (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2003
- Seiten
- 158
- Katalognummer
- V192440
- ISBN (eBook)
- 9783656180340
- ISBN (Buch)
- 9783656181972
- Dateigröße
- 1059 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- herausforderndes verhalten menschen behinderung herausforderung psychiatrie heilpädagogik
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 41,99
- Preis (Book)
- US$ 54,99
- Arbeit zitieren
- Uwe-Eduard Zeides (Autor:in), 2003, Herausforderndes Verhalten von Menschen mit geistiger Behinderung. Eine Herausforderung für Psychiatrie und Heilpädagogik, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/192440
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-



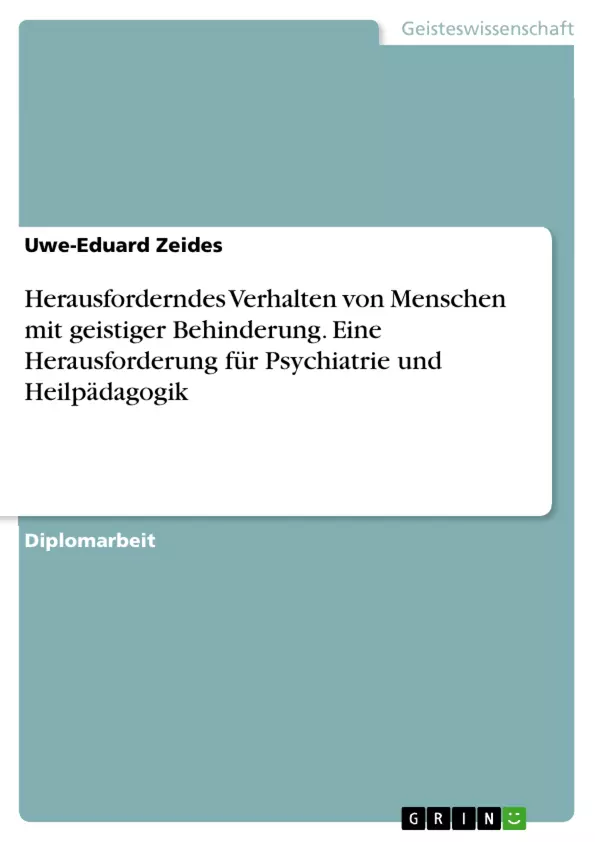






Kommentare