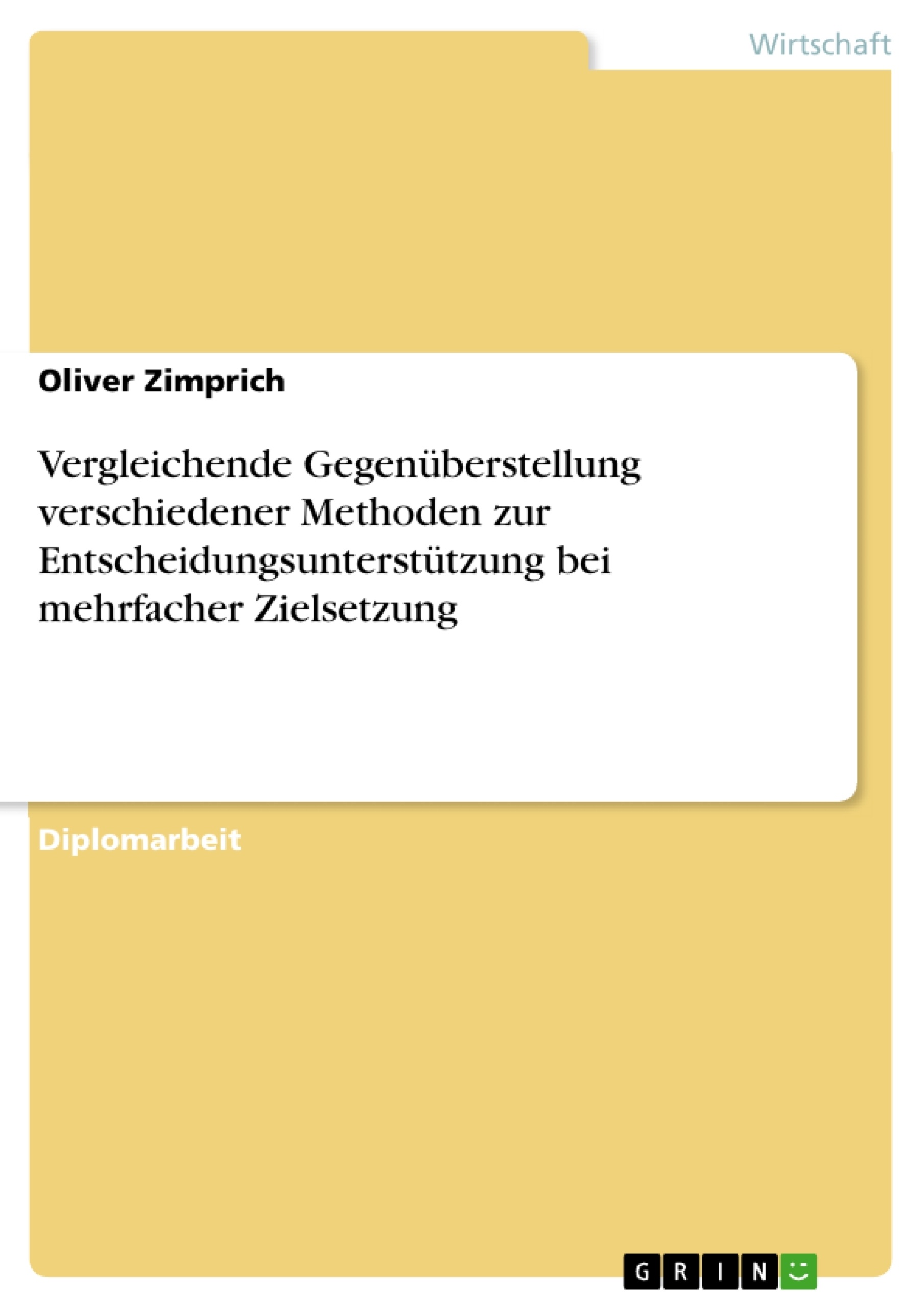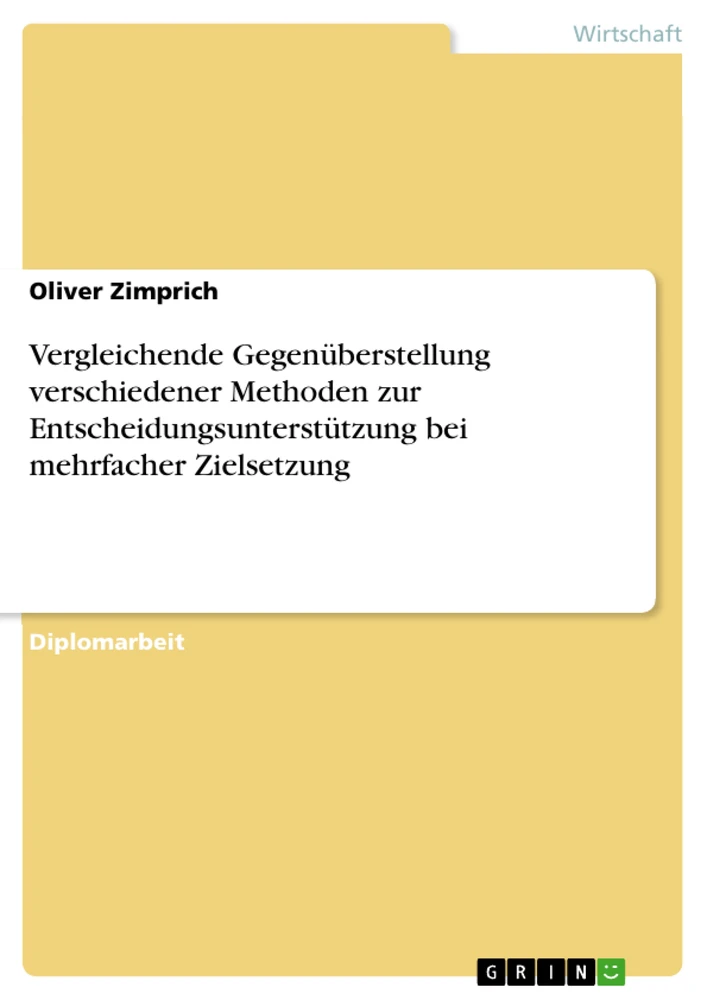
Vergleichende Gegenüberstellung verschiedener Methoden zur Entscheidungsunterstützung bei mehrfacher Zielsetzung
Diplomarbeit, 2012
50 Seiten, Note: 3,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlagen der multikriteriellen Entscheidungstheorien
- 3 Darstellung eines Entscheidungsproblems aus dem Bereich Produktionsmanagement
- 4 Darstellung ausgewählter Methoden und Anwendung auf das Problem der Standortwahl
- 4.1 Nutzwertanalyse
- 4.1.1 Einführung
- 4.1.2 Annahmen
- 4.1.3 Vorgehensweise
- 4.1.4 Anwendung der Nutzwertanalyse auf das Problem der Standortwahl
- 4.1.5 Vor- und Nachteile der Nutzwertanalyse
- 4.2 Analytic Hierarchy Process
- 4.2.1 Einführung
- 4.2.2 Annahmen
- 4.2.3 Vorgehensweise
- 4.2.4 Anwendung des Analytic Hierarchy Process auf das Problem der Standortwahl
- 4.2.5 Vor- und Nachteile des Analytic Hierarchy Process
- 4.3 Conjoint-Analyse
- 4.3.1 Einführung
- 4.3.2 Annahmen
- 4.3.3 Vorgehensweise
- 4.3.4 Anwendung der Conjoint-Analyse auf das Problem der Standortwahl
- 4.3.5 Vor- und Nachteile der Conjoint-Analyse
- 5 Gegenüberstellung der vorgestellten Methoden
- 5.1 Annahmen
- 5.2 Vorgehensweise
- 5.3 Ergebnisse
- 6 Zusammenfassung
- Multikriterielle Entscheidungstheorie
- Standortwahl
- Nutzwertanalyse
- Analytic Hierarchy Process
- Conjoint-Analyse
- Kapitel 1: Einleitung Dieses Kapitel führt in das Thema der Diplomarbeit ein und erläutert die Problemstellung. Es wird die Relevanz der multikriteriellen Entscheidungstheorie für die Praxis dargestellt und der Aufbau der Arbeit skizziert.
- Kapitel 2: Grundlagen der multikriteriellen Entscheidungstheorien In diesem Kapitel werden die Grundlagen der multikriteriellen Entscheidungstheorie behandelt. Es werden die wichtigsten Konzepte und Methoden vorgestellt und die Vor- und Nachteile der verschiedenen Ansätze diskutiert.
- Kapitel 3: Darstellung eines Entscheidungsproblems aus dem Bereich Produktionsmanagement Dieses Kapitel stellt ein konkretes Entscheidungsproblem aus dem Bereich Produktionsmanagement vor. Es wird die Problemstellung und die relevanten Kriterien für die Entscheidungsfindung erläutert.
- Kapitel 4: Darstellung ausgewählter Methoden und Anwendung auf das Problem der Standortwahl Dieses Kapitel behandelt die Anwendung von drei ausgewählten Methoden zur Entscheidungsunterstützung auf das Problem der Standortwahl. Es wird die Nutzwertanalyse, der Analytic Hierarchy Process und die Conjoint-Analyse vorgestellt und deren Vorgehensweise Schritt für Schritt erläutert.
- Kapitel 5: Gegenüberstellung der vorgestellten Methoden In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Anwendung der verschiedenen Methoden auf das Problem der Standortwahl miteinander verglichen. Es werden die Vor- und Nachteile der jeweiligen Methoden aufgezeigt und die Unterschiede in den Ergebnissen diskutiert.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der vergleichenden Gegenüberstellung verschiedener Methoden zur Entscheidungsunterstützung bei mehrfacher Zielsetzung. Ziel der Arbeit ist es, die wichtigsten Methoden der multikriteriellen Entscheidungstheorie vorzustellen, deren Anwendbarkeit auf ein konkretes Entscheidungsproblem zu demonstrieren und die Ergebnisse der verschiedenen Methoden zu vergleichen.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit befasst sich mit den Themen der multikriteriellen Entscheidungstheorie, Entscheidungsfindung, Standortwahl, Nutzwertanalyse, Analytic Hierarchy Process und Conjoint-Analyse. Die Arbeit untersucht die Anwendung dieser Methoden auf ein konkretes Entscheidungsproblem aus dem Bereich Produktionsmanagement und vergleicht die Ergebnisse der verschiedenen Ansätze.
Details
- Titel
- Vergleichende Gegenüberstellung verschiedener Methoden zur Entscheidungsunterstützung bei mehrfacher Zielsetzung
- Hochschule
- FernUniversität Hagen (Lehrstuhl für Betriebswirtschaft, insb. Produktions und Investitionstheorie)
- Note
- 3,3
- Autor
- Dipl.-Ing. Oliver Zimprich (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2012
- Seiten
- 50
- Katalognummer
- V193039
- ISBN (eBook)
- 9783656181545
- ISBN (Buch)
- 9783656182030
- Dateigröße
- 598 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Multikriterielle Entscheidungen Standortwahl Nutzwertanalyse NWA Analytic Hierarchy Process AHP Conjoint-Analyse CA
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Dipl.-Ing. Oliver Zimprich (Autor:in), 2012, Vergleichende Gegenüberstellung verschiedener Methoden zur Entscheidungsunterstützung bei mehrfacher Zielsetzung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/193039
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-