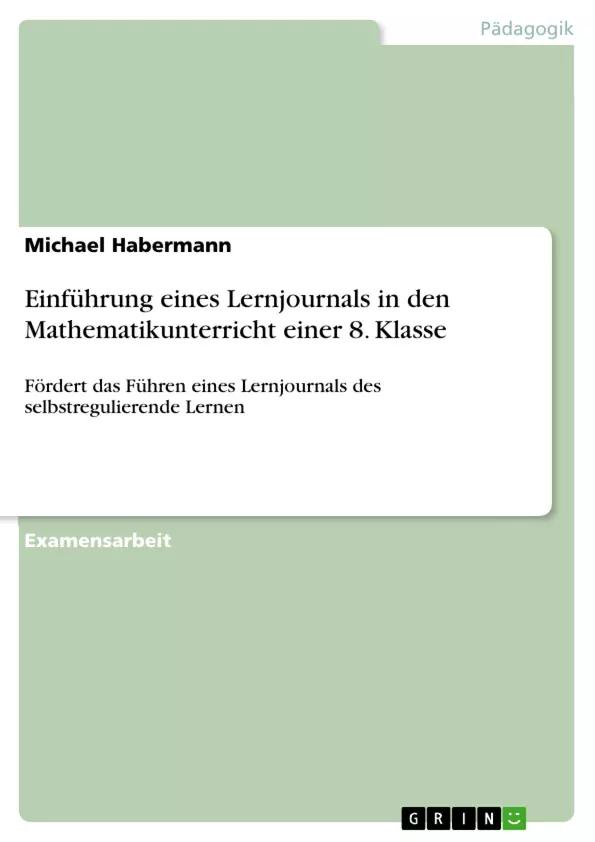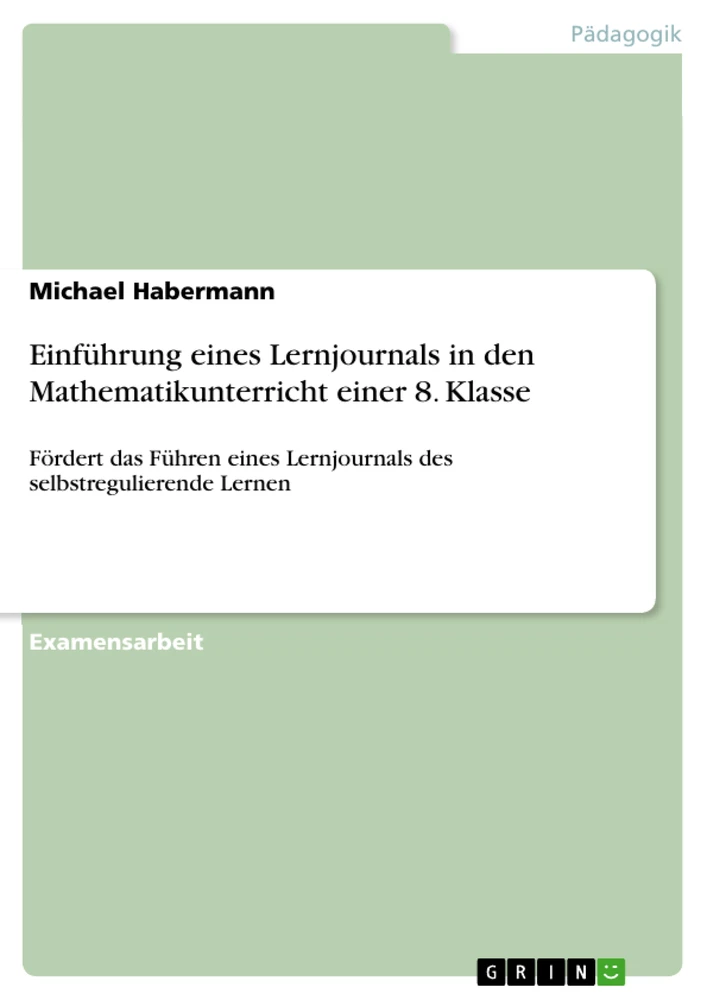
Einführung eines Lernjournals in den Mathematikunterricht einer 8. Klasse
Examensarbeit, 2011
41 Seiten, Note: 1
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung.
- 2 Theoretische Betrachtung des Mathejournals.........
- 2.1 Kategorisierung von Lerntagebüchern nach Anzahl der Personen...
- 2.2 Verschieden Formen von Lerntagebüchern.
- 2.2.1 Reisetagebuch nach Gallin/Ruf..
- 2.2.2 Das teambezogene Logbuch
- 2.2.3 Mathejournal....
- 2.3 Einführung in den Umgang mit Lerntagebüchern......
- 3 Was heißt selbstreguliertes Lernen?
- 4 Beschreibung der Lerngruppe.........
- 5 Die Einführung des Mathejournals......
- 5.1 Didaktische Überlegungen
- 5.2 Beschreibung der Durchführung einzelner Sequenzen und die methodischen Entscheidungen
- 6 Reflexion ausgewählter Unterrichtssequenzen.
- 6.1 Analyse der ersten Woche der Reflexionsrunden.
- 6.2 Analyse der Einführungswoche des Mathejournals.......
- 7 Darstellung und Auswertung der Evaluationsbögen.
- 8 Fazit und Ausblick auf die Weiterarbeit
- 9 Literaturverzeichnis.........
- 10 Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Einsatz von Lerntagebüchern, speziell im Fach Mathematik, im Hinblick auf die Förderung des selbstregulierten Lernens von Schülerinnen und Schülern. Die Arbeit verfolgt das Ziel, einen Einblick in die Praxis des Einsatzes von Mathejournalen zu geben und dessen Einfluss auf das selbstständige Lernen zu analysieren.
- Die Bedeutung des selbstregulierten Lernens im Kontext moderner Bildungsstandards
- Die verschiedenen Formen und Einsatzmöglichkeiten von Lerntagebüchern
- Die didaktischen Überlegungen und methodischen Entscheidungen bei der Einführung eines Mathejournals
- Die Analyse des Einflusses des Mathejournals auf die Lernentwicklung der Schülerinnen und Schüler
- Die Bewertung der Ergebnisse und ein Ausblick auf weitere Möglichkeiten der Implementierung des Mathejournals
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Diese Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und definiert das Problemfeld des selbstregulierten Lernens in der Schule. Sie befasst sich mit den aktuellen Bildungsanforderungen und den Herausforderungen, die mit der Förderung des eigenständigen Lernens verbunden sind.
- Kapitel 2: Theoretische Betrachtung des Mathejournals: Dieses Kapitel geht auf den Begriff des Lerntagebuchs ein und erläutert verschiedene Formen und Einsatzmöglichkeiten von Lerntagebüchern, darunter das Reisetagebuch nach Gallin/Ruf, das teambezogene Logbuch und das Mathejournal. Der Fokus liegt auf den verschiedenen Konzepten und deren didaktischen Potenzial für die Förderung des selbstgesteuerten Lernens.
- Kapitel 3: Was heißt selbstreguliertes Lernen?: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Begriff des selbstregulierten Lernens und seiner Bedeutung im Kontext von Bildungsstandards. Es wird untersucht, welche Kompetenzen für ein selbstständiges Lernen notwendig sind und welche Mechanismen zur Entwicklung von Lernstrategien beitragen.
- Kapitel 4: Beschreibung der Lerngruppe: Dieses Kapitel beschreibt die Lerngruppe, in der das Mathejournal eingeführt wurde. Es werden relevante Merkmale der Lerngruppe, wie Alter, Leistungsstand und Vorkenntnisse, erläutert.
- Kapitel 5: Die Einführung des Mathejournals: Dieses Kapitel beschreibt die konkrete Einführung des Mathejournals im Mathematikunterricht. Es werden die didaktischen Überlegungen, die methodischen Entscheidungen und die Umsetzung des Mathejournals in der Praxis erläutert.
- Kapitel 6: Reflexion ausgewählter Unterrichtssequenzen: In diesem Kapitel werden ausgewählte Unterrichtssequenzen im Zusammenhang mit dem Mathejournal reflektiert. Die Analyse der ersten Woche der Reflexionsrunden und die Analyse der Einführungswoche des Mathejournals geben einen Einblick in die praktische Umsetzung und die Wirkung des Mathejournals.
Schlüsselwörter
Schlüsselbegriffe dieser Arbeit sind: selbstreguliertes Lernen, Mathejournal, Lerntagebuch, Lernstrategien, Bildungsstandards, Didaktik, Evaluation, Reflexion, Unterricht, Mathematik, Kompetenzentwicklung. Diese Begriffe stehen im Zentrum der Arbeit und verdeutlichen den Fokus auf die Förderung des selbstständigen Lernens durch den Einsatz eines Mathejournals im Mathematikunterricht.
Details
- Titel
- Einführung eines Lernjournals in den Mathematikunterricht einer 8. Klasse
- Untertitel
- Fördert das Führen eines Lernjournals des selbstregulierende Lernen
- Note
- 1
- Autor
- Michael Habermann (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 41
- Katalognummer
- V193051
- ISBN (eBook)
- 9783656182177
- ISBN (Buch)
- 9783656182603
- Dateigröße
- 1260 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Mathejournal Mathematik Lerntagebuch Lernjournal Logbuch selbstreguliertes Lernen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Michael Habermann (Autor:in), 2011, Einführung eines Lernjournals in den Mathematikunterricht einer 8. Klasse, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/193051
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-