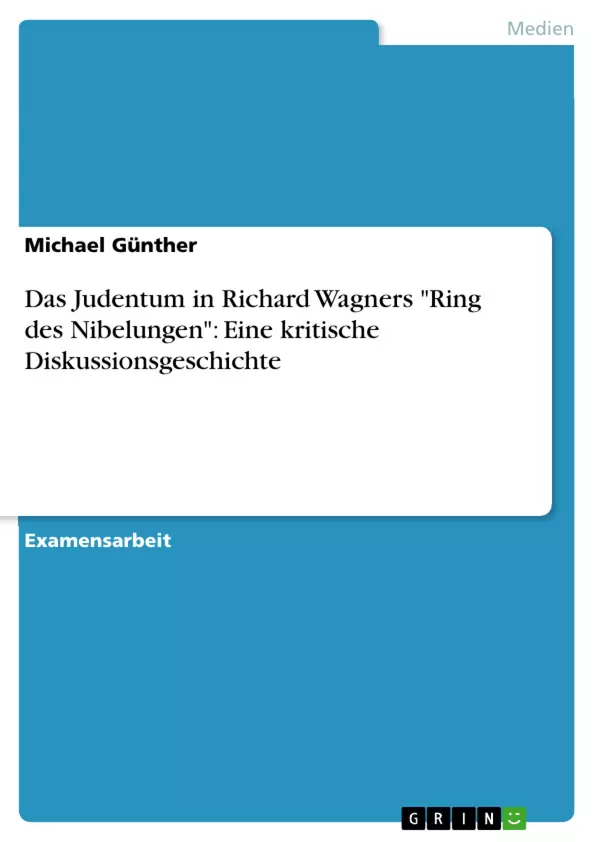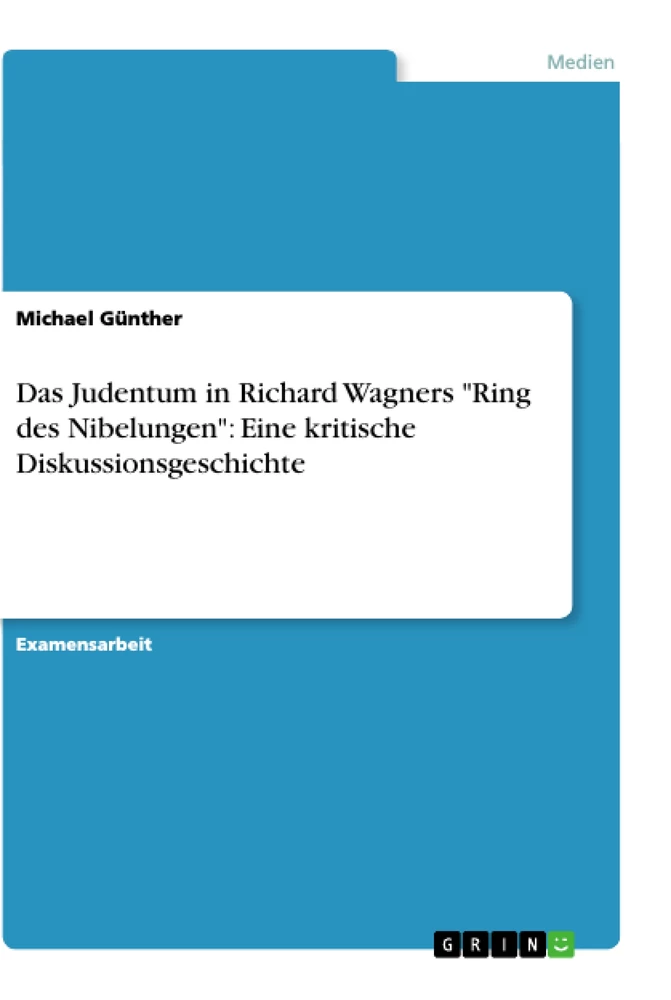
Das Judentum in Richard Wagners "Ring des Nibelungen": Eine kritische Diskussionsgeschichte
Examensarbeit, 2011
84 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begründung des Themas
- Fragestellung und Methode
- Leitlinien und Probleme der Forschung
- Der Antisemitismus Richard Wagners um 1850
- Ursachen für Wagners Antisemitismus
- Die zwei Väter
- Der dritte Vater - Meyerbeer
- Richard Wagners Das Judentum in der Musik
- Äußere Erscheinung
- Sprache
- Musik
- Geld
- Mendelssohn und Meyerbeer
- Das Judentum und die Nibelungen
- Ausgewählte Ring-Deutungen bis 1945
- Romantik und Germanentum
- Gustav Mahler
- George Bernard Shaw
- Alfred Einstein
- Theodor W. Adorno
- Dichter und Denker
- Anmerkung zum Ring des Nibelungen in der NS-Zeit
- Die Diskussion zwischen Verdrängung und Schuld
- Hier gilt's der Kunst – Die 50er Jahre
- Der Kampf Zelinskys – Wie politisch darf ein Künstler sein
- Die Wagnerkritik der 90er Jahre
- Der Börsenjude Alberich
- Über musikalische Codes
- Der Zwergen Gang - des Teufels Fuß
- Die Sprache von Mime und Alberich
- Hagen der degenerierte Jude
- Über musikalische Stereotypen
- Die aktuelle Diskussion
- Das Symposion Richard Wagner und die Juden
- Die Tagung Richard Wagner im Dritten Reich
- Opernsplitter
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Antisemitismus Richard Wagners und dessen Reflexion in der Rezeption seines Werks, insbesondere des „Ring des Nibelungen“. Ziel ist es, die Debatte um den antisemitischen Gehalt in Wagners Musikdramen zu beleuchten und die verschiedenen Interpretationsansätze zu analysieren. Die Arbeit betrachtet sowohl Wagners explizite antisemitische Schriften als auch die Frage nach impliziten antisemitischen Tendenzen in seinen Opern.
- Wagners expliziter Antisemitismus und seine Ursachen
- Die Rezeption von Wagners Antisemitismus in der Forschung
- Die Interpretation antisemitischer Codes in Wagners Musikdramen
- Die Rolle von Wagners Werk im Kontext des Nationalsozialismus
- Die aktuelle wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein, indem sie den Brief Joseph Rubinsteins an Richard Wagner als Ausgangspunkt nimmt und die Problematik der Relativierung von Wagners Antisemitismus beleuchtet. Sie stellt Wagners Schrift "Das Judentum in der Musik" als zentralen Text der Debatte vor und betont die kontroverse Rezeption dieses Pamphlets, sowohl in der musikwissenschaftlichen Forschung als auch in anderen Disziplinen. Die Einleitung unterstreicht die Bedeutung der Auseinandersetzung mit dem Thema im Kontext der Wagner-Hitler-Debatte und der anhaltenden Relevanz Wagners im kulturellen und politischen Leben Deutschlands.
Der Antisemitismus Richard Wagners um 1850: Dieses Kapitel analysiert die Ursachen von Wagners Antisemitismus, indem es seine Familiengeschichte und seine Beziehung zu Komponisten wie Meyerbeer untersucht. Es beleuchtet Wagners Schrift "Das Judentum in der Musik" detailliert, indem es die einzelnen Punkte seiner Argumentation gegen das Judentum (Äußeres, Sprache, Musik, Geld) untersucht und die Stereotypen analysiert, die Wagner verwendet. Der Bezug zu den Nibelungen und die Verbindung von jüdischen Stereotypen mit den Figuren der Oper werden ebenfalls erörtert.
Ausgewählte Ring-Deutungen bis 1945: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Interpretationen des "Ring des Nibelungen" bis 1945, von der romantischen bis zur kritischen Perspektive. Es beleuchtet die Interpretationen von Mahler, Shaw, Einstein, Adorno und anderen Denkern und zeigt die unterschiedlichen Sichtweisen auf den möglichen antisemitischen Gehalt der Oper auf. Der Abschnitt über die NS-Zeit hebt die instrumentalisierte Nutzung des Werks durch die Nationalsozialisten hervor.
Die Diskussion zwischen Verdrängung und Schuld: Dieses Kapitel behandelt die Debatte um Wagners Antisemitismus in der Nachkriegszeit. Es analysiert die verschiedenen Positionen und die Entwicklung der Diskussion, insbesondere die Rolle von Hartmut Zelinsky und seine kritische Auseinandersetzung mit der Beziehung zwischen Wagner, Bayreuth und dem Nationalsozialismus. Die Auseinandersetzung mit der Frage, wie politisch ein Künstler sein darf, wird ebenfalls thematisiert.
Die Wagnerkritik der 90er Jahre: Dieser Abschnitt fokussiert auf die Wagner-Kritik der 1990er Jahre und untersucht die Interpretationen antisemitischer Codes in den Opern. Es wird auf die Charaktere Alberich, Mime und Hagen eingegangen und deren mögliche symbolische Bedeutung im Kontext antisemitischer Stereotypen analysiert. Die Rolle der Musik selbst als Träger antisemitischer Botschaften wird ebenfalls diskutiert.
Die aktuelle Diskussion: Das Kapitel fasst die aktuelle Debatte um Wagners Antisemitismus zusammen und beleuchtet Symposien und Tagungen zu diesem Thema. Es bietet einen Überblick über die anhaltenden Diskussionen und die verschiedenen Ansätze zur Interpretation des Verhältnisses zwischen Wagners Leben, Werk und Antisemitismus.
Schlüsselwörter
Richard Wagner, Antisemitismus, Das Judentum in der Musik, „Ring des Nibelungen“, Wagner-Hitler-Debatte, Musikinterpretation, Judenkarikatur, Stereotypen, Rezeptionsgeschichte, Bayreuth, Oper, Musikdrama, politische Ideologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des Antisemitismus bei Richard Wagner und seiner Rezeption
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Antisemitismus Richard Wagners und dessen Reflexion in der Rezeption seines Werks, insbesondere des "Ring des Nibelungen". Sie beleuchtet die Debatte um den antisemitischen Gehalt in Wagners Musikdramen und analysiert verschiedene Interpretationsansätze. Dabei werden sowohl Wagners explizite antisemitische Schriften als auch implizite antisemitische Tendenzen in seinen Opern betrachtet.
Welche Aspekte von Wagners Antisemitismus werden behandelt?
Die Arbeit analysiert Wagners expliziten Antisemitismus und dessen Ursachen, unter anderem anhand seiner Familiengeschichte und seiner Beziehung zu Komponisten wie Meyerbeer. Sie untersucht detailliert Wagners Schrift "Das Judentum in der Musik" und analysiert die darin verwendeten Stereotype. Der Bezug zu den Nibelungen und die Verbindung von jüdischen Stereotypen mit den Figuren der Oper werden ebenfalls erörtert.
Wie wird die Rezeption von Wagners Antisemitismus dargestellt?
Die Arbeit präsentiert verschiedene Interpretationen des "Ring des Nibelungen" von der Romantik bis zur kritischen Perspektive, inklusive Interpretationen von Mahler, Shaw, Einstein und Adorno. Sie zeigt die unterschiedlichen Sichtweisen auf den möglichen antisemitischen Gehalt der Oper und hebt die instrumentalisierte Nutzung des Werks durch die Nationalsozialisten hervor. Die Nachkriegsdebatte, die Rolle von Hartmut Zelinsky und die Frage nach der politischen Verantwortung von Künstlern werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Rolle spielt die Musik selbst in der Analyse des Antisemitismus?
Die Arbeit untersucht die Interpretation antisemitischer Codes in Wagners Musikdramen. Sie analysiert die Charaktere Alberich, Mime und Hagen und deren mögliche symbolische Bedeutung im Kontext antisemitischer Stereotypen. Die Rolle der Musik als Träger antisemitischer Botschaften wird ebenfalls diskutiert, inklusive der Analyse musikalischer Stereotypen und Codes.
Wie wird die aktuelle Debatte um Wagners Antisemitismus dargestellt?
Die Arbeit fasst die aktuelle Debatte zusammen, beleuchtet Symposien und Tagungen zu diesem Thema und bietet einen Überblick über die anhaltenden Diskussionen und die verschiedenen Ansätze zur Interpretation des Verhältnisses zwischen Wagners Leben, Werk und Antisemitismus. Sie berücksichtigt die anhaltende Relevanz des Themas im kulturellen und politischen Leben Deutschlands.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Richard Wagner, Antisemitismus, Das Judentum in der Musik, „Ring des Nibelungen“, Wagner-Hitler-Debatte, Musikinterpretation, Judenkarikatur, Stereotype, Rezeptionsgeschichte, Bayreuth, Oper, Musikdrama, politische Ideologie.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit ist gegliedert in: Einleitung, Der Antisemitismus Richard Wagners um 1850, Ausgewählte Ring-Deutungen bis 1945, Die Diskussion zwischen Verdrängung und Schuld, Die Wagnerkritik der 90er Jahre, Die aktuelle Diskussion und Fazit. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der jeweiligen Themenbereiche.
Wo findet man den Brief Joseph Rubinsteins an Richard Wagner und seine Bedeutung?
Der Brief Joseph Rubinsteins an Richard Wagner wird in der Einleitung als Ausgangspunkt der Problematik der Relativierung von Wagners Antisemitismus genannt und dient als einleitendes Beispiel für die Komplexität des Themas.
Details
- Titel
- Das Judentum in Richard Wagners "Ring des Nibelungen": Eine kritische Diskussionsgeschichte
- Hochschule
- Universität Potsdam (Institut für Musik und Musikpädagogik)
- Note
- 1,0
- Autor
- Michael Günther (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 84
- Katalognummer
- V193213
- ISBN (eBook)
- 9783656182870
- ISBN (Buch)
- 9783656183525
- Dateigröße
- 898 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Ring des Nibelungen Antisemitismus Judentum Richard Wagner Alberich Mime
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Michael Günther (Autor:in), 2011, Das Judentum in Richard Wagners "Ring des Nibelungen": Eine kritische Diskussionsgeschichte, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/193213
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-