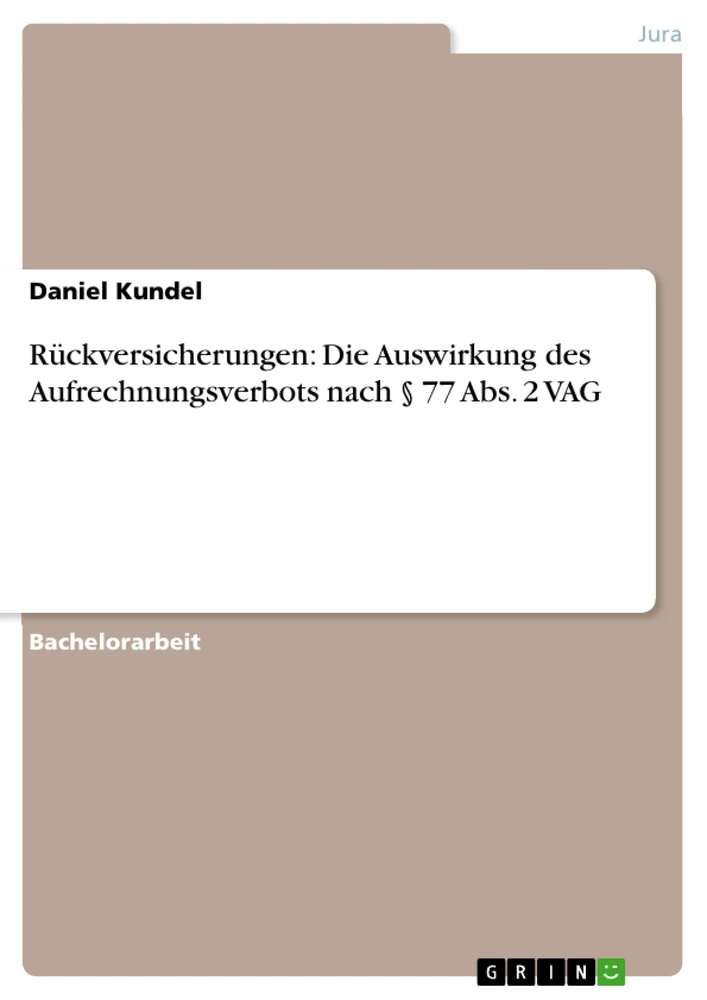
Rückversicherungen: Die Auswirkung des Aufrechnungsverbots nach § 77 Abs. 2 VAG
Bachelorarbeit, 2011
51 Seiten, Note: 1,8
Jura - Zivilrecht / Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Kartellrecht, Wirtschaftsrecht
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Aufbau und Zielsetzung
- Rückversicherung
- Begriff der Rückversicherung
- Wesen der Rückversicherung
- Formen und Arten von Rückversicherungen
- Formen der Rückversicherung
- Fakultative Rückversicherung
- Obligatorische Rückversicherung
- Arten der Rückversicherung
- Proportionale Rückversicherung
- Nichtproportionale Rückversicherung
- Rückversicherungsrecht
- Versicherungsvertragsgesetz
- Rechtsprechung
- Rückversicherungsvertrag
- Beginn von Rückversicherungsverträgen
- Beendigung von Rückversicherungsverträgen
- Rückversicherungsbrauch
- Aufrechnung
- Aufrechnung nach BGB
- Gegenseitigkeit der Forderungen
- Gleichartigkeit der Forderungen
- Durchsetzbarkeit der Gegenforderung
- Wirksamkeit und Erfüllbarkeit der Hauptforderung
- Aufrechnungserklärung
- Wirkung der Aufrechnung
- Ausschluss der Aufrechnung
- Aufrechnung in der Insolvenz
- Zulässige Aufrechnung
- Unzulässige Aufrechnung
- Geltungsbereich
- Insolvenzgläubiger
- Massegläubiger
- Insolvenzverwalter
- Eröffnungsverfahren
- Abrechnungsweise in der Rückversicherung
- Abrechnungsklausel
- Abrechnung im Kontokorrent
- Kontokorrent nach HGB
- Funktion
- Vereinfachung des Zahlungsverkehrs
- Sicherungsfunktion
- Voraussetzungen des Kontokorrent
- Parteien
- Geschäftsverbindung
- Kontokorrentabrede
- Periodizität
- Wirkung des Kontokorrents
- Wirkung der Einstellung ins Kontokorrent
- Wirkung der Verrechnung und Feststellung
- Wirkung der Anerkennung des Saldos
- Beendigung des Kontokorrents
- Sicherungsvermögen
- Mindestumfang des Sicherungsvermögens
- Zugehörigkeit zum Sicherungsvermögen
- Anteile der Rückversicherer
- Sicherungsvermögen bei Rückversicherung
- Depots
- Verwaltung
- Vermögensverzeichnis
- Regelungsgehalt des § 77 VAG
- § 77 Abs. 1 VAG
- § 77 Abs. 2 VAG
- Anspruch
- Gegenstand der Vollstreckung
- Höhe der Vollstreckung
- Neuregelung des Gesetzgebers
- Begründung des Deutschen Bundestages
- Stellungnahme des Bundesrates
- Gegenäußerung der Bundesregierung
- Urteile zum Aufrechnungsverbot
- Urteil des Landgerichts Köln
- Sachverhalt
- Tenor
- Entscheidungsgründe
- Urteil des Oberlandesgerichts Köln
- Sachverhalt
- Tenor
- Leitsatz
- Entscheidungsgründe
- Auswirkung auf die Rückversicherung
- Allgemeine Auswirkung
- Auswirkungen bei Insolvenz des Erstversicherers
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelor-Thesis befasst sich mit dem Aufrechnungsverbot nach § 77 Abs. 2 VAG und seinen Auswirkungen auf die Rückversicherung. Ziel ist es, die rechtliche Grundlage des Aufrechnungsverbots zu analysieren und dessen praktische Bedeutung im Kontext der Rückversicherung zu erforschen. Dabei werden insbesondere die rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen des Verbots für die beteiligten Akteure beleuchtet.
- Rechtliche Grundlage des Aufrechnungsverbots nach § 77 VAG
- Auswirkungen des Aufrechnungsverbots auf die Rückversicherung
- Insolvenzrechtliche Aspekte des Aufrechnungsverbots
- Wirtschaftliche Folgen des Aufrechnungsverbots für die Beteiligten
- Aktuelle Rechtsprechung und Gesetzgebung zum Aufrechnungsverbot
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Arbeit stellt die Problemstellung und Zielsetzung der Bachelor-Thesis dar. Sie definiert den Gegenstand der Untersuchung und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Kapitel 2 behandelt das Thema Rückversicherung. Es erklärt den Begriff und das Wesen der Rückversicherung, bevor es verschiedene Formen und Arten von Rückversicherungen erläutert. Im Anschluss wird das Rückversicherungsrecht unter Bezugnahme auf das Versicherungsvertragsgesetz, Rechtsprechung und den Rückversicherungsvertrag beleuchtet.
Kapitel 3 befasst sich mit dem Begriff der Aufrechnung. Es erläutert die Voraussetzungen der Aufrechnung nach BGB, analysiert die rechtliche Grundlage der Aufrechnung in der Insolvenz und beleuchtet die Auswirkungen der Aufrechnung auf das Sicherungsvermögen.
Kapitel 4 beleuchtet die Abrechnungsweise in der Rückversicherung. Es geht auf die Abrechnungsklausel, die Abrechnung im Kontokorrent und die rechtlichen Rahmenbedingungen des Kontokorrents nach HGB ein. Die Kapitel fokussieren dabei auf die Bedeutung des Kontokorrents für die Rückversicherung und die damit verbundenen rechtlichen und praktischen Implikationen.
Kapitel 5 widmet sich dem Sicherungsvermögen im Kontext der Rückversicherung. Es untersucht den Mindestumfang des Sicherungsvermögens, erläutert die Zugehörigkeit zum Sicherungsvermögen und analysiert die Anteile der Rückversicherer an diesem. Dabei wird auch die Verwaltung und das Vermögensverzeichnis behandelt.
Kapitel 6 untersucht den Regelungsgehalt des § 77 VAG. Es analysiert die rechtliche Grundlage des Aufrechnungsverbots nach § 77 Abs. 1 VAG und beleuchtet die verschiedenen Aspekte des § 77 Abs. 2 VAG, wie den Anspruch, den Gegenstand der Vollstreckung und die Höhe der Vollstreckung.
Kapitel 7 befasst sich mit der Neuregelung des Gesetzgebers hinsichtlich des Aufrechnungsverbots. Es analysiert die Begründung des Deutschen Bundestages, die Stellungnahme des Bundesrates und die Gegenäußerung der Bundesregierung zu dieser Thematik.
Kapitel 8 präsentiert wichtige Urteile zum Aufrechnungsverbot, insbesondere das Urteil des Landgerichts Köln und das Urteil des Oberlandesgerichts Köln. Es analysiert die Sachverhalte, Tenore, Leitsätze und Entscheidungsgründe dieser Urteile und legt die Relevanz dieser Entscheidungen für das Aufrechnungsverbot dar.
Kapitel 9 untersucht die Auswirkungen des Aufrechnungsverbots auf die Rückversicherung. Es analysiert die allgemeinen Auswirkungen und die Folgen für den Fall einer Insolvenz des Erstversicherers. Die Kapitel zeigen die Bedeutung des Aufrechnungsverbots für die Rückversicherung und die damit verbundenen Herausforderungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Aufrechnungsverbot nach § 77 Abs. 2 VAG, der Rückversicherung, dem Sicherungsvermögen, der Insolvenz und den rechtlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Verbots für die beteiligten Akteure. Die Arbeit basiert auf einer Analyse des Versicherungsvertragsgesetzes, der Rechtsprechung und relevanten Fachliteratur.
Details
- Titel
- Rückversicherungen: Die Auswirkung des Aufrechnungsverbots nach § 77 Abs. 2 VAG
- Hochschule
- Rheinische Fachhochschule Köln
- Note
- 1,8
- Autor
- Daniel Kundel (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 51
- Katalognummer
- V193265
- ISBN (eBook)
- 9783656182788
- ISBN (Buch)
- 9783656183211
- Dateigröße
- 630 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Rückversicherung Aufrechnung Aufrechnungsverbot Versicherungsaufsichtsgesetz VAG Sicherungsvermögen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Daniel Kundel (Autor:in), 2011, Rückversicherungen: Die Auswirkung des Aufrechnungsverbots nach § 77 Abs. 2 VAG, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/193265
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









