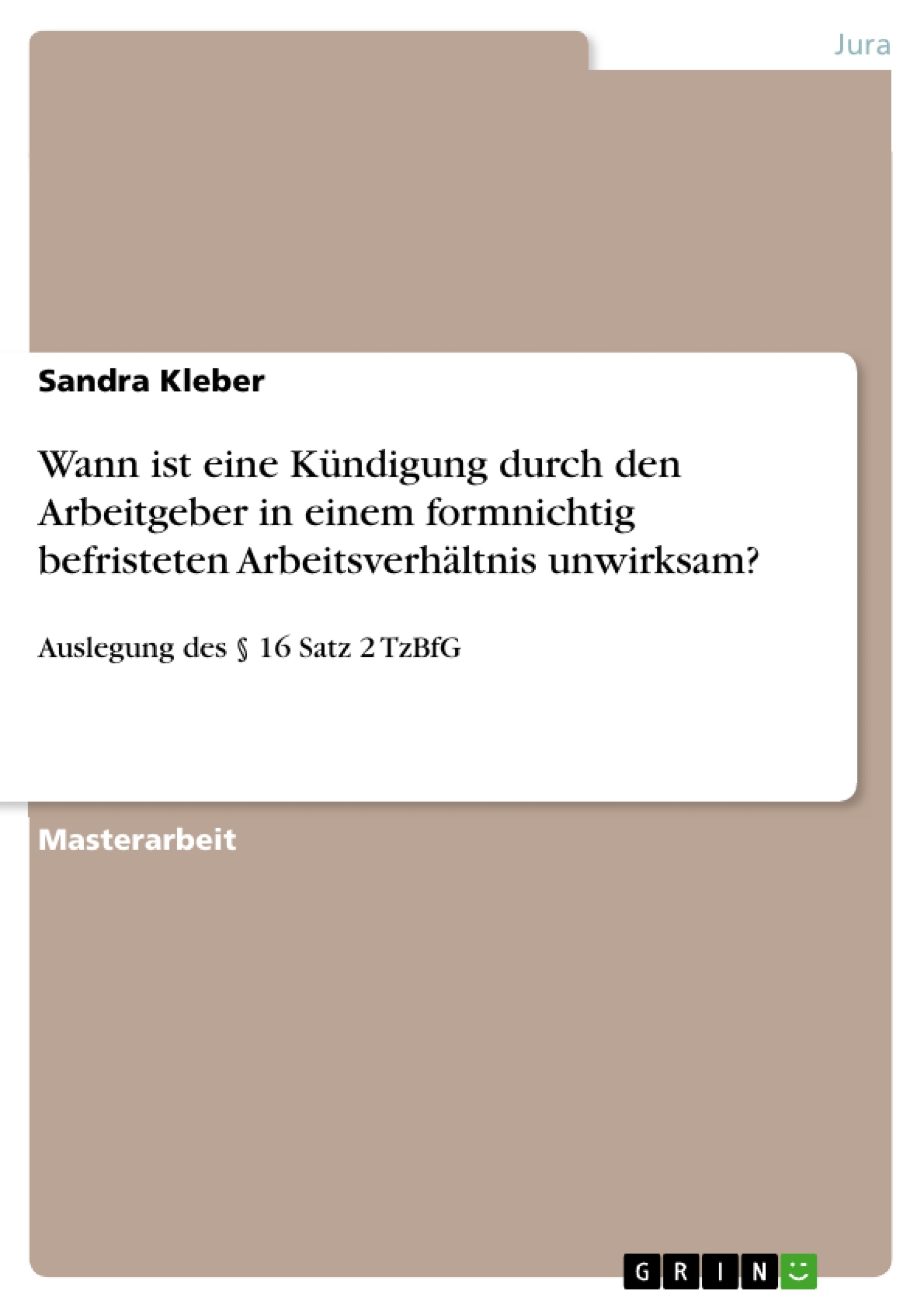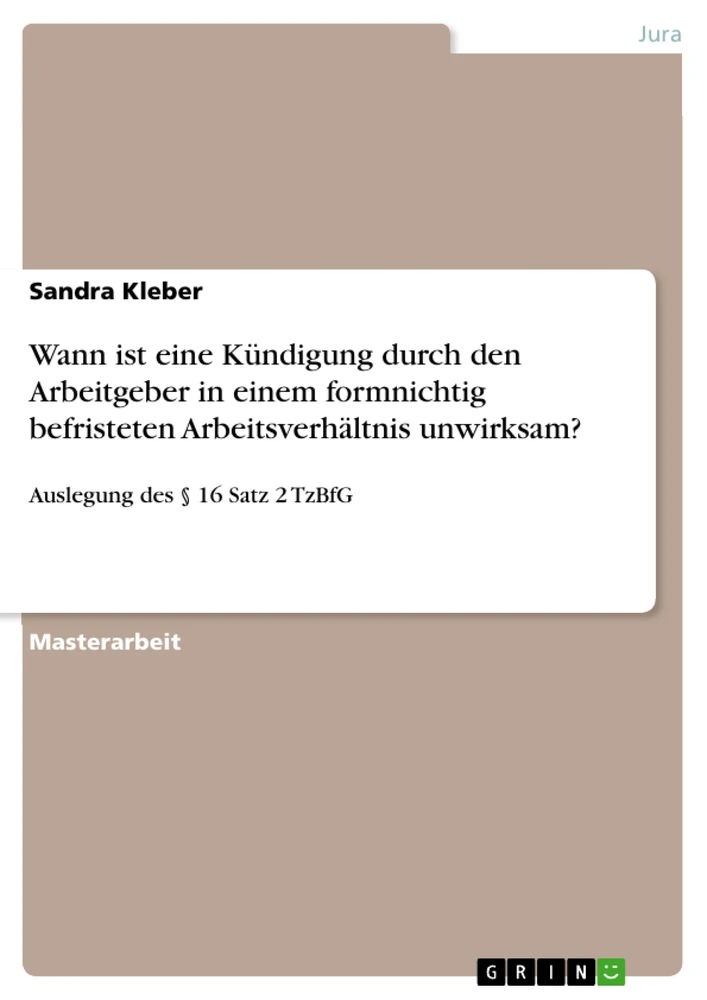
Wann ist eine Kündigung durch den Arbeitgeber in einem formnichtig befristeten Arbeitsverhältnis unwirksam?
Masterarbeit, 2011
37 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in die Problemstellung
- Zielsetzung der Arbeit
- Gang der Untersuchung
- Ausgangssituation
- Gemeinschaftsrechtliche Rahmenbedingungen des Teilzeitbefristungsgesetzes.
- Befristung von Arbeitsverträgen nach § 14 TzBfG und deren Beendigung nach § 15 TzBfG
- Folgen unwirksamer Befristung gemäß § 16 TzBfG.
- Außerordentliche Kündigung.
- Kündigung durch den Arbeitgeber zum vereinbarten Ende des befristeten Vertrages
- Kündigung durch den Arbeitgeber während der Laufzeit des befristeten Vertrages
- Ordentliche Kündigung nach § 16 Satz 2 TzBfG
- Regelungsbereich des § 16 Satz 2 TzBfG
- Einschränkungen des § 16 Satz 2 TzBfG
- Einschränkung durch den Grundsatz von Treu und Glauben
- Vertrauen in den Bestand des Arbeitsverhältnisses?
- Schutzzweck des § 14 Abs. 4 TzBfG i. V. m. § 16 Satz 2 TzBfG
- Kein widersprüchliches Verhalten
- Ergebnis
- Einschränkung durch eine (abweichende) vertragliche Regelung
- Abweichungsverbot zugunsten des Arbeitnehmers gemäß § 22 TzBfG
- Gesetzliche Ausnahme durch § 15 Abs. 3 TzBfG i. V. m. § 16 Satz 1 TzBfG
- Expliziter Ausschluss des § 16 Satz 2 TzBfG zugunsten des Arbeitnehmers
- Besteht das Kündigungsrecht gemäß § 16 Satz 2 TzBfG neben einer Vereinbarung nach § 15 Abs.3 TzBfG?
- Folgen einer vertraglich vereinbarten Kündigungsmöglichkeit
- Eine Ansicht: Ausschluss des § 16 Satz 2 TzBfG durch vertragliches Kündigungsrecht
- Modifizierte Ansicht: Beschränkung des § 16 Satz 2 TzBfG
- Abweichende Ansicht: Aufhebung der vertraglichen Vereinbarung durch § 16 Satz 2 TzBfG
- Erweiternde Ansicht: Zusätzliche Kündigungsmöglichkeit
- Streitentscheidung
- Ergebnis
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Literaturverzeichnis
- Rechtliche Rahmenbedingungen des Teilzeitbefristungsgesetzes
- Befristung von Arbeitsverträgen und deren Beendigung
- Folgen unwirksamer Befristung gemäß § 16 TzBfG
- Auslegung des § 16 Satz 2 TzBfG
- Einschränkungen des § 16 Satz 2 TzBfG durch den Grundsatz von Treu und Glauben und vertragliche Regelungen
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problemstellung der Arbeit vor, erläutert die Zielsetzung und beschreibt den Gang der Untersuchung.
- Ausgangssituation: Dieses Kapitel skizziert die rechtlichen Rahmenbedingungen des Teilzeitbefristungsgesetzes, insbesondere die Befristung von Arbeitsverträgen und deren Beendigung. Es werden auch die Folgen einer unwirksamen Befristung gemäß § 16 TzBfG beleuchtet.
- Ordentliche Kündigung nach § 16 Satz 2 TzBfG: Dieses Kapitel analysiert den Regelungsbereich und die Einschränkungen des § 16 Satz 2 TzBfG. Es werden insbesondere die Einschränkungen durch den Grundsatz von Treu und Glauben und durch eine (abweichende) vertragliche Regelung untersucht.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Frage, ob eine in einem formnichtig befristeten Arbeitsverhältnis erklärte ordentliche Kündigung durch den Arbeitgeber aufgrund einer vertraglichen beschränkenden Vereinbarung des Kündigungsrechts unwirksam ist. Die Arbeit untersucht dabei die Auslegung des § 16 Satz 2 TzBfG und die Anwendung des Gesetzes im Kontext von befristeten Arbeitsverträgen.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themenbereiche des Teilzeitbefristungsgesetzes (TzBfG), der Befristung von Arbeitsverträgen, der ordentlichen Kündigung, der Auslegung des § 16 Satz 2 TzBfG, des Grundsatzes von Treu und Glauben und der vertraglichen Regelungen des Kündigungsrechts.
Häufig gestellte Fragen
Wann gilt ein befristetes Arbeitsverhältnis als formnichtig?
Ein befristetes Arbeitsverhältnis ist formnichtig, wenn das gesetzliche Schriftformerfordernis gemäß § 14 Abs. 4 TzBfG nicht eingehalten wurde.
Was regelt § 16 Satz 2 TzBfG im Falle einer formnichtigen Befristung?
Er besagt, dass das Arbeitsverhältnis bei Formnichtigkeit der Befristung vor dem vereinbarten Ende ordentlich gekündigt werden kann.
Kann das Kündigungsrecht des § 16 Satz 2 TzBfG vertraglich ausgeschlossen werden?
Das ist die Kernfrage der Arbeit; sie untersucht, ob eine vertragliche Vereinbarung dieses gesetzliche Kündigungsrecht abbedingen oder beschränken kann.
Welche Rolle spielt der Grundsatz von Treu und Glauben?
Treu und Glauben können die Ausübung des Kündigungsrechts einschränken, wenn sich der Arbeitgeber widersprüchlich verhält.
Was passiert, wenn keine ordentliche Kündigungsmöglichkeit vereinbart wurde?
In diesem Fall ist der Arbeitnehmer bei einer unwirksamen Befristung grundsätzlich bis zum geplanten Ende der Befristung vor ordentlichen Kündigungen geschützt.
Welches Urteil des Bundesarbeitsgerichtes bildet die Grundlage?
Die Arbeit bezieht sich maßgeblich auf die Entscheidung des BAG vom 23. April 2009 (Az. 6 AZR 533/08).
Details
- Titel
- Wann ist eine Kündigung durch den Arbeitgeber in einem formnichtig befristeten Arbeitsverhältnis unwirksam?
- Untertitel
- Auslegung des § 16 Satz 2 TzBfG
- Hochschule
- Hochschule Mainz (Fachbereich Wirtschaft)
- Veranstaltung
- Business Law - Rechtswissenschaften - Arbeitsrecht
- Note
- 1,0
- Autor
- Sandra Kleber (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 37
- Katalognummer
- V193317
- ISBN (eBook)
- 9783656185598
- ISBN (Buch)
- 9783656187493
- Dateigröße
- 434 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- arbeitsverhältnis kündigung arbeitgeber vereinbarung kündigungsrechts auslegung satz tzbfg
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Sandra Kleber (Autor:in), 2011, Wann ist eine Kündigung durch den Arbeitgeber in einem formnichtig befristeten Arbeitsverhältnis unwirksam?, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/193317
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-