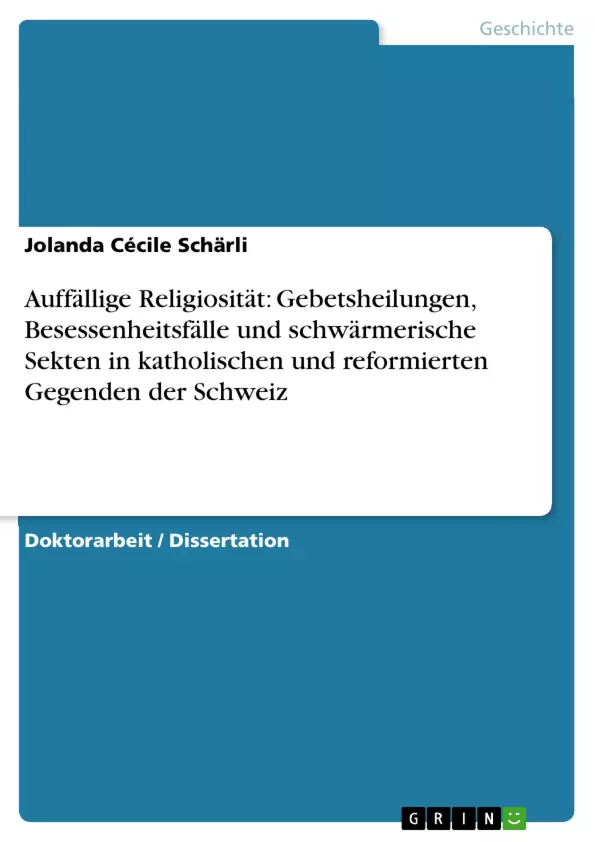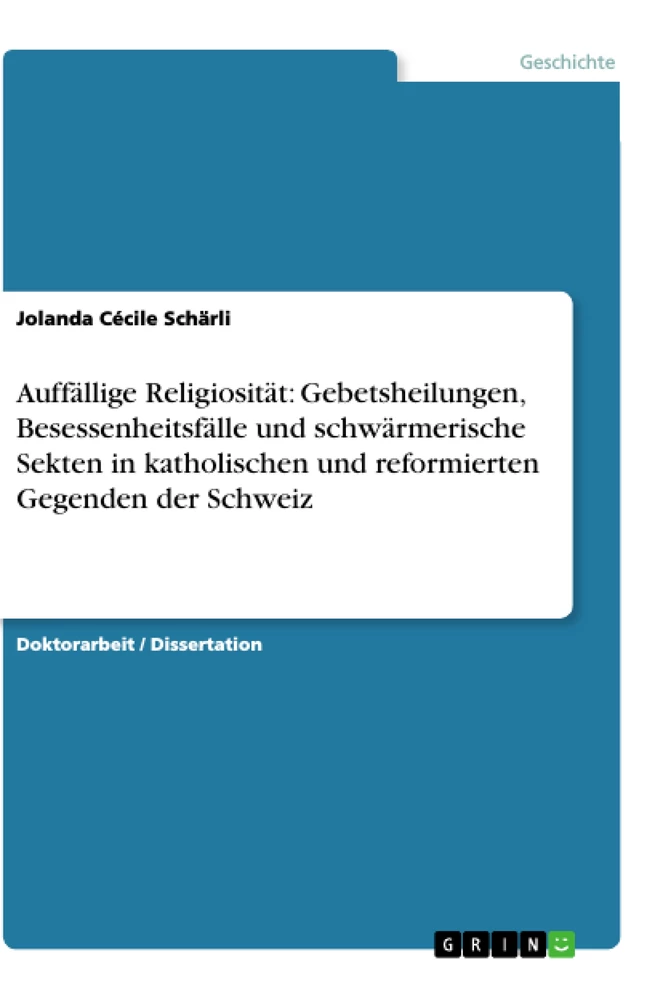
Auffällige Religiosität: Gebetsheilungen, Besessenheitsfälle und schwärmerische Sekten in katholischen und reformierten Gegenden der Schweiz
Doktorarbeit / Dissertation, 2012
371 Seiten, Note: magna cum laude
Geschichte Europas - Neuzeit, Absolutismus, Industrialisierung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Auffällige Religiosität
- 1.1.1 Auffällige Religiosität und Devianz
- 1.1.2 Auffällige Religiosität und religiöser Nonkonformismus
- 1.1.3 Auffällige Religiosität und persönliche Frömmigkeit
- 1.1.4 Auffällige Religiosität und Virtuosenspiritualität
- 1.1.5 Auffällige Religiosität und Volksfrömmigkeit
- 1.2 Einbettung in die Kulturgeschichte
- 1.3 Fragestellung
- 1.4 Forschungsstand
- 1.4.1 Pietismus, Erweckungsbewegung, religiöser Nonkonformismus
- 1.4.2 Seherinnen, Stigmatisierte, Wundergläubige, Schwärmer und Besessene
- 1.4.3 Alltägliche Religiosität
- 1.4.4 Forschungsdesiderat
- 1.5 Methode
- 1.5.1 Untersuchungsraum der Fallbeispiele
- 1.5.2 Vergleich der Fallbeispiele
- 1.5.3 Das Prozessmodell «Stigma und Charisma» von Wolfgang Lipp
- 1.6 Quellen
- 1.6.1 Archivsituation
- 1.6.2 Quellenarten
- 1.7 Aufbau der Arbeit
- 2 Kirchenpolitik und religiöse Zeitströmungen
- 2.1 Verhältnis von Staat und Kirche in Luzern, Zürich und St. Gallen
- 2.1.1 Frühe Neuzeit – Staat und Kirche untrennbar verflochten
- 2.1.2 Helvetik
- 2.1.3 Nach 1803 – Ausgeprägtes Staatskirchentum
- 2.2 Religiöse Zeitströmungen
- 2.2.1 Katholizismus
- 2.2.2 Protestantismus
- 2.2.3 Volksreligiosität
- 2.2.4 «Religiöser Indifferentismus»
- 3 32 Fallbeispiele aus Luzern, Zürich, St. Gallen und Nidwalden
- 3.1 Luzern
- 3.2 Zürich
- 3.3 St. Gallen
- 3.4 Nidwalden
- 3.5 Ergebnis
- 4 Auffällige Handlungen religiöser Frauen und Männer
- 4.1 Systematische Einordnung von auffälliger Religiosität
- 4.2 Verbotene Schriften lesen
- 4.2.1 Das Büchlein vom «Heiligen Liebesbund zur Ehre des göttlichen Herzens Jesu»
- 4.2.2 Die Bekämpfung des Teufels
- 4.2.3 Das «Menne-Büchlein» über die Sakramentalien
- 4.2.4 Mystische Schriften
- 4.2.5 Widerlegung von Predigerworten durch einen Laien
- 4.2.6 Ergebnis
- 4.3 Zusammenkünfte abhalten
- 4.3.1 Die «Herz-Jesu»-Anhängerschaft in St. Gallen
- 4.3.2 Häusliche Gebetskreise in katholischen Gegenden
- 4.3.3 Häusliche Gebetskreise in reformierten Gegenden
- 4.3.4 Ergebnis
- 4.4 «Wallfahren»
- 4.4.1 Die «Herz-Jesu»-Anhängerschaft
- 4.4.2 Die Terziaren
- 4.4.3 Gingen auch Reformierte auf «Wallfahrten»?
- 4.4.4 Ergebnis
- 4.5 Gebetsheilung
- 4.5.1 Heilen in katholischen Gegenden
- 4.5.2 Heilen in reformierten Gegenden
- 4.5.3 Krankheitsverursacher: Dämonen und der Teufel
- 4.5.4 Heilungshoheit
- 4.5.5 Ergebnis
- 4.6 Wiedertaufen
- 4.6.1 Kindertaufe – Geisttaufe – Glaubenstaufe – Wiedertaufen – Erwachsenentaufen
- 4.6.2 Zwangstaufe
- 4.6.3 Bedingnistaufen im katholischen St. Gallen zur Zeit der Helvetischen Republik
- 4.6.4 Ergebnis
- 4.7 Besessen sein
- 4.7.1 Besessenheit als Erklärung für Krankheit
- 4.7.2 Besessenheit als Sinngebung: Die Frau von Weisstannen
- 4.7.3 Besessenheit als Auszeichnung: Anna Maria Anderau
- 4.7.4 Exorzismus: Methode zur Krankenheilung
- 4.7.5 Gibt es Besessenheit? – Konfrontation verschiedener Lebensanschauungen
- 4.7.6 Ergebnis
- 4.8 Visionen empfangen
- 4.8.1 Visionärinnen mit geistiger Führung
- 4.8.2 Unabhängige Visionärinnen und Visionäre
- 4.8.3 Zeitgenössischer Umgang mit dem Phänomen Vision
- 4.8.4 Ergebnis
- 4.9 Gewalt anwenden
- 4.9.1 Körperliche Misshandlung von Susanna Kenzig in Bauma, 1843
- 4.9.2 Die Tötungen von Elisabetha und Margaretha Peter in Wildensbuch, 1823
- 4.9.3 Ergebnis
- 4.10 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 4.10.1 Auffälliges Verhalten
- 4.10.2 Schuldbewältigung durch informelle Kontrolle
- 4.10.3 Schuldbewältigung durch formelle Kontrolle
- 4.10.4 Schuldentlastung
- 4.10.5 Weltbild: Gottes- und Teufelsvorstellungen
- 4.10.6 Wer ist zur Bekämpfung von Krankheiten befugt?
- 4.10.7 Weibliche auffällige Religiosität
- 5 Auffällig religiöse Personen und ihr Publikum
- 5.1 Systematische Analyse der Rollen und Strategien
- 5.2 Margaretha Peter: Geistige Mutter und Blutopfer
- 5.2.1 Die Botschaft der Liebe Gottes
- 5.2.2 Die geistige Mutter
- 5.2.3 Vorbilder
- 5.2.4 Leiden für Gott statt Gottesliebe
- 5.2.5 Unglücklich verliebt
- 5.2.6 Die Geburt
- 5.2.7 Die Auferstehung
- 5.2.8 Margaretha Peter: eine charismatische Ekstatikerin
- 5.3 Philipp Borsinger: Seelsorger und Aufrührer
- 5.3.1 Der Seelsorger
- 5.3.2 Der Aufrührer
- 5.3.3 Philipp Borsinger: Provokateur, Asket und Reumütiger wider Willen
- 5.4 Die Familie Anderau und der «Heilige Liebesbund»
- 5.4.1 Anna Maria Anderau: Das Sprachrohr göttlicher Wahrheiten
- 5.4.2 Joachim Anderau: Der Prädikant, der provoziert
- 5.4.3 Anna Barbara Anderau: die Wallfahrerin
- 5.4.4 Der Liebesbund: Eine verschworene Gemeinschaft
- 5.5 Niklaus Wolf und Dorothea Trudel: Asketische Heilige
- 5.5.1 Gleiches Gebet in zwei Konfessionen
- 5.5.2 Gesellschaftliches und religiöses Umfeld
- 5.5.3 Jesus im Mittelpunkt des Glaubensbekenntnisses
- 5.5.4 Ausstrahlung auf weitere Bevölkerungskreise
- 5.5.5 Asketische Heilige
- 5.6 Medizin versus Gebetsheilung
- 5.6.1 Die Vorwürfe der Medizinalbehörde
- 5.6.2 Üble Nachrede
- 5.6.3 Trudels Gegnerschaft: Ärzte und Medizinalbehörde des Kantons Zürich
- 5.6.4 Die Behandlung von Geisteskranken
- 5.6.5 Vor Obergericht
- 5.7 Der Kampf um Anerkennung als unabhängige religiöse Gemeinschaft
- 5.7.1 Umgang mit separatistischen Gruppen im Kanton Zürich
- 5.7.2 Umgang mit separatistischen Gruppierungen im Kanton St. Gallen
- 5.7.3 Umgang mit separatistischen Gruppierungen im Kanton Luzern
- 5.8 Unter Schwärmereiverdacht
- 5.8.1 Die «Herz-Jesu»-Gemeinschaft in der Umgebung der Stadt St. Gallen
- 5.8.2 Die Terziaren: Sektierer in Ruswil und Wolhusen
- 5.8.3 Religiöse «Schwärmerei» in der Familie Hartmann in Hohenrain
- 5.8.4 Margaretha Peter: das Paradebeispiel einer Schwärmerin
- 5.8.5 Zeitgenössischer Diskurs
- 5.9 Zusammenfassender Vergleich der Rollen und Strategien
- 5.9.1 Existentielle Ebene: Ekstase, Provokation und Askese
- 5.9.2 Soziale und kulturelle Ebenen
- 5.9.3 Weibliche auffällige Religiosität
- 6 Schlussbetrachtung
- 6.1 Kantonsvergleich
- 6.2 Konfessionsvergleich
- 6.3 Auffällige Religiosität und die Säkularisierungstheorie
- 6.4 Weibliche und männliche auffällige Religiosität
- 6.5 Auffällige Religiosität
- 7 Abkürzungsverzeichnis
- 8 Quellen- und Literaturverzeichnis
- 8.1 Quellen
- 8.2 Literatur
- 8.3 Lexika
- 9 Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Forschungsarbeit untersucht Phänomene "auffälliger Religiosität" in den Kantonen Luzern, Zürich und St. Gallen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ziel ist es, diese Phänomene aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten – dem Selbstverständnis der Akteure, dem Handeln der weltlichen und kirchlichen Behörden und dem gesellschaftlichen Kontext. Die Arbeit analysiert, wie die beteiligten Akteure auf soziale Zuschreibungen von Schuld reagierten und welche Strategien sie anwendeten.
- Definition und Einordnung von "auffälliger Religiosität"
- Analyse verschiedener Handlungsweisen (Schriftlektüre, Versammlungen, Wallfahrten, Heilungen, Taufen, Besessenheit, Visionen, Gewalt)
- Untersuchung der Rollen und Strategien der Akteure (Selbststigmatisierung, Provokation, Askese, Ekstase)
- Der Umgang der Behörden mit auffälliger Religiosität (informelle und formelle Kontrolle)
- Konfessions- und Kantonsvergleich
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Arbeit untersucht "auffällige Religiosität" im frühen 19. Jahrhundert in der Schweiz, ausgehend von Briefen zwischen Ignaz Heinrich von Wessenberg und Paul Usteri, die über religiöse "Schwärmereien" berichteten. Der Fokus liegt auf der Bedeutung von Religion für die historischen Subjekte und untersucht gesellschaftliche Randphänomene. Die Arbeit verwendet den Begriff "auffällige Religiosität" als neutralen phänomenologischen Terminus und differenziert ihn von Begriffen wie Devianz und Nonkonformismus.
2 Kirchenpolitik und religiöse Zeitströmungen: Dieses Kapitel skizziert das Verhältnis von Staat und Kirche in den Kantonen Luzern, Zürich und St. Gallen während der frühen Neuzeit, der Helvetik und der Zeit nach 1803. Es beschreibt die Verflechtung von Staat und Kirche, die Auswirkungen der helvetischen Revolution und die spätere Rückkehr zum Staatskirchentum. Es analysiert auch die religiösen Strömungen der Zeit – Barockreligiosität, Reformkatholizismus, katholische Erweckungsbewegung, protestantische Orthodoxie, Pietismus, Erweckungsbewegung, und liberaler Protestantismus – und deren Interaktion.
3 32 Fallbeispiele aus Luzern, Zürich, St. Gallen und Nidwalden: Dieses Kapitel präsentiert die 32 Fallbeispiele, die als Grundlage der Studie dienen. Es beschreibt die regionale und konfessionelle Verteilung der Fälle und gibt eine erste Charakterisierung der unterschiedlichen Erscheinungsformen auffälliger Religiosität.
4 Auffällige Handlungen religiöser Frauen und Männer: Dieses Kapitel analysiert verschiedene auffällige Handlungen religiöser Personen, von der Lektüre verbotener Schriften über die Abhaltung von Zusammenkünften bis hin zu Gebetsheilungen, Wiedertaufen, Visionen und Gewalttätigkeiten. Es untersucht die Motive der Akteure und den Umgang der Obrigkeiten mit diesen Handlungen (informelle und formelle Kontrolle).
Schlüsselwörter
Auffällige Religiosität, Säkularisierung, Erweckungsbewegung, Pietismus, Volksfrömmigkeit, Reformkatholizismus, Ultramontanismus, Liberaler Protestantismus, Besessenheit, Exorzismen, Visionen, Stigmatisierung, Selbststigmatisierung, Charisma, Konfessionsvergleich, Kantonsvergleich, Schweiz, 19. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Auffällige Religiosität im frühen 19. Jahrhundert in der Schweiz
Was ist der Gegenstand dieser Forschungsarbeit?
Die Arbeit untersucht Phänomene "auffälliger Religiosität" in den Kantonen Luzern, Zürich und St. Gallen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der Fokus liegt auf dem Selbstverständnis der Akteure, dem Handeln der weltlichen und kirchlichen Behörden und dem gesellschaftlichen Kontext. Analysiert wird, wie die Akteure auf soziale Zuschreibungen von Schuld reagierten und welche Strategien sie anwendeten.
Welche Phänomene der "auffälligen Religiosität" werden untersucht?
Die Studie analysiert verschiedene Handlungsweisen wie das Lesen verbotener Schriften, das Abhalten von Zusammenkünften, Wallfahrten, Gebetsheilungen, Wiedertaufen, das Empfangen von Visionen, sowie Gewalttätigkeiten. Die Rollen und Strategien der Akteure (Selbststigmatisierung, Provokation, Askese, Ekstase) werden ebenso untersucht wie der Umgang der Behörden mit auffälliger Religiosität (informelle und formelle Kontrolle).
Wie wird "auffällige Religiosität" definiert?
Der Begriff "auffällige Religiosität" wird als neutraler, phänomenologischer Terminus verwendet und von Begriffen wie Devianz und Nonkonformismus abgegrenzt. Die Arbeit konzentriert sich auf die Bedeutung von Religion für die historischen Subjekte und untersucht gesellschaftliche Randphänomene.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit basiert auf 32 Fallbeispielen aus Luzern, Zürich, St. Gallen und Nidwalden. Die genauen Quellenarten werden im Kapitel über die Quellen und im Quellen- und Literaturverzeichnis detailliert beschrieben. Die Archivsituation wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Studie verwendet eine vergleichende Methode, die die Fallbeispiele aus verschiedenen Kantonen und Konfessionen analysiert. Es wird ein Prozessmodell ("Stigma und Charisma" von Wolfgang Lipp) angewendet, um die Dynamiken zwischen den Akteuren und den Behörden zu verstehen.
Welche religiösen Zeitströmungen werden berücksichtigt?
Die Arbeit betrachtet verschiedene religiöse Strömungen der Zeit, darunter Barockreligiosität, Reformkatholizismus, katholische Erweckungsbewegung, protestantische Orthodoxie, Pietismus, Erweckungsbewegung und liberaler Protestantismus, und deren Interaktion im Kontext der untersuchten Phänomene.
Wie ist das Verhältnis von Staat und Kirche dargestellt?
Das Kapitel über Kirchenpolitik und religiöse Zeitströmungen skizziert das Verhältnis von Staat und Kirche in den Kantonen Luzern, Zürich und St. Gallen während der frühen Neuzeit, der Helvetik und der Zeit nach 1803. Es beschreibt die Verflechtung von Staat und Kirche, die Auswirkungen der helvetischen Revolution und die spätere Rückkehr zum Staatskirchentum.
Welche konkreten Fallbeispiele werden analysiert?
Die Arbeit analysiert detailliert mehrere Fallbeispiele, darunter die Geschichten von Margaretha Peter, Philipp Borsinger, der Familie Anderau, Niklaus Wolf und Dorothea Trudel. Diese Beispiele illustrieren verschiedene Aspekte der "auffälligen Religiosität" und deren gesellschaftliche Einbettung.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussbetrachtung beinhaltet einen Kantons- und Konfessionsvergleich, eine Auseinandersetzung mit der Säkularisierungstheorie im Kontext der untersuchten Phänomene, sowie eine Analyse der Unterschiede zwischen weiblicher und männlicher "auffälliger Religiosität". Die Arbeit untersucht auch die unterschiedlichen Strategien der Schuldbewältigung (informelle und formelle Kontrolle).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Auffällige Religiosität, Säkularisierung, Erweckungsbewegung, Pietismus, Volksfrömmigkeit, Reformkatholizismus, Ultramontanismus, Liberaler Protestantismus, Besessenheit, Exorzismen, Visionen, Stigmatisierung, Selbststigmatisierung, Charisma, Konfessionsvergleich, Kantonsvergleich, Schweiz, 19. Jahrhundert.
Details
- Titel
- Auffällige Religiosität: Gebetsheilungen, Besessenheitsfälle und schwärmerische Sekten in katholischen und reformierten Gegenden der Schweiz
- Hochschule
- Universität Luzern (Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät)
- Note
- magna cum laude
- Autor
- Dr. des. Jolanda Cécile Schärli (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2012
- Seiten
- 371
- Katalognummer
- V193559
- ISBN (eBook)
- 9783656185994
- ISBN (Buch)
- 9783656186175
- Dateigröße
- 6680 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Schlagworte
- Schweiz Neuzeit 19. Jahrhundert Religiosität Auffällige Religiosität Nonkonformismus Frömmigkeit
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 41,99
- Preis (Book)
- US$ 54,99
- Arbeit zitieren
- Dr. des. Jolanda Cécile Schärli (Autor:in), 2012, Auffällige Religiosität: Gebetsheilungen, Besessenheitsfälle und schwärmerische Sekten in katholischen und reformierten Gegenden der Schweiz, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/193559
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-