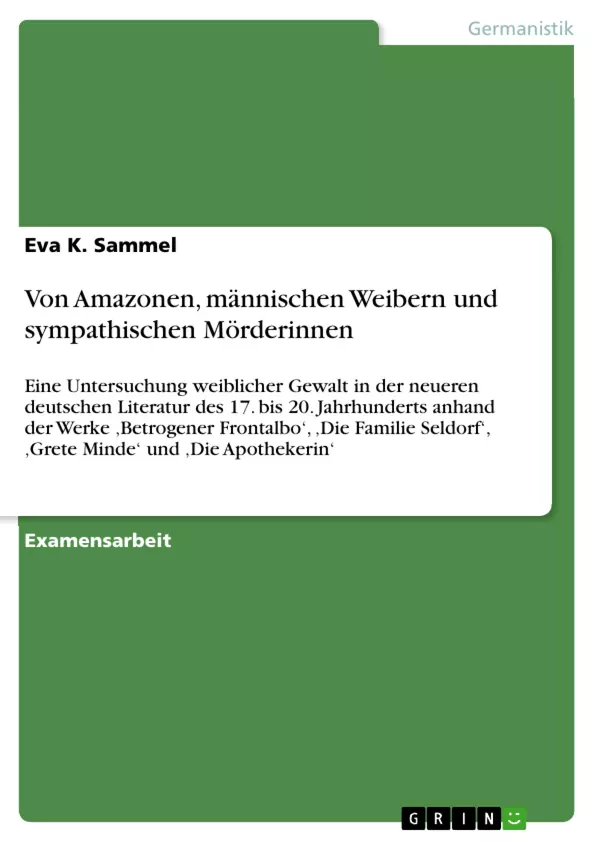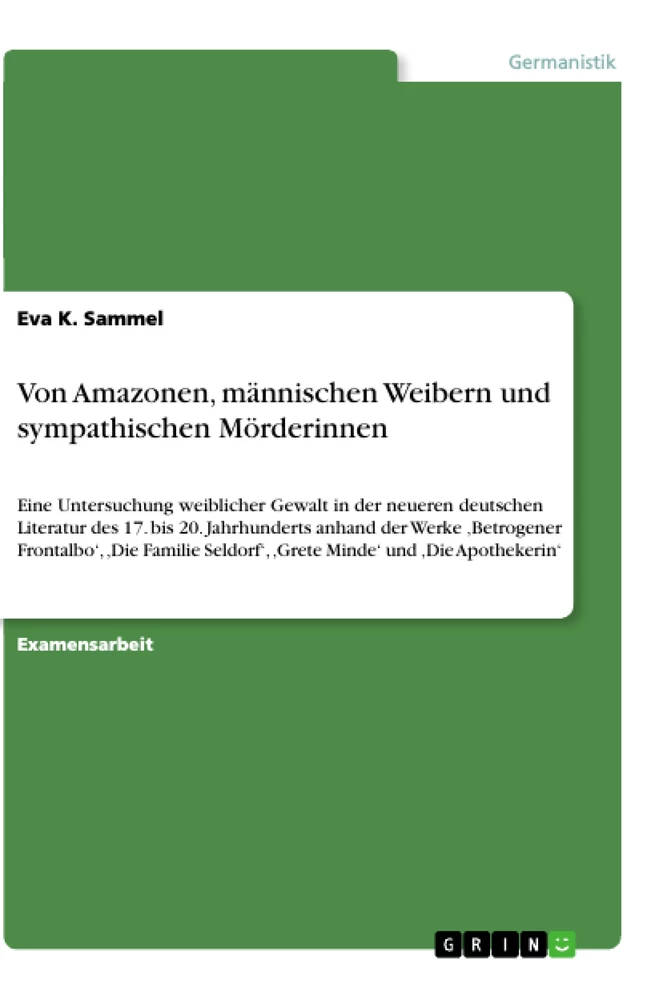
Von Amazonen, männischen Weibern und sympathischen Mörderinnen
Examensarbeit, 2010
123 Seiten, Note: 11 Punkte
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Gewalt und ihre Literarisierung
- 2.1 Der Gewaltbegriff
- 2.1.1 Etymologie und historische Semantik des Gewaltbegriffs
- 2.1.2 Gewaltverständnis und Gewaltformen
- 2.1.3 Theorien und Modelle zur Entstehung von Gewalt
- 2.1.4 Folgen von Gewalt und ihre Prävention
- 2.1.5 Frauen und Gewalt
- 2.2 Gewalt und Literatur
- 2.2.1 Das Phänomen der Gewalt in der Literatur
- 2.2.2 Gewalttätige Frauen der Weltliteratur
- 2.2.3 Das Faszinosum literarischer Gewaltdarstellungen
- 2.1 Der Gewaltbegriff
- 3. Johann Gorgias (alias Veriphantor): Betrogener Frontalbo (ca. 1670)
- 3.1 Frauen im 17. Jahrhundert
- 3.2 Darstellung weiblicher Gewalt in Betrogener Frontalbo
- 4. Therese Huber: Die Familie Seldorf (1795/96)
- 4.1 Frauen im 18. Jahrhundert
- 4.2 Darstellung weiblicher Gewalt in Die Familie Seldorf
- 5. Theodor Fontane: Grete Minde (1879/80)
- 5.1 Frauen im 19. Jahrhundert
- 5.2 Darstellung weiblicher Gewalt in Grete Minde
- 6. Ingrid Noll: Die Apothekerin (1994)
- 6.1 Frauen im 20. Jahrhundert
- 6.2 Darstellung weiblicher Gewalt in Die Apothekerin
- 7. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Examensarbeit untersucht die literarische Darstellung und Reflexion weiblicher Gewalt in deutschsprachiger Erzählprosa vom 17. bis zum 20. Jahrhundert. Die Arbeit analysiert ausgewählte Werke, um die Entwicklung des Bildes gewalttätiger Frauen in der Literatur zu beleuchten und die verschiedenen Formen weiblicher Gewalt darzustellen.
- Entwicklung des Bildes gewalttätiger Frauen in der Literatur über die Jahrhunderte
- Verschiedene Formen weiblicher Gewalt in der Literatur
- Der gesellschaftliche Kontext und die Rolle der Frau in den jeweiligen Epochen
- Literarische Mittel der Darstellung von weiblicher Gewalt
- Vergleichende Analyse der ausgewählten Werke
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Examensarbeit ein und beschreibt die Forschungsfrage sowie die Methodik. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die vier ausgewählten literarischen Werke: "Betrogener Frontalbo" von Johann Gorgias, "Die Familie Seldorf" von Therese Huber, "Grete Minde" von Theodor Fontane und "Die Apothekerin" von Ingrid Noll. Die Einleitung legt die Bedeutung der Untersuchung der literarischen Darstellung weiblicher Gewalt und deren Wandel über die Jahrhunderte dar.
2. Gewalt und ihre Literarisierung: Dieses Kapitel liefert einen umfassenden theoretischen Rahmen. Es definiert den Gewaltbegriff etymologisch und semantisch, untersucht verschiedene Gewaltformen (personell, institutionell) und beleuchtet Theorien zur Entstehung von Gewalt, insbesondere in familiären Kontexten. Es analysiert die Opferperspektive und geht auf sozialpsychologische Aggressionstheorien, Frustrations-Aggressions-Hypothesen und Stresstheorien ein, bevor es sich speziell mit Frauen und Gewalt auseinandersetzt. Der Abschnitt über Gewalt und Literatur diskutiert das Phänomen der Gewaltdarstellung in der Literatur und beleuchtet das Faszinosum literarischer Gewaltdarstellungen.
3. Johann Gorgias (alias Veriphantor): Betrogener Frontalbo (ca. 1670): Dieses Kapitel analysiert "Betrogener Frontalbo" im Kontext des 17. Jahrhunderts und untersucht die Darstellung weiblicher Gewalt in diesem Werk. Es beleuchtet verschiedene Facetten weiblicher Gewalt, von übernatürlichen Kräften bis hin zu verführerischer und erzieherischer Gewalt. Die Rolle der Frau im 17. Jahrhundert und die misogynen Tendenzen des Autors werden ebenfalls untersucht, um das Gesamtbild der weiblichen Gewalt im Werk zu verstehen.
4. Therese Huber: Die Familie Seldorf (1795/96): Das Kapitel widmet sich "Die Familie Seldorf" und betrachtet die Darstellung weiblicher Gewalt im Kontext des 18. Jahrhunderts. Es analysiert die Figur der Sara, die als Rächerin ihres Geschlechts agiert und die Thematik des Kampfes der Geschlechter beleuchtet. Das Kapitel thematisiert den historischen Kontext, insbesondere die Rolle von Frauen im 18. Jahrhundert und das Motiv der Kindsmörderinnen.
5. Theodor Fontane: Grete Minde (1879/80): Dieses Kapitel analysiert Fontanes "Grete Minde" und die Darstellung weiblicher Gewalt im 19. Jahrhundert. Es untersucht Gretes Kampf gegen familiäre und institutionelle Gewalt, indem es ihre Konflikte mit verschiedenen Figuren, wie Trud und Gerdt, detailliert beschreibt. Der Fokus liegt auf der Analyse von Gretes Reaktionen und Handlungen im Angesicht gesellschaftlicher Zwänge und Ungerechtigkeiten.
6. Ingrid Noll: Die Apothekerin (1994): Das Kapitel konzentriert sich auf Ingrid Nolls "Die Apothekerin" und untersucht die Darstellung weiblicher Gewalt im 20. Jahrhundert. Es analysiert die Figur der Hella Moormann und ihre gewalttätigen Handlungen, einschließlich der Morde an mehreren Personen. Die Kapitel behandelt zudem Hellas autodestruktives Verhalten im Kontext der gesellschaftlichen Verhältnisse des 20. Jahrhunderts.
Schlüsselwörter
Weibliche Gewalt, Literatur, deutschsprachige Erzählprosa, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, Gewaltdarstellung, Frauendarstellung, Gender, Sozialpsychologie, Aggression, Familiengewalt, Institutionelle Gewalt, Literaturanalyse, Johann Gorgias, Therese Huber, Theodor Fontane, Ingrid Noll, Betrogener Frontalbo, Die Familie Seldorf, Grete Minde, Die Apothekerin.
Häufig gestellte Fragen zu "Literarische Darstellung weiblicher Gewalt"
Was ist der Gegenstand dieser Examensarbeit?
Die Examensarbeit untersucht die literarische Darstellung und Reflexion weiblicher Gewalt in deutschsprachiger Erzählprosa vom 17. bis zum 20. Jahrhundert. Sie analysiert ausgewählte Werke, um die Entwicklung des Bildes gewalttätiger Frauen in der Literatur zu beleuchten und die verschiedenen Formen weiblicher Gewalt darzustellen.
Welche Werke werden analysiert?
Die Arbeit analysiert vier ausgewählte literarische Werke: "Betrogener Frontalbo" von Johann Gorgias (alias Veriphantor), "Die Familie Seldorf" von Therese Huber, "Grete Minde" von Theodor Fontane und "Die Apothekerin" von Ingrid Noll.
Welche Themen werden im theoretischen Teil behandelt?
Der theoretische Teil umfasst eine umfassende Auseinandersetzung mit dem Gewaltbegriff (Etymologie, Semantik, verschiedene Formen), Theorien zur Entstehung von Gewalt (sozialpsychologische Aggressionstheorien, Frustrations-Aggressions-Hypothesen, Stresstheorien), Frauen und Gewalt sowie dem Phänomen der Gewaltdarstellung in der Literatur.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Gewalt und ihre Literarisierung, Analyse von "Betrogener Frontalbo", Analyse von "Die Familie Seldorf", Analyse von "Grete Minde", Analyse von "Die Apothekerin" und Schlussbemerkung. Jedes Kapitel zu den einzelnen Werken untersucht die Darstellung weiblicher Gewalt im jeweiligen historischen Kontext und berücksichtigt die Rolle der Frau in der entsprechenden Epoche.
Was sind die zentralen Forschungsfragen?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Bildes gewalttätiger Frauen in der Literatur über die Jahrhunderte, die verschiedenen Formen weiblicher Gewalt in der Literatur, den gesellschaftlichen Kontext und die Rolle der Frau in den jeweiligen Epochen, die literarischen Mittel der Darstellung von weiblicher Gewalt und vergleicht die ausgewählten Werke.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine literaturwissenschaftliche Analysemethode, die die ausgewählten Texte im Kontext ihrer jeweiligen Epoche untersucht. Es werden sowohl die literarischen Mittel der Gewaltdarstellung als auch der gesellschaftliche Kontext berücksichtigt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Weibliche Gewalt, Literatur, deutschsprachige Erzählprosa, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, Gewaltdarstellung, Frauendarstellung, Gender, Sozialpsychologie, Aggression, Familiengewalt, Institutionelle Gewalt, Literaturanalyse, Johann Gorgias, Therese Huber, Theodor Fontane, Ingrid Noll, Betrogener Frontalbo, Die Familie Seldorf, Grete Minde, Die Apothekerin.
Wie wird die weibliche Gewalt in den einzelnen Werken dargestellt?
Die Analyse der einzelnen Werke beleuchtet die verschiedenen Facetten weiblicher Gewalt, von übernatürlichen Kräften bis hin zu verführerischer und erzieherischer Gewalt (Betrogener Frontalbo), Rächerinnenfiguren und dem Kampf der Geschlechter (Die Familie Seldorf), den Kampf gegen familiäre und institutionelle Gewalt (Grete Minde) und autodestruktives Verhalten im Kontext gesellschaftlicher Verhältnisse (Die Apothekerin). Die Analyse berücksichtigt jeweils den historischen Kontext und die Rolle der Frau in der entsprechenden Epoche.
Details
- Titel
- Von Amazonen, männischen Weibern und sympathischen Mörderinnen
- Untertitel
- Eine Untersuchung weiblicher Gewalt in der neueren deutschen Literatur des 17. bis 20. Jahrhunderts anhand der Werke ‚Betrogener Frontalbo‘, ‚Die Familie Seldorf‘, ‚Grete Minde‘ und ‚Die Apothekerin‘
- Hochschule
- Universität des Saarlandes
- Note
- 11 Punkte
- Autor
- Eva K. Sammel (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2010
- Seiten
- 123
- Katalognummer
- V195375
- ISBN (eBook)
- 9783656211150
- ISBN (Buch)
- 9783656212768
- Dateigröße
- 969 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Weibliche Gewalt deutschsprachige Erzählprosa 17. Jahrhundert 18. Jahrhundert 19. Jahrhundert 20. Jahrhundert Frauen Gewalt Gewalt von Frauen Kriminalroman Grete Minde Theodor Fontane Therese Huber Die Familie Seldorf Die Apothekerin Ingrid Noll Betrogener Frontalbo Johann Gorgias Veriphantor Literatur Theorien von Gewalt Amazonen Kindsmörderin Hella Moormann
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Eva K. Sammel (Autor:in), 2010, Von Amazonen, männischen Weibern und sympathischen Mörderinnen , München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/195375
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-