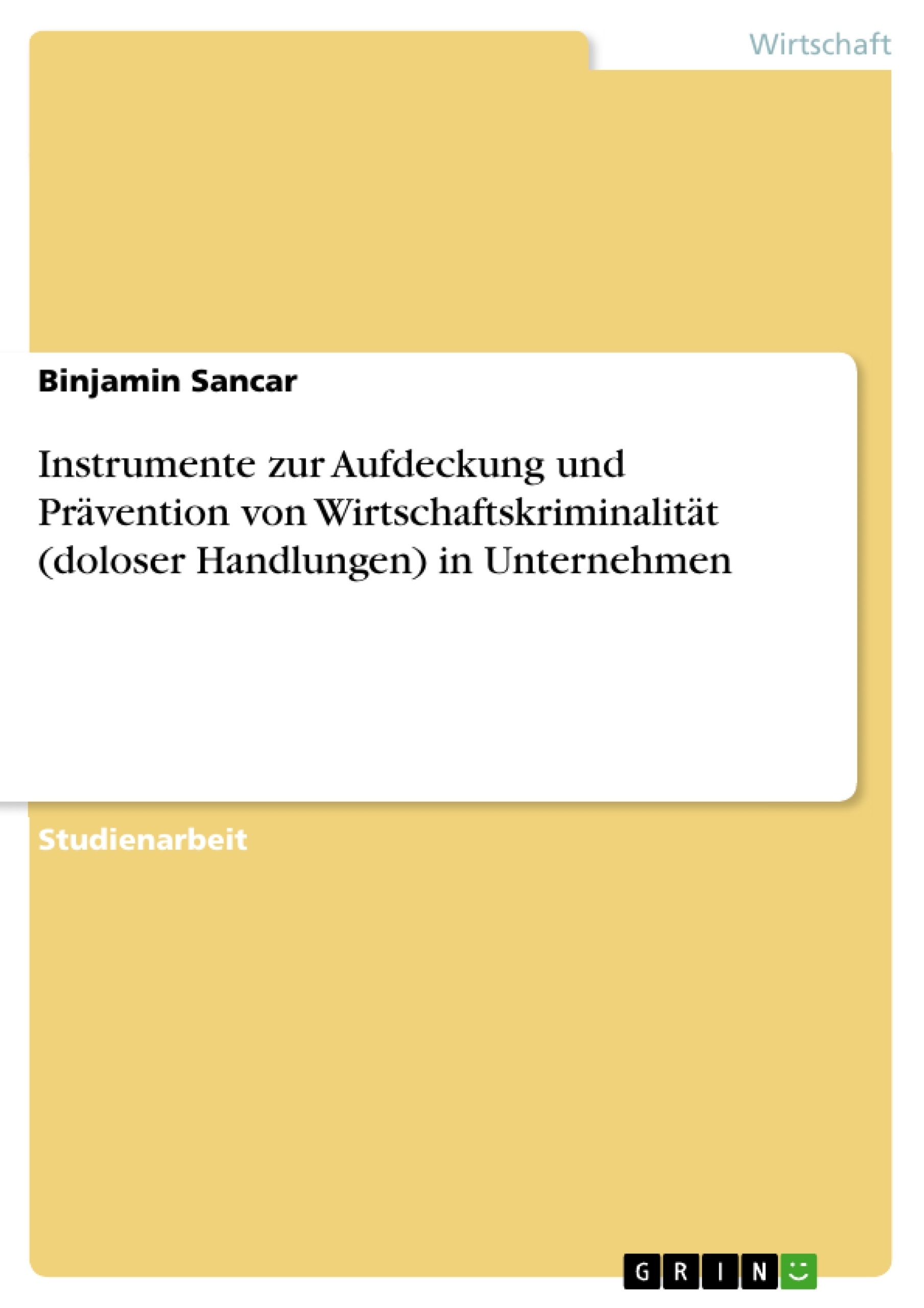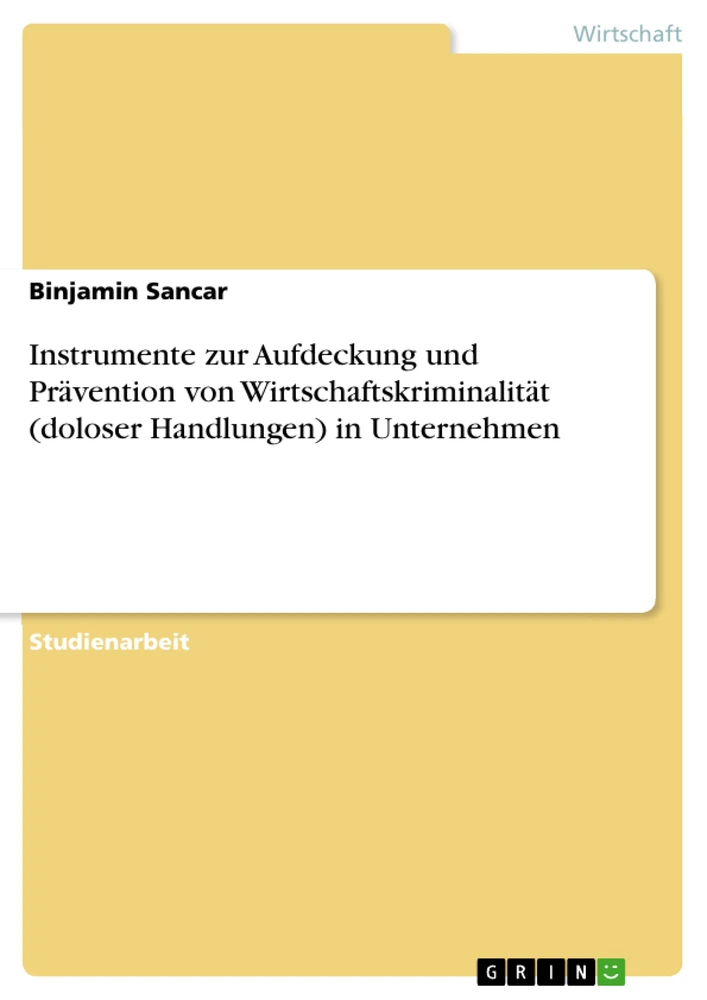
Instrumente zur Aufdeckung und Prävention von Wirtschaftskriminalität (doloser Handlungen) in Unternehmen
Seminararbeit, 2012
51 Seiten
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Einführung in die Thematik
1.2 Aufbau der Arbeit
2 Wirtschaftskriminalität in Unternehmen
2.1 Begriffsdefinition (verschiedene Ansätze)
2.1.1 Allgemeiner Teil
2.1.2 White-Collar-Criminality
2.1.3 Unternehmensbezogene Definition
2.1.4 Gesetzliche Regelungen (keine allgemeine Definition)
2.2 Entstehung von Wirtschaftskriminalität - Das Modell von Cressey (Fraud-Triangle)
2.3 Verursachte Schäden durch Wirtschaftskriminalität
2.4 Die schwerwiegendsten Arten/Erscheinungsformen der Wirtschaftskriminalität in Unternehmen
2.4.1 Allgemeines
2.4.2 Kartellrechtsverstöße
2.4.3 Geldwäsche
2.4.4 Korruption
2.4.5 Fälschung von Jahresabschlüssen und Finanzinformationen
2.4.6 Verletzung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen
3 Instrumente zur Aufdeckung und Prävention
3.1 Allgemein
3.2 Das 10-Punkte-Programm
3.3 Interne Kontrollsystem (IKS)
3.4 Compliance-Programm
3.4.1 Überblicke
3.4.2 Definition Compliance
3.4.3 Das Compliance Programm
3.5 Interne Revision
3.6 Forensische Untersuchungstechniken
3.7 Audit Committees
3.8 Whistleblowing
3.8.1 Der Begriff
3.8.2 Beschreibung des Systems
3.8.3 Whistleblowing - Vorgehensweise
3.8.4 Auswirkungen
3.8.5 Whistleblowing im internationalen Vergleich
3.9 Personalpolitik
3.10 Unternehmenskulturelle Maßnahmen
3.11 Reaktion auf dolose Handlungen
4 Zusammenfassung mit Schlussbetrachtung
Literatur- und Quellenverzeichnis
Anlagen
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter "dolosen Handlungen"?
Der Begriff stammt vom lateinischen "dolus" (List) und bezeichnet wirtschaftskriminelle Handlungen, die Täter unter Ausnutzung ihres kaufmännischen Wissens begehen.
Was erklärt das "Fraud-Triangle" von Cressey?
Es beschreibt die drei Faktoren, die zur Entstehung von Wirtschaftskriminalität führen: Gelegenheit, Rechtfertigung und Druck (Motivation).
Welche Instrumente dienen der Prävention von Wirtschaftskriminalität?
Wichtige Instrumente sind interne Kontrollsysteme (IKS), Compliance-Programme, die Interne Revision sowie unternehmenskulturelle Maßnahmen.
Welche Rolle spielt Whistleblowing in Unternehmen?
Whistleblowing-Systeme ermöglichen es Mitarbeitern, Missstände anonym zu melden, und sind ein effektives Instrument zur Aufdeckung von Korruption und Betrug.
Was sind die schwerwiegendsten Formen doloser Handlungen?
Dazu zählen Kartellrechtsverstöße, Geldwäsche, Korruption sowie die Fälschung von Jahresabschlüssen und Finanzinformationen.
Details
- Titel
- Instrumente zur Aufdeckung und Prävention von Wirtschaftskriminalität (doloser Handlungen) in Unternehmen
- Hochschule
- Hochschule Aschaffenburg
- Autor
- Binjamin Sancar (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2012
- Seiten
- 51
- Katalognummer
- V195981
- ISBN (eBook)
- 9783656228424
- ISBN (Buch)
- 9783656229926
- Dateigröße
- 691 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Es handelt sich hierbei um eine weitergeführte Seminararbeit. Die Seminararbeit wurde nicht in dieser Form an die Hochschule abgegeben.
- Schlagworte
- Wirtschaftskriminalität dolose Handlungen Aufdeckung Prävention Bekämpfung wirtschaftskriminelle Handlungen Bilanzdelikte Instrumente zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität 10 Punkte Programm Interne Kontrollsystem IKS Compliance Interne Revision IR Forensische Untersuchungstechniken Audit Committees Whistleblowing Personalpolitik Unternehmenskulturelle Maßnahmen Reaktion auf dolose Handlungen White-Collar-Criminality Fraud-Triangle Kartellrechtsverstöße Geldwäsche Korruption Fälschung von Jahresabschlüssen und Finanzinformationen Verletzung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Reputationsschaden finanzielle Schäden Schäden durch Wirtschaftskriminalität
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 30,99
- Arbeit zitieren
- Binjamin Sancar (Autor:in), 2012, Instrumente zur Aufdeckung und Prävention von Wirtschaftskriminalität (doloser Handlungen) in Unternehmen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/195981
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-