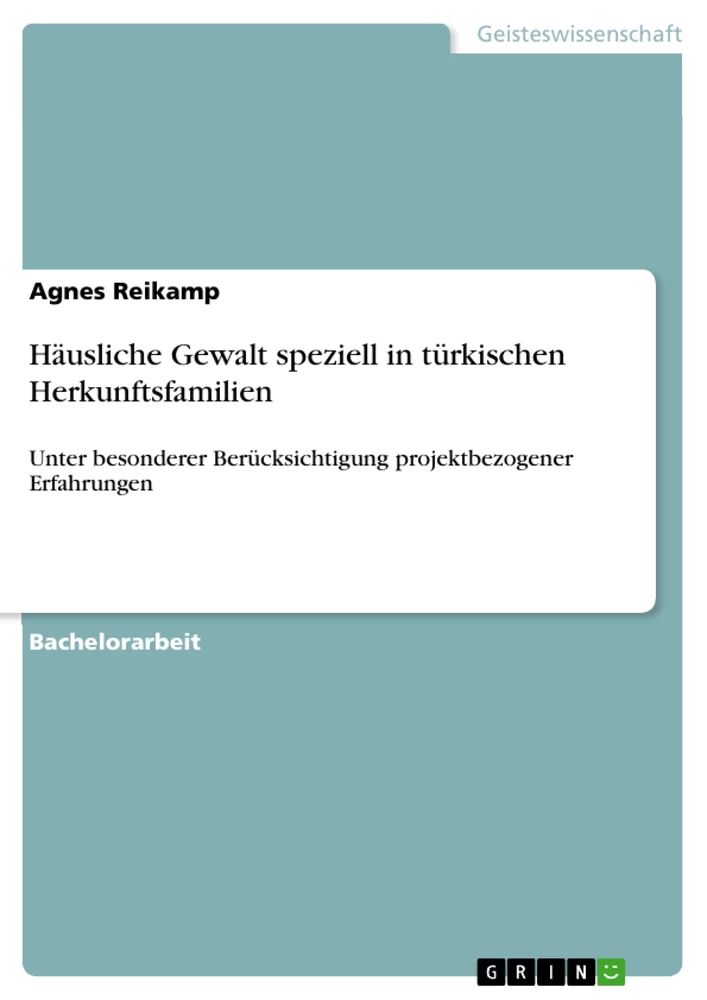
Häusliche Gewalt speziell in türkischen Herkunftsfamilien
Bachelorarbeit, 2012
49 Seiten
Leseprobe
Inhalt
1. Einleitung
2. Das Phänomen „Häusliche Gewalt“ – Begriffsbestimmung und Prävention
2.1 Definition
2.2 Prävention
2.2.1 BIG-Prävention
2.2.2 Interkulturelle Aspekte bei der Prävention
3. Häusliche Gewalt gegen türkische Frauen und Kinder
3.1 Die Situation in der Türkei
3.2 Exkurs: Entwicklungsschritte und Stationen der türkischen Frauenbewegung
3.3 Die Situation türkischer Migrantinnen in Deutschland
3.4 Die Entwicklung der häuslichen Gewalt in Berlin zwischen 2004 und
3.5 Häusliche Gewalt und Kinder
3.6 Fallbeispiele für die Täter- und die Opferperspektive
3.6.1 Hassan, als Elfjähriger nach Deutschland nachgeholt, ohne Schulabschluss und Berufsausbildung
3.6.2 Yüksel, in Ingolstadt geborener studierter Betriebswirt
3.6.3 Hakan, in München geborener Imbissbesitzer
3.6.4 Serap, mit 16 Jahren zwangsverheiratet
3.6.5 Hatice, eine Importbraut ohne Bindungen in und an Deutschland
3.6.6 Ahmet, als Zehnjähriger Zeuge und Opfer häuslicher Gewalt
4. Hilfsangebote für die Opfer häuslicher Gewalt in Berlin
4.1 Arbeitsansätze der Soziologie in der Arbeit mit Opfern häuslicher Gewalt
4.1.1 Der systemische Ansatz
4.1.2 Der klientenzentrierte Ansatz
4.2 Hilfs- und Beratungsangebote in Berlin
4.2.1 Beratungsstellen
4.2.2 Frauenhäuser
4.2.3 Zufluchtswohnungen
4.2.4 Klientelvergleich der drei Betreuungsformen
5. Fazit
Quellenverzeichnis
Details
- Titel
- Häusliche Gewalt speziell in türkischen Herkunftsfamilien
- Untertitel
- Unter besonderer Berücksichtigung projektbezogener Erfahrungen
- Autor
- Agnes Reikamp (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2012
- Seiten
- 49
- Katalognummer
- V195984
- ISBN (eBook)
- 9783656221845
- ISBN (Buch)
- 9783656222149
- Dateigröße
- 630 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- häusliche gewalt herkunftsfamilien berücksichtigung erfahrungen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Agnes Reikamp (Autor:in), 2012, Häusliche Gewalt speziell in türkischen Herkunftsfamilien, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/195984
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









