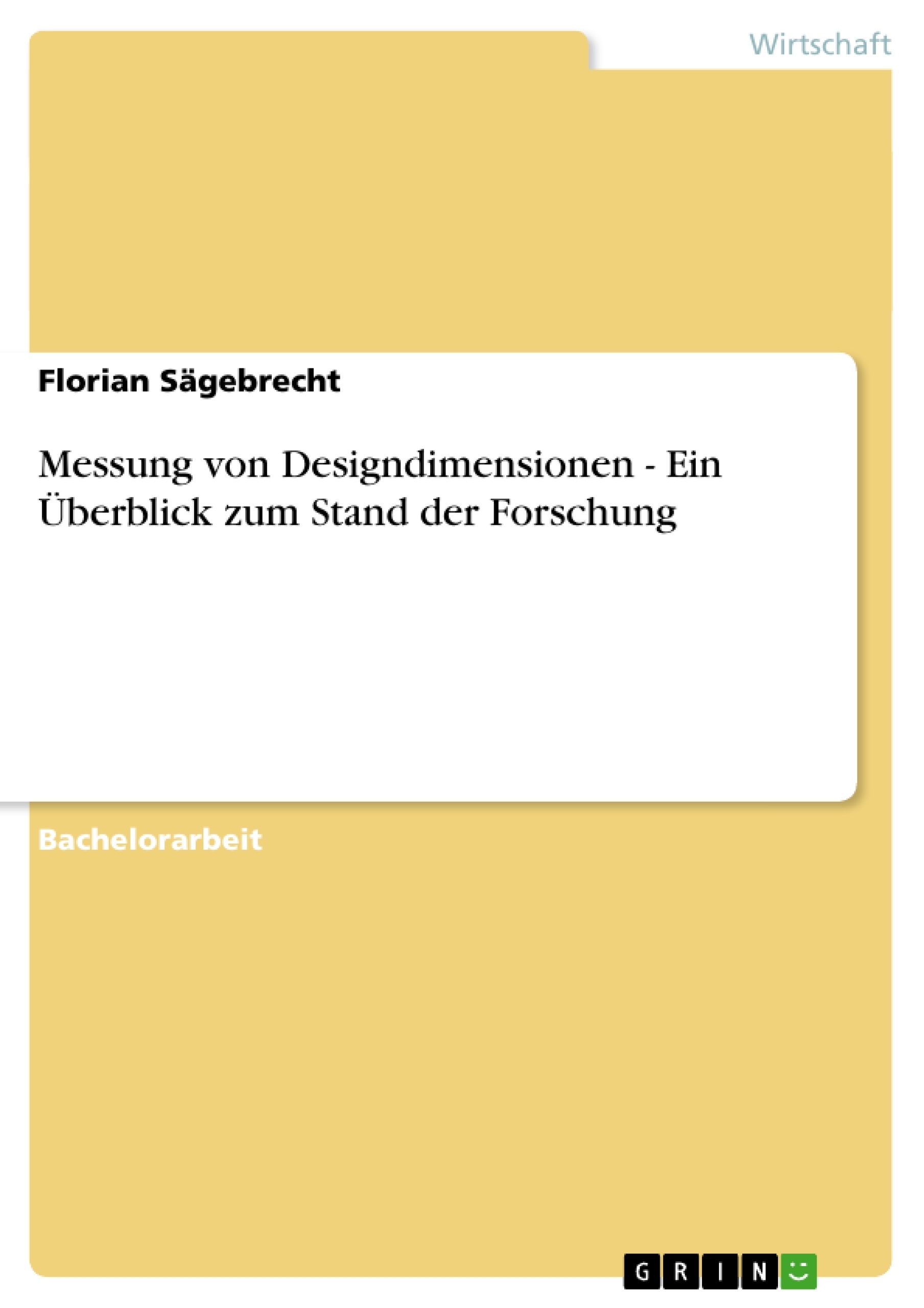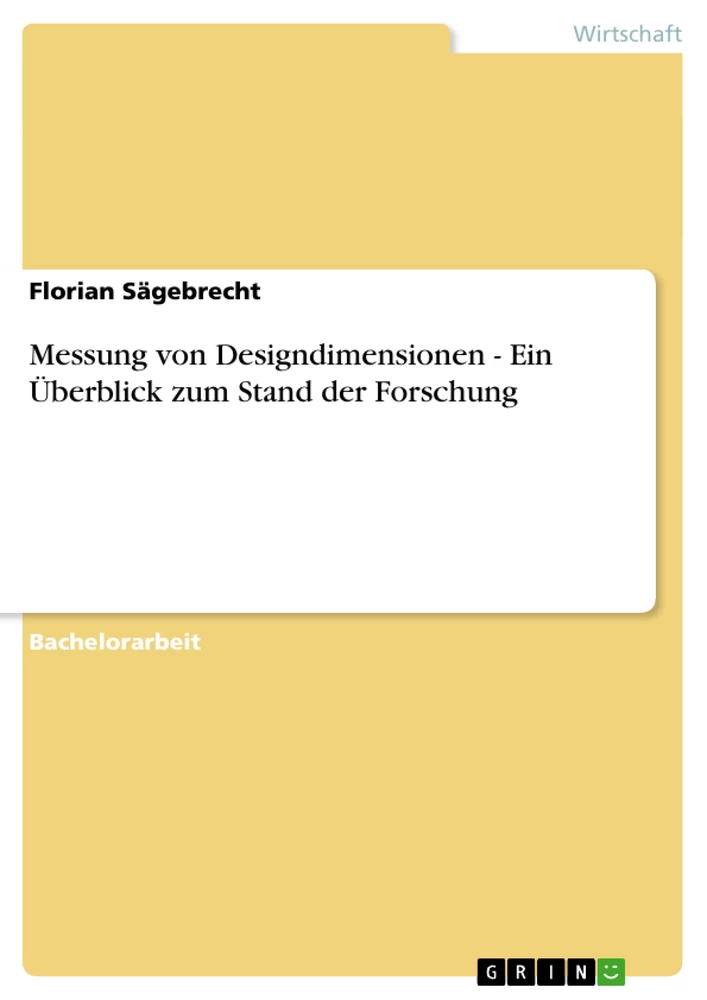
Messung von Designdimensionen - Ein Überblick zum Stand der Forschung
Bachelorarbeit, 2012
36 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Einleitung: Design als Gradmesser des Produktpotenzials
2 Der Einfluss des Designs als Teil der Produktinnovation
2.1 Definitionsauslegungen des Designbegriffs
2.1.1 Definition nach Luchs und Swan
2.1.2 Definition nach Bloch
2.2 Theoretische Einordnung des Produktdesigns
2.2.1 Design als Ergebnis
2.2.2 Design als Prozess
2.3 Wandel des Designs zum entscheidenden Strategiefaktor
3 Methoden der Designmessung und Designpotenzialmessung
3.1 Objektive Maße der Designmessung
3.1.1 Ähnlichkeitsmessung und Modularität
3.1.2 Prototypikalität und Komplexität
3.1.3 Grad der Designneuheit oder Designaktualität
3.2 Subjektive Maße der Designmessung
3.2.1 Rationaler, emotionaler und moralischer Wert in der Designwahrnehmung
3.2.2 Konsens in der Designwahrnehmung durch Design begleitende Faktoren
3.2.3 Wiedererkennungswert und kognitive, emotionale Wirkung
4 Relevante Erkenntnisse der Designmessung
4.1 Einfluss eines marktdominierenden Designs auf die Produkt- und Markenwahrnehmung
4.2 Performanceeinflüsse durch die strategische Nutzung der Produktgestaltung
5 Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Konzeptionelles Modell der Produktdesignforschung
Abbildung 2: Konzeptionelles Modell des Produktdesignprozesses als Teilstrategie
Abbildung 3: Beispiel eines gemorphten PKW (rechts) und charakteristischer Frontmerkmale eines VW Polo (links)
Abbildung 4: Rahmenbedingungen der Designwertbestimmung neuer Produkte
Abbildung 5: Zusammenhang zwischen der Designwahl im Produktentwicklungsprozess und der kognitiven und emotionalen Bewertungen des Kunden
Abbildung 6: Konzeptionelle Darstellung der Einflussfaktoren im Produktentwicklungsprozess und seiner leistungsabhängigen Variablen
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Messmethoden und Variablen zur Messung von Designdimensionen
1 Einleitung: Design als Gradmesser des Produktpotenzials
Design, als wesentliche Einflussgröße der Produktwahrnehmung und als Gradmesser für den Absatzerfolg eines Produktes, spielt seit jeher eine entscheidende Rolle in der Beziehung von Anbietern als Produzenten und Kunden als Konsumenten. Schon früh stellte sich die Bedeutung des Designs als entscheidender Treiber der Kaufwahrscheinlichkeit heraus, ob nun als Ausdruck des Könnens mittelalterlicher Handwerker, die sich durch die Qualität ihrer kirchlichen Ornamente von Mitbewerbern abzugrenzen versuchten, oder als Ausdruck von Luxus in Form stromlinienförmiger Lokomotiven der 1930er Jahre, die durch die bequeme Ausstattung ihrer Personenwagen und der ästhetischen Gestaltung ihrer Züge, ihren Reisenden Komfort und Schnelligkeit vermitteln sollten (vgl. Bloch, 2011, S. 378).
Die eindeutige Stellung des Designs im Produktions- oder Produktinnovationsprozess, wie auch all seine Facetten und Wirkungen im Zusammenhang mit kognitiven und psychologischen Reaktionen auf potenzielle Kunden, sind dabei erst zu einem geringen Teil erforscht. Was empfinden Kunden, wenn sie ein Produkt sehen und was ist es, das sie zum Kauf bewegt? Als sicher gilt dabei, dass Design einen maßgeblichen Einfluss auf die Wahrnehmung des Kunden hat, noch bevor er das eigentliche Produkt überhaupt auf andere Einflussgrößen wie Funktion, Qualität oder Sicherheit testen wird, denn das Design eines Produktes ist das, was ein potenzieller Käufer zuerst sieht und automatisch bewertet (vgl. Radford, Bloch, 2011, S. 208). Diesen Einfluss zu erkennen und die Dimensionen und Formen des Designs messbar und interpretierbar zu machen, würde für jedes Unternehmen einen Fortschritt im internen Produktinnovationsprozess bedeuten, da so Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen effizienter, zielgerichteter und kalkulierbarer würden, was wiederum einen positiven finanziellen Einfluss auf die Performance des Unternehmens haben kann. Die bisherigen wissenschaftlichen Untersuchungen zum Designeinfluss, zu möglichen Messmethoden und Messvariablen, sowie zum Einfluss des Designs auf mögliche wirtschaftliche Vor- oder Nachteile von Unternehmen, geben dabei einen Einblick, welche absatzrelevante Bedeutung die Produktgestaltung, aber auch die Gestaltung des Produktvermarktungsprozesses für den Produkt- und Unternehmenserfolg hat. So kann ein Designoptimum in der Produktpalette einer Unternehmung beispielsweise Verluste vermeiden und sogar neue Gewinne generieren (vgl. Freiesleben, 2010, S. 348). Entgegen allen wirtschaftlichen Prognosen kann es das Design als Alleinstellungsmerkmal sein, dass ein Produkt herausstellt und einem Unternehmen wie z. B. Apple trotz weltweiter Rezession, enorme Gewinne beschert und die Marke maßgeblich beeinflusst (vgl. Bloch, 2011, S. 378).
Diese Arbeit soll objektive und subjektive Maße für Design identifizieren, untersuchen und bewerten. Dabei sollen im theoretischen Teil der Arbeit unterschiedliche Darlegungen des Designbegriffes aus verschiedenen wissenschaftlichen Fachrichtungen zusammengetragen werden, um aus diesen bereits vorhandenen Definitionsansätzen eine allgemeingültige Definition des Begriffs Design abzuleiten. Des Weiteren versucht die Arbeit, die unterschiedlichen Facetten der Designforschung zu kategorisieren und theoretisch einzuordnen. Anhand verschiedener wissenschaftlicher Studien sollen Möglichkeiten zur Designmessung vorgestellt und daraus Maße sowohl in visueller, funktionaler Hinsicht, als auch kognitiver, psychologischer Art erkannt und herausgestellt werden. Die Arbeit schließt mit einer kritischen Auseinandersetzung zu dem aktuellen und in dieser Arbeit analysierten Forschungsstand und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsströme.
2 Der Einfluss des Designs als Teil der Produktinnovation
Wie in der Einleitung bereits erwähnt, ist die finale Rolle des Designs in diversen betriebsinternen Prozessen, sei es nun in der Produktentwicklung, dem Marketing oder dem Produktvertrieb, nur im Ansatz bestimmt. Gründe hierfür sind zum einen eben die durch die verschiedenen Funktionen im Unternehmen entstehenden Sichtweisen, z.B. aus Entwicklerperspektive oder Marketingperspektive. Beide Bereiche haben unterschiedliche Erwartungen und Anforderungen, verfolgen unterschiedliche Strategien im Entwicklungs- und Vermarktungsprozess und definieren ihre Ziele hinsichtlich der Produktgestaltung und des Produkterfolgs unterschiedlich (vgl. Luo, 2011, S. 128). Zum anderen ist sich die Forschung bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt uneinig, ob das Design in seiner Entwicklung und seinem Erscheinungsbild als Teil der Produktinnovation (vgl. Talke, Salomo, Wieringa, Lutz, 2009, S. 601), oder als eigenständiger Teil innovativer, visueller Gestaltung betrachtet werden kann (vgl. Radford, Bloch, 2011, S. 208).
Der folgende Teil der Arbeit, versucht eine allgemeingültige Definition des Designbegriffs zu entwickeln und diesen anhand der Eigenschaften theoretisch einzuordnen. Dabei sollen zunächst einige bereits niedergeschriebene Definitionen verglichen werden, um auch unterschiedliche begriffliche Auslegungen (Produktdesign, Konstruktionsdesign, u.a) voneinander abzugrenzen. Ergänzend wird im letzten Abschnitt dieses Kapitels die Entwicklung des Designs in Form des Produktdesigns zusammengefasst und näher beschrieben, um den Fokus der vorliegenden Arbeit herauszustellen und die Relevanz des Produktdesigns für die gesamte Designforschung zu unterstreichen.
2.1 Definitionsauslegungen des Designbegriffs
Der Duden beschreibt Design als Def. 1: „formgerechte und funktionale Gestaltgebung und daraus sich ergebende Form eines Gebrauchsgegenstandes o. Ä. “ (vgl. Duden online, 2012, http://www.duden.de/rechtschreibung/Design, abgerufen am 06. April 2012). Die Gestalt steht hierbei im Vordergrund, ohne jegliche Interaktion zwischen dem Produzenten, dem Produkt und dem Konsumenten. Doch kann Design ohne emotionalen Wert aus Sicht des Konsumenten betrachtet werden? Ist es die bloße Visualität, die ein Produkt attraktiv oder unattraktiv macht?
2.1.1 Definition nach Luchs und Swan
Luchs und Swan gehen in ihrem Artikel aus dem Jahr 2011 schon einen Schritt weiter und definieren nicht nur den Begriff Produktdesign, sondern auch in Anlehnung an die strategische Verwendung des Begriffs, den Produktdesignprozess (vgl. Luchs, Swan, 2011, S. 338). In ihrer Definition zum BegriffProduktdesign heißt es:
Def. 2: „Product design: the set ofproperties of an artifact, consisting of the discrete properties of the form (i.e., the aesthetics of the tangible good and/or service)and the function (i.e., its capabilities) together with the holistic properties of the integrated form and function. ”
Auch in dieser Definition verbirgt sich keine Interaktion zwischen dem Produktanbieter und dem Käufer, jedoch schlagen Luchs und Swan durch die Definition des Produktdesigns als Prozess eine Brücke zwischen rein gestalterischen Entwicklungsaspekten und Maßnahmen, die eine erfolgreiche Vermarktung der Ware möglich machen sollen. Hier heißt es:
Def. 3: “Product design process: the set of strategic and tactical activities, from idea generation to commercialization, used to create a product design.”
Diese Definition impliziert, dass sich die Gestaltung eines Produktes in Form und Funktion maßgeblich danach richtet, was sich verkauft und wie gut es sich verkauft (vgl. Luchs, Swan, 2011, S. 338). Die Wahrnehmung der Ware durch den Kunden spielt hier also eine entschei- dende Rolle und muss während des gesamten Prozesses berücksichtigt werden. Doch wie lässt sich Design als starres visuelles Merkmal eines Produktes und flexibles persönliches Empfinden des Kunden definieren?
2.1.2 Definition nach Bloch
Um den Antworten auf die vorangestellten Fragen näher zu kommen, blicken wir auf die Definition des Designbegriffs aus einem Artikel von Peter H. Bloch aus dem Jahr 2011. Hier heißt es:
Def. 4: “Design refers to the form characteristics of a product that provide utilitarian, hedonic, and semiotic benefits to the user. ”
Übersetzt bezieht sich demnach Design auf die Form eines Produktes oder einer Ware, die für den Konsumenten Vorteile hinsichtlich des Nutzens, emotionalen, gesellschaftsspezifischen Wertes und visuellen, ideellen Wertes bedeutet. Wir erkennen hier bereits eine Erweiterung der designbedingten Eigenschaften über die bloße formale und funktionale Gestaltung einer Ware hinaus. Laut Bloch soll der Begriff Form sich nicht nur an der geometrischen Gestaltung des Produktes messen, sondern auch an Faktoren wie Farbe, Geruch und Geräusch, was die unterschiedlichen Dimensionen des Designs bereits deutlich macht (vgl. Bloch, 2011, S. 378). Design ist demnach mehr als die bloße visuelle Gestaltung einer Ware. Es ist vielmehr eine Kombination verschiedener objektiver Eigenschaften, so genannter „hard facts“, wie dem äußeren Erscheinungsbild und der Funktion eines Produktes und dem inneren Empfinden und Bedürfnis des Konsumenten („soft facts“) hinsichtlich kognitiver, emotionaler und ideeller Wahrnehmungen und Wertevorstellungen (vgl. Luo, Kannan, Ratchford, 2008, S. 182).
Um final aus den vorangegangenen Definitionen eine allgemeingültige Definition des Begriffs Design bzw. Produktdesign zu entwickeln, bedarf es einer kurzen Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse. Design wird visuell bestimmt durch die Form und Funktion, die es verkörpert. Es entsteht aus der Kombination einer funktionsbedingten Form und absatzbedingten Ästhetik. Das Design muss beinhalten, was die Ware oder Dienstleistung für eine einwandfreie Funktion benötigt und was der Kunde durch seinen persönlichen Attraktivitätsanspruch wünscht. Es basiert auf einem differenzierten Wertempfinden von Produzenten und Konsumenten. Definieren lässt sich Design folglich:
Def. 5: “Design ist ein Maß für die Ausprägung von Form, Funktion und Ästhetik eines Produktes, unter Berücksichtigung objektiver, funktionsabhängiger Gestaltungsparameter und subjektiver, emotionaler Konsumentenbedarfe.“
2.2 Theoretische Einordnung des Produktdesigns
Über die theoretische Einordnung des Produktdesigns im betriebswirtschaftlichen Prozess herrscht in der Wissenschaft bis zum heutigen Tag kein Konsens. Uneinig sind sich die einzelnen Forschungsfelder vor allem in der Betrachtung des Produktdesigns als Teil des Produktentwicklungsprozesses. Historisch gesehen und wie in den Definitionen bereits dargestellt, differenziert man in der klassischen Betrachtung zwischen dem Produktdesign als Industriedesign, welcher Blick sich vorrangig auf die Produktform richtet und dem Produktdesign als Element der Konstruktionstechnik, wobei die Produktfunktion im Vordergrund steht (vgl. Luchs, Swan, 2011, S. 327). Der Eindruck, dass demnach das Produktdesign als Teildisziplin der Produktentwicklung betrachtet werden kann, verfestigt sich. Unklar bleibt dabei jedoch, woher die Produktentwicklung hinsichtlich der Produktgestaltung ihre Impulse bezieht. Ein Entwickler mag womöglich die technischen Anforderungen an ein Produkt kennen und auch die formalen Richtlinien, die für einen störungsfreien Betrieb des Produktes notwendig sind, doch woher weiß er, dass die nach formalen und funktionalen Maßstäben gestaltete Ware attraktiv für potenzielle Käufer and damit attraktiv und lohnend im Absatz ist? Entscheidend dabei ist die interdisziplinäre Betrachtung der Produktentwicklung oder auch des Produktinnovationsprozesses in Kombination mit anderen betriebsinternen Disziplinen und ihrem Einfluss. Eine relevante Schnittstelle bildet da die Beziehung zwischen Produktentwicklung und Marketing. Auch wenn nach Ansicht der aktuellen wissenschaftlichen Literatur ein großer Nachholbedarf im Bereich der Marketingforschung als wesentlicher Teil der Produktforschung und umgekehrt herrscht, so ist die gegenseitige Abhängigkeit deutlich, wobei das Produkt selbst seit jeher eine entscheidende Rolle im zentralen Konzept des Marketings, dem Marketing Mix, als eines der „4 P's“, einnimmt (vgl. Luchs, Swan, 2011, S. 328). Wo sich Ingenieure und Produktdesigner eher mit Aspekten wie der Ergonomie und Funktionserweiterung eines Produktes, oder Fragen der Ästhetik auseinandersetzen, da ist es die Aufgabe des Marketing im Vorfeld Marktchancen für das Produkt sowie Kundenbedarfe zu identifizieren, die letztendlich in die Produktentwicklungsmaßnahmen einfließen, um einen kommerziellen Erfolg des Produktes zu sichern (vgl. Veryzer, 2005, S. 24). Rücken wir den
Designaspekt wieder in den Mittelpunkt, dann stellt sich die Frage nach dem Einfluss des Marketings auf das Design und dessen finalen Einfluss auf die Produktentwicklung. Dieser Einfluss hat Bedeutung bei einem Blick in verschiedenste Branchen, z.B. der der Unterhaltungselektronik, wo viele Unternehmen sich kaum in ihren funktionellen Merkmalen unterscheiden, dafür jedoch umso mehr in ihrem einzigartigen Design konkurrieren. Dabei gilt das visuelle Erscheinungsbild eines Produktes als wichtigstes Mittel zur Differenzierung (vgl. Talke, Salomo, Wieringa, Lutz, 2009, S. 601f.). Bezogen auf den Innovationsgrad eines Produktes nimmt das Design in Form des Neuheitsgrades damit neben einer technologischen Dimension und einer marktbedingten, organisatorischen Dimension einen wichtigen Platz in der Beurteilung des Innovationsgrades eines Produktes und der Innovationsfähigkeit eines Unternehmens ein (vgl. Talke, Salomo, Wieringa, Lutz, 2009, S. 601ff.). Da diese Arbeit sich der Messung von Designdimensionen widmet, bleiben die anderen Dimensionen in den folgenden Kapiteln unberücksichtigt und sollen hier nur im Zusammenhang erwähnt werden. Vertiefend stellen die nächsten zwei Absätze zwei weitere unterschiedlich diskutierte Merkmale des Designs heraus, zum einen Design als Ergebnis, zum anderen Design als Prozess.
2.2.1 Design als Ergebnis
Die Frage nach der konzeptionellen Gestaltung des Designbegriffs bleibt offen. In der Wissenschaft herrscht selbst Verwirrung darüber, ob Design ein Ergebnis von etwas oder ein Prozess hinzu etwas ist (vgl. Bloch, 2011, S. 379f.). Um die Argumente hier zu sortieren und zu ergänzen, bedarf es einer Aufteilung der verschiedenen Sichtweisen hinsichtlich ihres Inhalts und ihrer Betrachtungsweise. Betrachtet man die Häufigkeit der Untersuchung des Begriffs Produktdesign in der Marketingliteratur, widmen sich lediglich 6 % von 121 ausgewählten Artikeln ausschließlich der Form eines Produktes, wobei sich 58 % mit der Funktion befassen und 36 % beide Eigenschaften kombinieren (vgl. Luchs, Swan, 2011, S. 336f.). Form und Funktion sind konkret definierte Eigenschaften eines Produktes oder einer Dienstleistung, die im Zustand der Betrachtung und/oder Verwendung als Ergebnis, also als starres Element wahrgenommen werden. Gemeint ist damit, dass z.B. ein Hammer, der als solcher erworben wurde, zum Einschlagen von Nägeln gedacht ist und als solcher verwendet wird. Die Form und Funktion ist dabei relativ starr und eindeutig und niemand würde auf die Idee kommen mit dem Hammer plötzlich Schrauben einzudrehen. Die Form des Hammers ist dabei Ergebnis der Funktion des Hammers, wobei der Aspekt Form folgt Funktion, sich nicht als geschriebenes Gesetz manifestieren soll (vgl. Luchs, Swan, 2011, S. 336f.). Man kann also sagen, Design lässt sich als Ergebnis definieren, wenn sich die Erwartungen in ein Produkt oder eine Dienstleistung in der Gestaltung und der Funktion des/der selbigen widerspiegelt und
sich daraus eine nutzbringende Verwendung ableitet, ohne dass die Umweltbedingungen, die zu der Entwicklung geführt haben, berücksichtigt werden.
2.2.2 Design als Prozess
Wie in den vorherigen Absätzen zu lesen ist, definiert sich das Produktdesign zu einem großen Teil über die Form und Funktion als visuelle und funktionale Faktoren. Wie entstehen jedoch Form und Funktion? Welcher Einfluss sorgt für genau diese Form, bei eben jener Funktion? Die Frage soll offenbleiben und nur verdeutlichen, dass Design auf weit mehr Variablen beruht, als jenen, in denen es visuell und funktional wahrgenommen wird. In Anlehnung an Luchs und Swan lässt sich Produktdesign als einer von drei Hauptprozessen im innerbetrieblichen Produktinnovationsrahmen identifizieren. Dabei verwertet und bewertet der Produktdesignprozess Erkenntnisse aus dem Bereich „Hintergrund und Strategie“, die alle umweltabhängigen Faktoren, wie die Unternehmensstrategie, Märkte und Zielgruppen beinhalten. Die Erkenntnisse des Produktdesignprozesses wiederum zeigen sich in den Reaktionen auf die Ergebnisse, z.B. im finanziellen Erfolg oder Misserfolg oder der Erschließung neuer Kundengruppen und Märkte (vgl. Luchs, Swan, 2011, 330ff). Die folgende Abbildung soll dies noch einmal verdeutlichen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Luchs, Swan, 2011, S. 330
Die Darstellung zeigt, dass für das Ergebnis in Form eines optimalen Produktdesigns, nicht nur die Wahl der Form und Funktion verantwortlich ist, sondern auch gesammelte Informationen, welche die Wahl der Form vorbereiten und bestimmen und analysierte Kundenbewertungen, die das gewählte Design erst als optimales Design werten und dem Unternehmen so einen messbaren Erfolg oder Misserfolg mitteilen. Hierin verbirgt sich ein entscheidender Hinweis für die Messung von Design. Der Gestaltung von Produkten wird zwar eine wesentliche Bedeutung beigemessenjedoch ist die Bewertung des optimalen Designs stets subjektiv und entscheidet sich an verschiedenen Punkten, je nach Bereich (Forschung & Entwicklung, Designabteilung, Marketing) des Unternehmens (vgl. Townsend, Montoya, Calantone, 2011, S. 374). Berücksichtigt man den Wert der Kundenmeinung und der Kaufentscheidung des Kunden für den Produktentwicklungsprozess, so wird deutlich, dass es eine elementare Abhängigkeit zwischen den Designmaßnahmen im Unternehmen und den Kaufmaßnahmen der Kunden am Markt gibt, da sich nur verkauft, was auch kommerziell lebensfähig ist (vgl. Townsend, Montoya, Calantone, 2011, S. 375f.). Die obige Darstellung ließe sich unter Berücksichtigung dieser Aspekte differenziert darstellen, als Zyklus gegenseitiger Abhängigkeiten, indem die Meinungen der Kunden und das Kaufinteresse maßgeblich für die zukünftige Strategie und den Produktentwicklungsprozess des betreffenden Unternehmens sind.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Luchs, Swan, 2011
Demnach beruhen eine Unternehmensstrategie und folglich auch eine Produktdesignstrategie (Ware und/oder Dienstleistung) auf externen Informationen zu einem Produkt, als Ergebnis interner Perspektiven und Entwicklungen. Nur die Verflechtung einzelner Disziplinen im Unternehmen und das Bewusstsein über den Produktdesignprozess als flexiblen, strategischen Prozess, eröffnen dem Unternehmen frühzeitig die Chance, den Wert des Produktes, den es
für Konsumenten am Markt hat, zu erkennen und den Entwicklungsprozess dementsprechend auszurichten. Eine radikale Abweichung in der Bewertung des Produktes durch den Produzenten gegenüber dem Konsumenten wäre grob nachteilig für den Entwicklungsprozess sowie den finanziellen Erfolg eines Produktes und ist daher unbedingt zu vermeiden (vgl. Rindova, Petkova, 2007, S. 219).
2.3 Wandel des Designs zum entscheidenden Strategiefaktor
Dem Design, als wesentlicher Einflussfaktor für den erfolgreichen Absatz von Waren und Dienstleistungen, wird eine stetig wachsende Bedeutung beigemessen. Dies zeigt sich nicht nur im Feld der Wirtschaft, sondern auch in der Fachliteratur der Wissenschaft im Bereich Marketing (Bindeglied zwischen Unternehmen und Märkten), in der ein signifikanter Anstieg relevanter Forschungsarbeiten zu verzeichnen ist (vgl. Bloch, 2011, S. 378f.). Produktdesign ist damit zu einem zentralen Element der Marketingforschung geworden, obwohl seine Effekte seit jeher einen entscheidenden Einfluss auf das Verhalten seiner Käuferschaft hatten. Waren es Menschenmengen in den USA der 50er Jahre, die jeden Herbst der Markteinführung der neusten Automobile aus Detroit entgegenfieberten, Jugendliche in den 60ern, die versuchten bei unzähligen Radiostationen die neusten Songs der Beatles zu ergattern oder Menschentrauben, die Tag und Nacht die Apple Stores belagern, um in den Genuss zukommen, als einer der Ersten das neue iPhone in den Händen zu halten, bei allen Beispielen war der Drang nach neuem und ansprechendem Design die treibende Kraft (vgl. Radford, Bloch, 2011, S. 208).
Dieses Bewusstsein ist wie anfangs erwähnt auch in die strategische Ausrichtung einzelner Unternehmen, aber auch ganzer Branchen gerückt, was bei einigen in einen rein auf Design ausgerichteten Produktentwicklungsansatz gemündet ist, im angelsächsischen Wirtschaftsraum auch „design driven innovation approach“ genannt (vgl. Talke, Salomo, Wieringa, Lutz, 2009, S. 601f.). Das Design der Produkte hat einen maßgeblichen Einfluss auf den Erfolg der Produkte und damit auch auf die Gestaltung der internen Unternehmensprozesse und der Unternehmenskommunikation. Den Unternehmen ist bewusst, dass das äußere Design das Erste ist, was Kunden wahrnehmen und bewerten, noch bevor sie ein Urteil zu den Funktionen des Produktes abgeben und das esjenes Design ist, was den Kunden einen nachhaltigen Eindruck des Produktes vermittelt und so auch Auswirkungen auf die Bewertung der gesamten Marke haben kann (vgl. Radford, Bloch, 2011, S. 208).
[...]
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Produktdesign ein entscheidender Strategiefaktor?
Design ist oft das erste, was Kunden wahrnehmen. Es beeinflusst die Kaufwahrscheinlichkeit maßgeblich, noch bevor Funktionen getestet werden.
Wie kann man Design objektiv messen?
Durch Maße wie Ähnlichkeitsmessung, Modularität, Prototypikalität, Komplexität sowie den Grad der Designneuheit.
Welche subjektiven Maße für Design gibt es?
Dazu zählen die emotionale Wirkung, der Wiedererkennungswert sowie der kognitive Konsens in der Wahrnehmung durch den Kunden.
Was ist der Unterschied zwischen Design als Prozess und als Ergebnis?
Design als Prozess umfasst alle strategischen Aktivitäten von der Idee bis zur Vermarktung; Design als Ergebnis ist die finale Gestalt des Produkts.
Welchen Einfluss hat Design auf die Markenwahrnehmung?
Ein marktdominierendes Design (wie bei Apple oder VW) kann die Markenidentität stärken und trotz Krisen Gewinne generieren.
Details
- Titel
- Messung von Designdimensionen - Ein Überblick zum Stand der Forschung
- Hochschule
- Universität Hamburg (Institut für Marketing und Medien)
- Note
- 1,7
- Autor
- Florian Sägebrecht (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2012
- Seiten
- 36
- Katalognummer
- V196036
- ISBN (eBook)
- 9783656221128
- Dateigröße
- 775 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Design objektives Design subjektives Design Designdimensionen Morphing Designforschung Prototypikalität dominantes Design
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 17,99
- Arbeit zitieren
- Florian Sägebrecht (Autor:in), 2012, Messung von Designdimensionen - Ein Überblick zum Stand der Forschung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/196036
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-