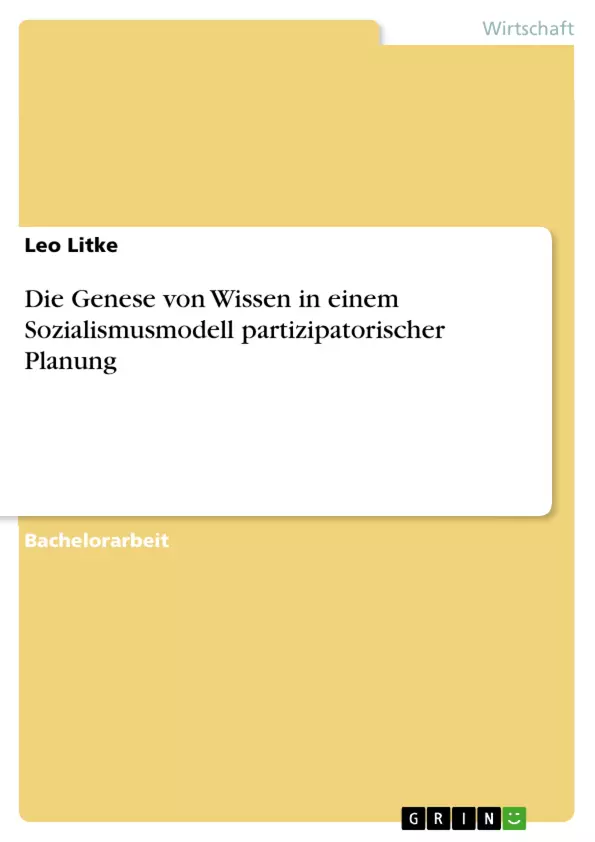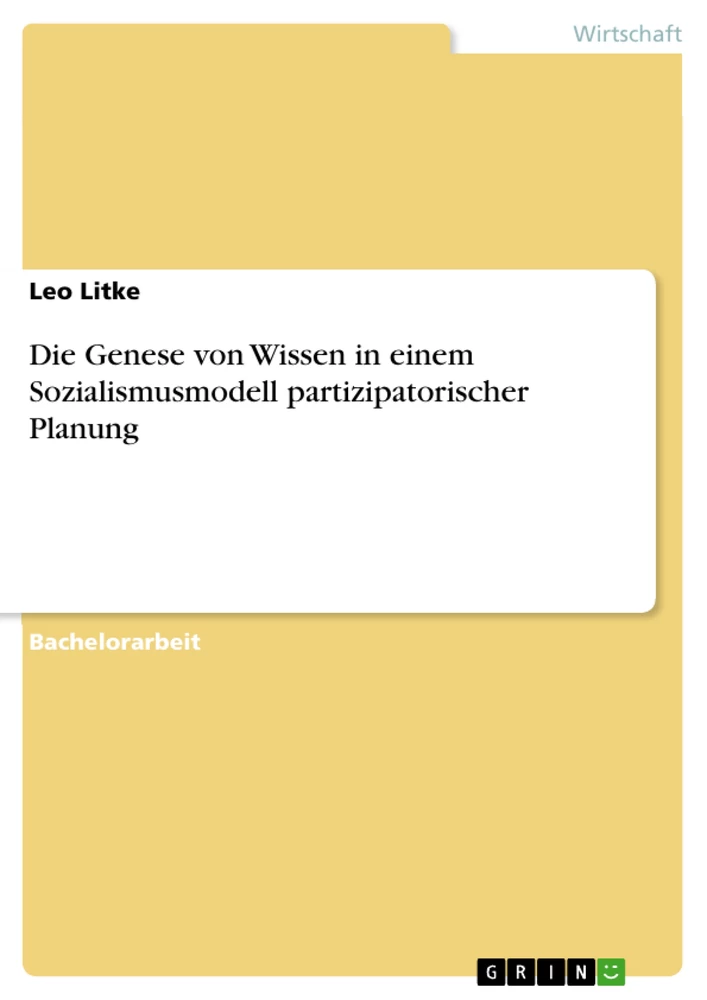
Die Genese von Wissen in einem Sozialismusmodell partizipatorischer Planung
Bachelorarbeit, 2010
45 Seiten, Note: 2,7
Leseprobe
Inhalt
I. Abbildungsverzeichnis
II. Abkürzungsverzeichnis
1. Motivation und Fragestellung
2. Vorgeschichte der Wirtschaftsrechungsdebatte
3. Zwei Hypothesen über Information und Wissen
3.1. Die These von Lange
3.2. Die Antithese von Hayek
4. Partizipatorische Planung
4.1. Überblick über das Modell von Adaman & Devine
4.2. Die Genese von Informationen und Wissen
4.3. Kritik und Antikritik
5. Schlusswort
IV. Literaturverzeichnis
V. Internetquellenverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Arbeit zur Genese von Wissen?
Die Arbeit diskutiert die ökonomische Durchführbarkeit des Sozialismus anhand eines Modells der partizipatorischen Planung von Adaman & Devine.
Welche zentralen Hypothesen werden gegenübergestellt?
Es werden die Thesen von Lange (pro Sozialismus) und die Antithese von Hayek (über Information und Wissen) verglichen.
Was ist das Hauptargument gegen partizipatorische Wirtschaft?
Die Arbeit argumentiert, dass in einem solchen System erhebliche Probleme bei der Entstehung und Verarbeitung von Informationen auftreten.
Wer sind Adaman & Devine?
Es handelt sich um Theoretiker, die ein spezifisches Modell für ein partizipatorisches Wirtschaftssystem entwickelt haben, das in dieser Arbeit kritisch beleuchtet wird.
Welche Rolle spielt die Wirtschaftsrechnungsdebatte?
Diese historische Debatte des 20. Jahrhunderts bildet den Kontext für die Frage, ob eine sozialistische Wirtschaft ohne Marktpreise effizient funktionieren kann.
Details
- Titel
- Die Genese von Wissen in einem Sozialismusmodell partizipatorischer Planung
- Hochschule
- Universität Passau (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät)
- Note
- 2,7
- Autor
- Leo Litke (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2010
- Seiten
- 45
- Katalognummer
- V196218
- ISBN (eBook)
- 9783656221746
- ISBN (Buch)
- 9783656222262
- Dateigröße
- 646 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- genese wissen sozialismusmodell planung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 31,99
- Arbeit zitieren
- Leo Litke (Autor:in), 2010, Die Genese von Wissen in einem Sozialismusmodell partizipatorischer Planung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/196218
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-