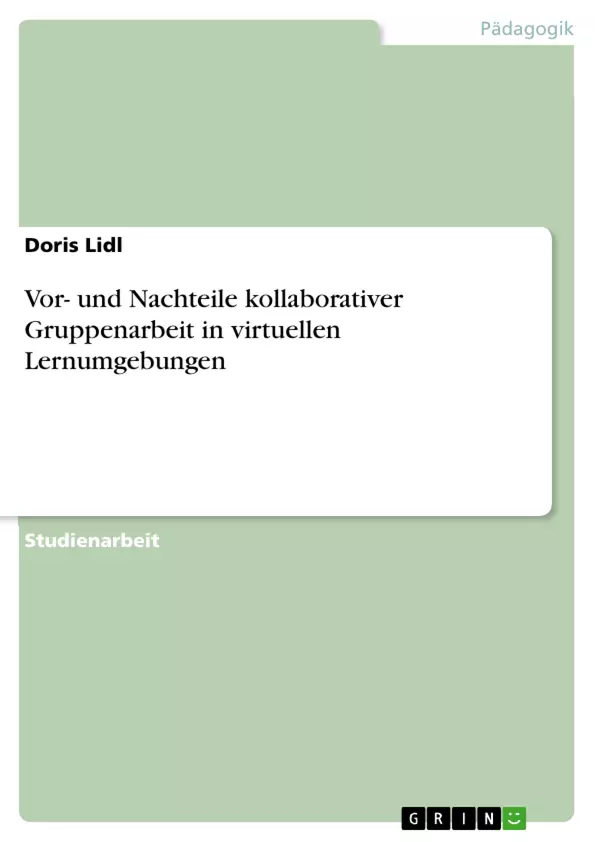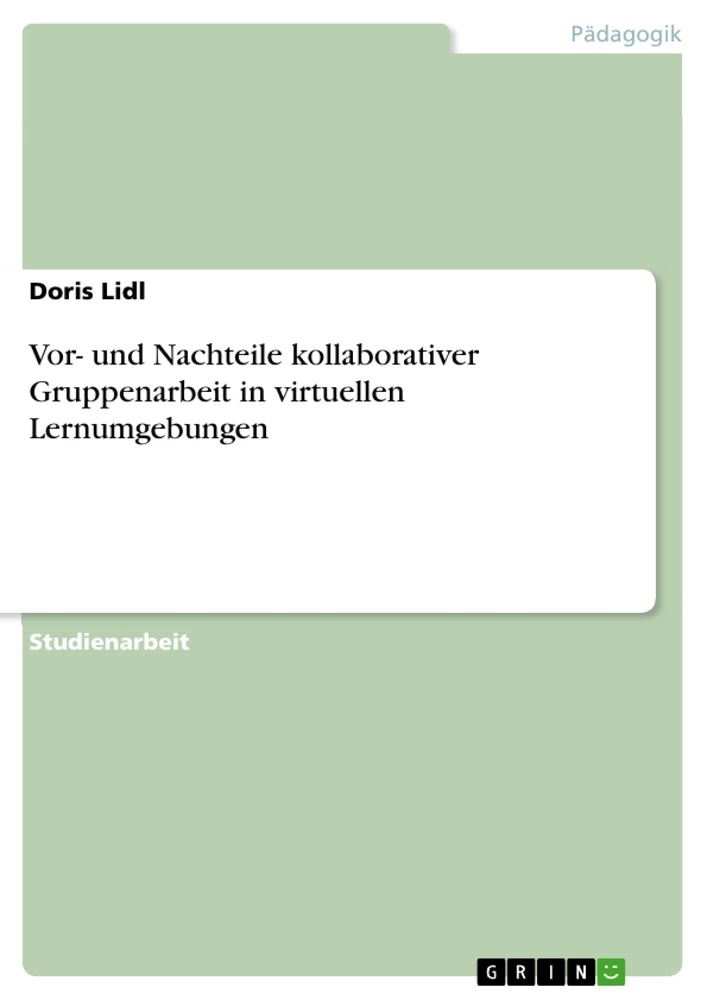
Vor- und Nachteile kollaborativer Gruppenarbeit in virtuellen Lernumgebungen
Hausarbeit, 2012
32 Seiten, Note: 2,0
Leseprobe
INHALTSVERZEICHNIS
1 EINLEITUNG
2 COMPUTERVERMITTELTE KOMMUNIKATION
2.1. Computervermittelte Kommunikation im Lernkontext
2.2. Das Vier-Seiten-Modell der Kommunikation in der cvK
3 DIE GRUPPE
3.1. Besonderheiten virtueller Gruppen
3.2. Gruppenstruktur
3.3. Gruppenphasen
4 LERNEN IN DER GRUPPE- CSCL
4.1. Formen kollaborativen Lernens
4.2. Lernziele
4.3. Anforderungen an den Lernenden
5 DIDAKTISCHE KONZEPTION
5.1. Problemorientiertes Lernen
5.2. Communities of Practice
5.3. Blended-Learning
5.4. Lernaufgaben
5.5. Evaluation
6 ANFORDERUNGEN AN LEHRENDE
6.1. Cognitive-, Social- und Teaching Presence
6.2. Moderation
7 BEWERTUNG CSCL
8 FAZTT
LITERATUR
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Vorteile kollaborativen Lernens in virtuellen Umgebungen?
Es ermöglicht zeitlich und räumlich flexibles Lernen, fördert soziale Interaktion und unterstützt den Erwerb von Kompetenzen, die über reines Fachwissen hinausgehen.
Was bedeutet CSCL?
CSCL steht für "Computer Supported Collaborative Learning" und bezeichnet das gemeinsame Lernen in Gruppen, das durch digitale Medien unterstützt wird.
Welche Rolle spielt das Vier-Seiten-Modell von Schulz von Thun?
Es wird genutzt, um die Besonderheiten und potenziellen Missverständnisse in der computervermittelten Kommunikation (cvK) innerhalb von Lerngruppen zu analysieren.
Welche Anforderungen werden an die Lehrenden gestellt?
Lehrende müssen eine "Teaching Presence" zeigen, den Lernprozess moderieren und die Aufgaben so konzipieren, dass sie zur Zusammenarbeit anregen.
Was ist "Blended Learning"?
Es ist ein integriertes Lernkonzept, das Präsenzveranstaltungen mit E-Learning-Phasen kombiniert, um die Vorteile beider Welten zu nutzen.
Details
- Titel
- Vor- und Nachteile kollaborativer Gruppenarbeit in virtuellen Lernumgebungen
- Hochschule
- FernUniversität Hagen (MA Bildung und Medien - eEducation)
- Veranstaltung
- (Bildungswissenschaftliche) Voraussetzungen für den Einsatz von neuen Lehr- und Lernformen
- Note
- 2,0
- Autor
- Doris Lidl (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2012
- Seiten
- 32
- Katalognummer
- V196938
- ISBN (eBook)
- 9783656230373
- ISBN (Buch)
- 9783656231547
- Dateigröße
- 652 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- vor- nachteile gruppenarbeit lernumgebungen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 20,99
- Arbeit zitieren
- Doris Lidl (Autor:in), 2012, Vor- und Nachteile kollaborativer Gruppenarbeit in virtuellen Lernumgebungen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/196938
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-