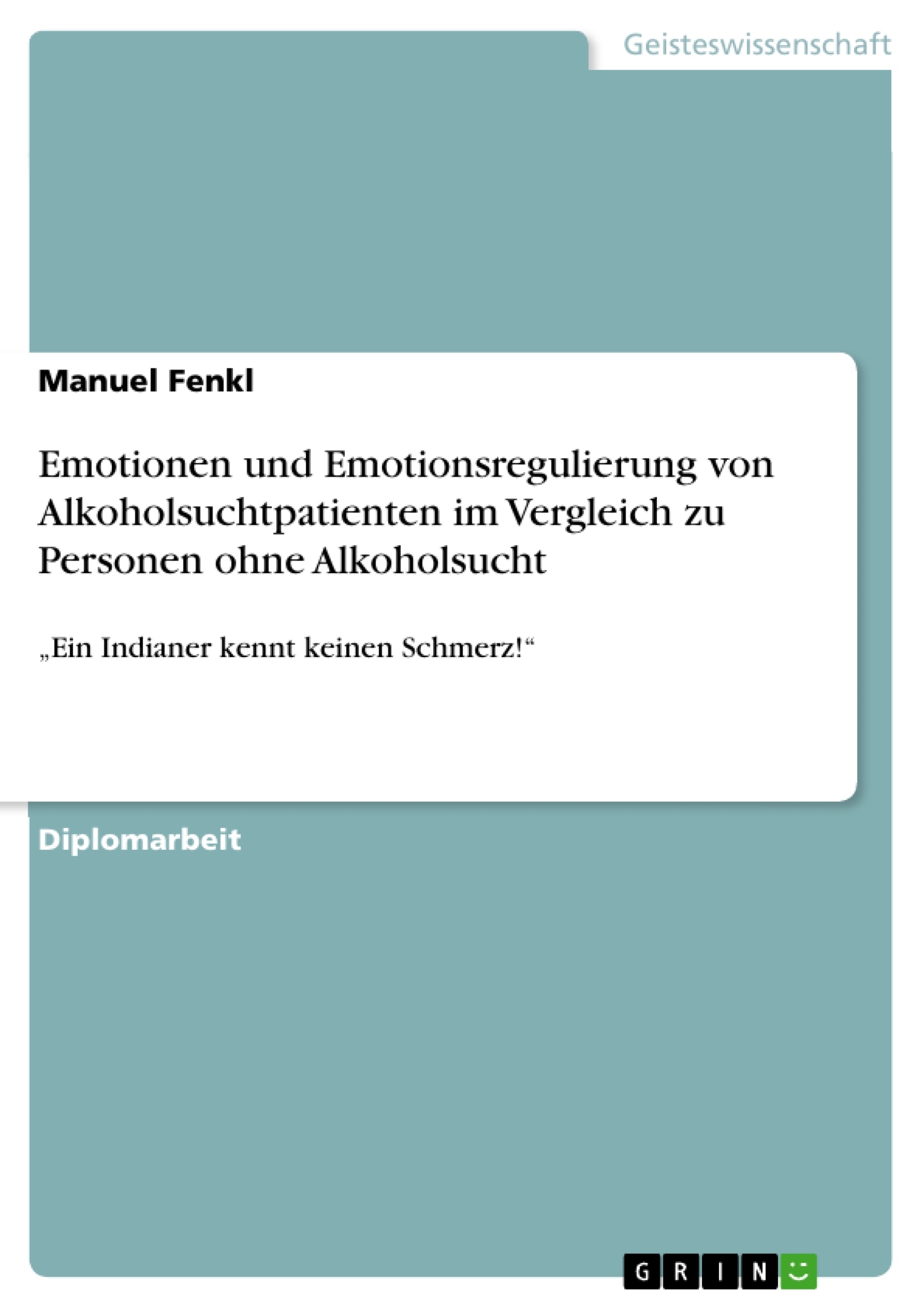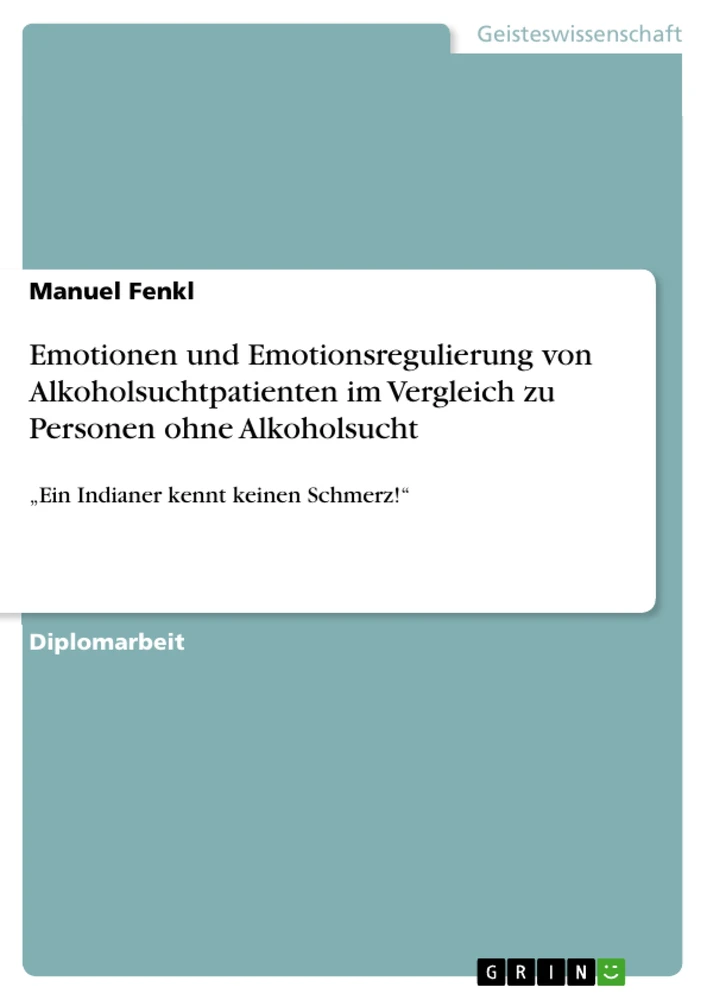
Emotionen und Emotionsregulierung von Alkoholsuchtpatienten im Vergleich zu Personen ohne Alkoholsucht
Diplomarbeit, 2011
133 Seiten, Note: 1
Psychologie - Klinische Psychologie, Psychopathologie, Prävention
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Vorwort
- 1.2 Was soll gezeigt werden
- 2. Emotionen
- 2.1 Begriffe der Emotionspsychologie
- 2.2 Definition von Emotionen und deren Komponenten
- 2.3 Gute Emotion versus schlechte Emotion
- 2.4 Emotionsdimensionen/ Klassifikation von Emotionen
- 2.5 Zur Universalität von Emotionen
- 2.6 Emotionstheorien
- 2.6.1 Aus funktionalistischer und evolutionspsychologischer Sicht
- 2.6.2 Aus kognitivistischer, konstruktivistischer, motivationaler Sicht, Appraisaltheorie nach Lazarus
- 2.6.3 Systemisch-Integrative Bestandsaufnahme und Schlussfolgerung nach Hühlshoff und Holodynski
- 2.7 Kognition und Emotion
- 3. Emotionsregulierung
- 3.1 Einleitung und historischer Abriss
- 3.2 Kultur und Sozialisation von Emotionen
- 3.3 Von der interpersonalen zur intrapersonalen Regulation
- 3.4 Theorien der Emotionsregulationen
- 3.5 Emotionsregulation und Gesundheit
- 3.6 Dysfunktionale Emotionsregulation
- 3.7 Beschreibung einiger relevanter Basisemotionen
- 4. Neuere Forschung zur Emotionsregulation von Alkoholabhängigen
- 5. Alkoholismus
- 5.1 Alkoholgebrauch, Alkoholmissbrauch, Alkoholabhängigkeit
- 5.1.1 Formen des Suchtverhaltens
- 5.2 Bedingungsgefüge des Alkoholismus
- 5.2.1 Allgemeines
- 5.2.2 Droge Alkohol
- 5.2.3 Individuum
- 5.2.4 Umweltfaktoren
- 6. Suchttheorien
- 6.1 Annahmen der Verhaltenstherapie
- 6.2 Eine Interaktionstheoretische Sichtweise
- 7. Wissenschaftliche Untersuchung
- 7.1 Standortbestimmung
- 8. Fragestellungen der Untersuchung
- 8.1 Die Fragestellung nach der Erlebenshäufigkeit von Emotionen
- 8.2 Die Fragestellung nach der Akzeptanz und Ablehnung von Emotionen
- 8.3 Die Fragestellung nach dem Umgang mit Emotionen
- 8.4 Die Fragestellung nach der Alkoholiker Persönlichkeit
- 9. Untersuchungsmethodik
- 9.1 Untersuchungsablauf
- 9.2 Untersuchungsinstrument
- 9.3 Beschreibung der verwendeten statistischen Verfahren
- 10. Darstellung der Untersuchungsergebnisse
- 10.1 Soziodemographie der Teilnehmer
- 10.2 Erlebenshäufigkeit von Emotionen
- 10.3 Akzeptanz und Ablehnung von Emotionen
- 10.4 Dysfunktionaler Umgang mit Emotionen
- 10.5 Alkohol und Persönlichkeit
- 11. Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse
- 12. Persönliche Note
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Emotionen und deren Regulierung bei Alkoholsuchtpatienten im Vergleich zu Personen ohne Alkoholsucht. Ziel ist es, Unterschiede im Erleben, der Akzeptanz und dem Umgang mit Emotionen aufzuzeigen und den Einfluss von Alkohol auf die Emotionsregulation zu beleuchten.
- Emotionen und deren Komponenten bei Alkoholabhängigen und Nicht-Alkoholabhängigen
- Theorien der Emotionsregulation und deren Relevanz für die Alkoholsucht
- Dysfunktionale Emotionsregulation im Kontext von Alkoholismus
- Der Einfluss von Alkohol auf die Persönlichkeit und den Umgang mit Emotionen
- Vergleichende Analyse der Emotionsregulierungsstrategien beider Gruppen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der Emotionsregulation und deren Bedeutung im Kontext von Alkoholismus ein. Das Sprichwort "Ein Indianer kennt keinen Schmerz" dient als Metapher für die unterschiedlichen Fähigkeiten im Umgang mit Emotionen. Die Arbeit stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Unterschieden in der Emotionsregulation zwischen Alkoholabhängigen und Nicht-Alkoholabhängigen und deren Zusammenhängen.
2. Emotionen: Dieses Kapitel liefert einen umfassenden Überblick über die Emotionspsychologie. Es werden verschiedene Definitionen von Emotionen, deren Komponenten und Klassifikationen diskutiert, verschiedene Emotionstheorien (funktionalistische, kognitivistische, systemisch-integrative Ansätze) vorgestellt und der Zusammenhang zwischen Kognition und Emotion beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Beschreibung von Emotionen und deren theoretischen Grundlagen, welche für das Verständnis der späteren empirischen Untersuchung essenziell sind.
3. Emotionsregulierung: Das Kapitel widmet sich der Emotionsregulierung, beginnend mit einem historischen Abriss und der Berücksichtigung von kulturellen und sozialen Aspekten. Es werden verschiedene Theorien der Emotionsregulation und deren Einfluss auf die Gesundheit behandelt, wobei dysfunktionale Regulationsmuster im Detail betrachtet werden. Die Beschreibung relevanter Basisemotionen bildet die Grundlage für den Vergleich der beiden Gruppen in der späteren Untersuchung.
4. Neuere Forschung zur Emotionsregulation von Alkoholabhängigen: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zur Emotionsregulation bei Alkoholabhängigen. Es werden relevante Studien und deren Ergebnisse zusammengefasst, um den theoretischen Rahmen für die eigene Untersuchung zu schaffen. Die bisherigen Forschungsergebnisse liefern wichtige Hinweise auf mögliche Unterschiede zwischen den beiden Gruppen.
5. Alkoholismus: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem Phänomen des Alkoholismus. Es werden die verschiedenen Stadien des Alkoholkonsums (Alkoholgebrauch, -missbrauch, -abhängigkeit) definiert und die komplexen Faktoren, die zum Entstehen und Aufrechterhalten der Alkoholsucht beitragen, analysiert. Dazu gehören individuelle, soziale und umweltbedingte Faktoren. Das Verständnis der Alkoholsucht ist essentiell für die Interpretation der Ergebnisse der empirischen Untersuchung.
6. Suchttheorien: Dieses Kapitel stellt verschiedene Suchttheorien vor, insbesondere verhaltenstherapeutische und interaktionistische Perspektiven, um die Entwicklung und Aufrechterhaltung von Abhängigkeiten zu erklären. Die Vorstellung unterschiedlicher theoretischer Ansätze ermöglicht eine differenzierte Betrachtung des Alkoholismus und der damit verbundenen Emotionsregulationsprobleme.
Schlüsselwörter
Alkoholsucht, Emotionsregulation, Emotionen, Dysfunktionale Emotionsregulation, Verhaltenstherapie, Interaktionstheorie, Alkoholabhängigkeit, Persönlichkeit, Empirische Untersuchung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Emotionsregulation bei Alkoholabhängigen
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Emotionsregulation bei Alkoholabhängigen im Vergleich zu nicht-Alkoholabhängigen. Im Fokus stehen Unterschiede im Erleben, der Akzeptanz und dem Umgang mit Emotionen sowie der Einfluss von Alkohol auf die Emotionsregulation.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte der Emotionspsychologie, darunter Definitionen von Emotionen, Emotionstheorien (funktionalistisch, kognitivistisch, systemisch-integrativ), Theorien der Emotionsregulation, dysfunktionale Emotionsregulation, Alkoholismus (einschliesslich Suchttheorien), und die Methodik einer empirischen Untersuchung zum Thema.
Welche Forschungsfragen werden gestellt?
Die Arbeit untersucht die Erlebenshäufigkeit von Emotionen, die Akzeptanz und Ablehnung von Emotionen, den Umgang mit Emotionen bei beiden Gruppen und den Zusammenhang zwischen Alkoholismus und Persönlichkeit.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Arbeit beinhaltet eine empirische Untersuchung mit der Beschreibung der Untersuchungsmethodik, des Ablaufs, der verwendeten Instrumente und der statistischen Verfahren.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse umfassen die soziodemografische Beschreibung der Teilnehmer, die Ergebnisse zu den Forschungsfragen (Erlebenshäufigkeit, Akzeptanz/Ablehnung, Umgang mit Emotionen) und den Zusammenhang zwischen Alkohol und Persönlichkeit. Eine Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse wird ebenfalls gegeben.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, Emotionen, Emotionsregulation, aktuelle Forschung zur Emotionsregulation bei Alkoholabhängigen, Alkoholismus, Suchttheorien, wissenschaftliche Untersuchung, Fragestellungen der Untersuchung, Untersuchungsmethodik, Darstellung der Untersuchungsergebnisse, Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse und eine persönliche Note. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detaillierter beschrieben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Alkoholsucht, Emotionsregulation, Emotionen, Dysfunktionale Emotionsregulation, Verhaltenstherapie, Interaktionstheorie, Alkoholabhängigkeit, Persönlichkeit und Empirische Untersuchung.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist es, Unterschiede in der Emotionsregulation zwischen Alkoholabhängigen und Nicht-Alkoholabhängigen aufzuzeigen und den Einfluss von Alkohol auf die Emotionsregulation zu beleuchten.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema einführt und die Forschungsfrage formuliert. Es folgen Kapitel zur Theorie (Emotionen, Emotionsregulation, Alkoholismus, Suchttheorien), der Methodik der empirischen Untersuchung, der Darstellung der Ergebnisse und schliesslich der Zusammenfassung und Interpretation.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Die Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum, insbesondere an Personen, die sich mit den Themen Alkoholismus, Emotionspsychologie und Emotionsregulation auseinandersetzen.
Details
- Titel
- Emotionen und Emotionsregulierung von Alkoholsuchtpatienten im Vergleich zu Personen ohne Alkoholsucht
- Untertitel
- „Ein Indianer kennt keinen Schmerz!“
- Hochschule
- Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (Psychologie)
- Note
- 1
- Autor
- Manuel Fenkl (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 133
- Katalognummer
- V196953
- ISBN (eBook)
- 9783656231011
- ISBN (Buch)
- 9783656231073
- Dateigröße
- 3587 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- In der vorgestellten Arbeit werden die dysfunktionalen Formen der Emotionsregulation (Bewältigungsstrategien) von Alkoholsuchtpatienten mit denen von Personen ohne Alkoholsucht verglichen
- Schlagworte
- emotionen emotionsregulierung alkoholsuchtpatienten vergleich personen alkoholsucht indianer schmerz
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 15,99
- Preis (Book)
- US$ 25,99
- Arbeit zitieren
- Manuel Fenkl (Autor:in), 2011, Emotionen und Emotionsregulierung von Alkoholsuchtpatienten im Vergleich zu Personen ohne Alkoholsucht, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/196953
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-