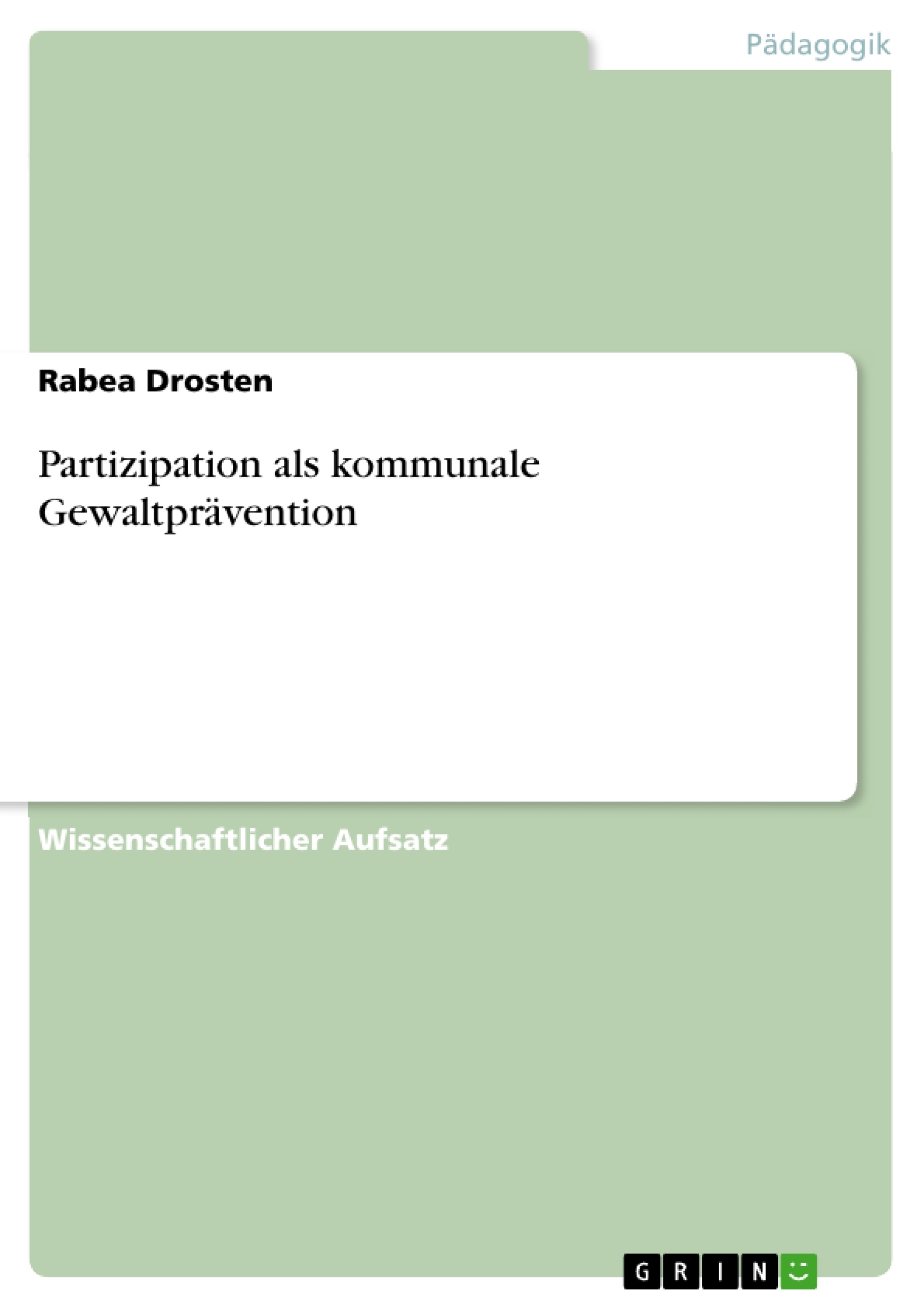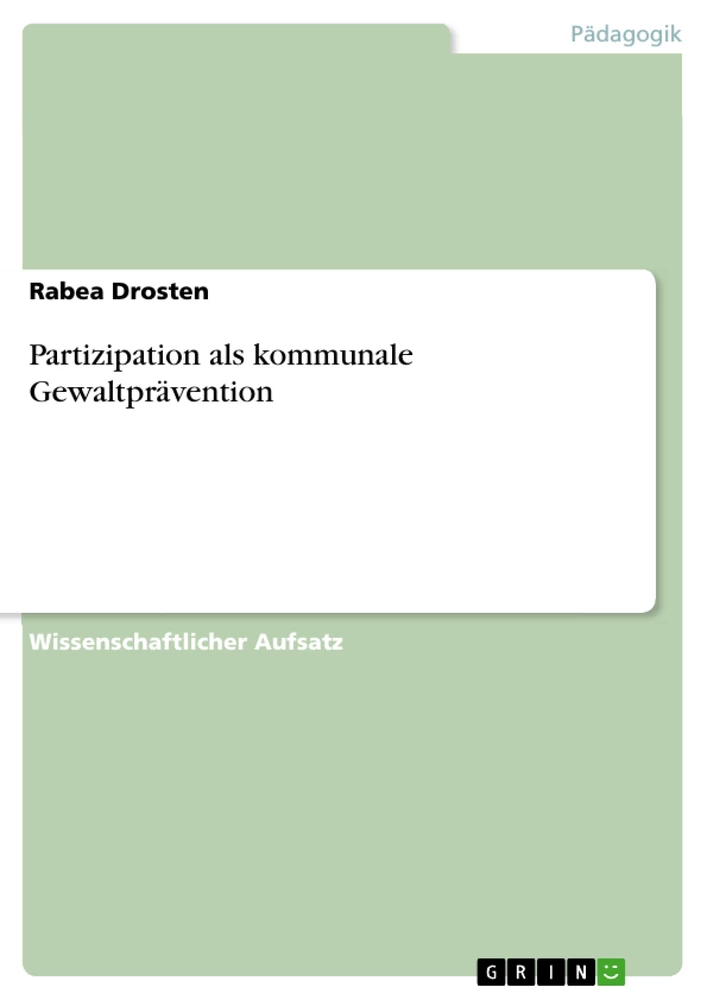
Partizipation als kommunale Gewaltprävention
Wissenschaftlicher Aufsatz, 2012
29 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
1. Begriffsbestimmungen
1.1 Was ist Gewalt?
1.2 Was ist Gewaltprävention?
1.3 Was ist Partizipation
2. Wie kann Partizipation der Entstehung von personaler und interpersonaler Gewalt bei Kindern und Jugendlichen vorbeugen?
3. Partizipationsniveaus
3.1 Die Partizipationsleiter
3.2 Die Partizipationslevel: Intensität der Beteiligung
3.2.1 Mitwirkung am Willensbildungs- und Entscheidungsprozess
3.2.2 Mitbestimmungs- und Selbstbestimmungsrechte: Entscheidungsrechte
3.3 Inhaltstypen von Partizipationsgegenständen
3.4 Sieben Grundformen der Beteiligung
4. Entwicklungspsychologische Grundlagen: Ab wann können Kinder mitentscheiden?
5. Partizipation als Teil kommunaler Gewaltpräventionsstrategien
6. Schlussbetrachtung
II. Literaturverzeichnis
I. Einleitung
Gewalt hat viele Gesichter und ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. Es gibt „ Gewalt in der Familie, Gewalt in der Erziehung, häusliche Gewalt, Gewalt in der vorschulischen Erziehung, in der Schule und auf Schulwegen, interethnische Gewalt, Gewalt gegen Minderheiten, Gewalt in Nachbarschaften“ (Gugel 2006: 227). Was genau unter Gewalt zu verstehen ist, lässt sich nur schwer definieren und der öffentliche Diskurs über Gewalt und Gewaltprävention weicht stark ab von selbigem in der Wissenschaft. Während sich die wissenschaftliche Seite nur sehr vorsichtig und abwägend über Ursachenanalysen und Präventionsvorschläge äußert, braucht es in der Praxis klare Orientierungen und Strategien, um handlungsfähig zu sein.
Ein Patentrezept zur endgültigen Lösung des Gewaltproblems wird es wahrscheinlich niemals geben, doch es gibt die Möglichkeit, auf wichtige Erkenntnisse und Erfahrungen zurückzugreifen, um begründetes und effektiv gewaltpräventives Handeln zu ermöglichen und passgenaue Präventionsstrategien auf kommunaler Ebene zu entwickeln. Bei der Entwicklung solcher Strategien ist zu beachten, dass es bei Gewalt und Gewaltprävention nicht nur um die individuelle Verhaltensdimension geht, sondern dass insbesondere auch gesellschaftliche Verhältnisse berücksichtigt werden müssen (vgl. ebd.: 10). In diesem Sinne muss Gewaltprävention immer auch im Kontext von Demokratisierung und Zivilisierung gesehen werden. Um Demokratie jedoch auch im Nahraum von Kindern und Jugendlichen erfahrbar und greifbar zu machen, braucht es eine Kultur der Beteiligung und Partizipation. Dementsprechend kann Partizipation als elementarer Bestandteil einer nachhaltig ausgerichteten Gewaltpräventionsstrategie gesehen werden.
Tatsächlich sind wir in der Praxis jedoch noch weit davon entfernt, sagen zu können, dass wir unsere Kinder und Jugendlichen in angemessener Weise an Entscheidungen im öffentlichen Raum beteiligen. Die Kinder, die sich in der Schule, in Vereinen oder in der Kommunalpolitik einmischen, sind meist nur bestimmte Kinder, die zum größten Teil aus Akademikerfamilien stammen. Eine Studie des Deutschen Kinderhilfswerks hat den Lebenslauf von einigen, besonders stark gesellschaftlich engagierten Bürgern untersucht, um herauszufinden, wie dieses Engagement entstanden sein könnte. Die Ergebnisse bestätigen, dass Partizipation stark mit dem Bildungsgrad der aktiven Person korreliert und etwa 90% der befragten, gesellschaftlich engagierten Menschen einen Hochschulabschluss haben (vgl. Deutsches Kinderhilfswerk e.V. 2007: 37). Sich engagieren wollen, hängt somit auch stark vom sich engagieren können, also von der Bildung ab.
Wenn wir jedoch Partizipation auch als Chance zur Stärkung von Demokratie- und Konfliktfähigkeit und damit einhergehend zur Prävention von Gewalt begreifen, müssen wir es schaffen, auch solche Kinder zu beteiligen, die bislang wenig oder keinen Einfluss nehmen (können). Aus diesem Grund plädiert die vorliegende Arbeit dafür, dass sich Kommunen stärker dafür einsetzten, geeignete Strategien und Mittel zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an den sie betreffenden Angelegenheiten im Stadtteil zu entwickeln. Im Zentrum dieser Arbeit steht deshalb die Frage, wie Partizipation von Kindern und Jugendlichen aussehen kann, welche verschiedenen Formen und Niveaustufen es bei der Beteiligung gibt und ab wann Kinder entwicklungspsychologisch in der Lage sind, mitzuentscheiden. Dem vorausgehend soll jedoch zunächst geklärt werden, was unter den Begriffen Gewalt, Gewaltprävention und Partizipation genau zu verstehen ist und inwiefern die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gewaltpräventiv wirksam werden kann.
1. Begriffsbestimmungen
1.1 Was ist Gewalt?
Der Gewaltbegriff kann nur schwer definiert und abgegrenzt werden. Bis heute herrscht weder in der Wissenschaft noch in der Gesellschaft und Politik Konsens über ein bestimmtes Verständnis von Gewalt. Die Vorstellung dessen, was als akzeptable oder nicht akzeptable Verhaltensweisen verstanden oder was als Gefährdung empfunden wird, hängt stark von unterschiedlichen und sich wandelnden kulturellen Einflüssen, Wertvorstellungen sowie gesellschaftlichen Normen ab. Darüber hinaus vereint der Begriff „Gewalt“ verschiedene sowohl positiv als auch negativ konnotierte Bedeutungsinhalte, da er zum einen als Kennzeichnung für Gewaltanwendung als physische Verletzung und Zwangseinwirkung, zum anderen aber auch als Bezeichnung für Staatsgewalt und deren Träger verwand wird und bestimmte Verfügungs- und Besitzverhältnisse benennt. (Vgl. Gugel 2006: 47f.)
Möchte man jedoch präventiv gegen Gewalt vorgehen, setzt das ein differenziertes Verständnis von Gewalt voraus und es muss geklärt werden, was im jeweiligen Kontext unter Gewalt zu verstehen ist, was Gewalt auf welche Art verursacht sowie welche Strategien und Vorgehensweisen sinnvoll sind, um Gewalt zu verhindern. Eine entsprechende Definition muss dabei eine Gradwanderung vollziehen zwischen einer möglichst umfassenden, alle Phänomene von Gewalt einschließenden Begriffsbestimmung auf der einen Seite und einer möglichst genauen Präzisierung auf der anderen Seite, die es möglich macht, Gewaltphänomene von anderen Ereignissen abzugrenzen. Häufig wird der Begriff Gewalt auch synonym zu Aggression verwendet, da diese Begriffe kaum klar voneinander zu trennen sind. (Vgl. ebd.: 47ff.)
Gollwitzer et al. sprechen beispielsweise in ihrer Begriffsbestimmung nicht von Gewalt, sondern ausschließlich von Aggression und aggressivem Verhalten. Gemäß den Autoren bezieht sich Aggression aus psychologischer Perspektive „auf spezifische, zielgerichtete Verhaltensweisen [...], die im Kern darauf ausgerichtet sind, andere Personen zu schädigen“ (Gollwitzer et al. 2007: 16). Das Opfer erlebt das Verhalten des Angreifers dabei als verletzend. In einem weiter gefassten Defintionsverständnis können unter aggressivem Verhalten auch Vandalismus sowie die Schädigung der eigenen Person (Autoaggression) verstanden werden. (Vgl. ebd.: 16f.)
Gugel unternimmt hingegen eine Abgrenzung zwischen den beiden Begriffen:
„Mit Aggression werden häufig minderschwere Verletzungen oder die Übertretung von sozialen Normen verstanden, während mit Gewalt schwere Verletzungen und Übertretung von Geboten und Gesetzen bezeichnet werden. In diesem Verständnis ist Aggression dann eine Vorform von Gewalt“ (Gugel 2006: 50).
Als ein Unterscheidungskriterium zwischen aggressivem Verhalten und interpersonaler Gewalt wird auch das Kräfteverhältnis der beteiligten Personen oder Personengruppen genannt:
„Aggressives Verhalten generell kann auch zwischen gleich starken Kontrahenten stattfinden, während Gewalt dann vorliegt, wenn das Opfer psychisch oder physisch schwächer ist und sich somit auch nicht gegen die Übergriffe wehren kann“ (Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention (Hrsg.) 2008: 9).
Nach Scheithauer ist auch zwischen Aggression, Aggressivität und aggressivem Verhalten zu unterscheiden, auch wenn diese Begriffe häufig synonym verwendet werden.
„Dabei meint Aggression eine Haltung, Einstellung oder Emotion gegenüber Menschen, Tieren, Dingen oder Einrichtungen, mit dem Ziel sie zu beherrschen, zu schädigen oder zu vernichten, aggressives Verhalten die Umsetzung dieser Ziele und Aggressivität die überdauernde Bereitschaft zu aggressiven Verhaltensweisen“ (ebd.).
Gugel beschreibt drei Definitionen von Gewalt, die seiner Meinung nach eine hohe Relevanz erlangt haben: Die Definition von Johan Galtung, die Definition nach Peter Imbusch sowie jene der Weltgesundheitsorganisation (WHO).
Galtung unterscheidet zwischen personaler bzw. direkter Gewalt, struktureller und kultureller Gewalt. Bei personaler/direkter Gewalt können Opfer und Täter eindeutig zugeordnet werden, während bei struktureller Gewalt die Opfer durch spezifische organisatorische oder gesellschaftliche Strukturen und Lebensbedingungen erzeugt werden. Kulturelle Gewalt ergibt sich durch bestimmte Ideologien, Überlieferungen, Überzeugungen und Legitimationssysteme, die zur Rechfertigung von direkter oder struktureller Gewalt dienen.
„Gewalt liegt nach Galtung dann vor, wenn Menschen so beeinflusst werden, dass ihre tatsächliche körperliche und geistige Verwirklichung geringer ist als ihre mögliche Verwirklichung“ (Gugel 2006: 51).
Galtung beschreibt eine direkte Beziehung zwischen den drei Formen der Gewalt, die einem Teufelskreis gleich kommt, „da gewalttätige Kulturen und Strukturen direkte Gewalt hervorbringen und reproduzieren“ (ebd.).
Imbusch hat ein Modell entwickelt, das insbesondere die verschiedenen Dimensionen und die Vielschichtigkeit des Gewaltbegriffs herausstellt. Zur genaueren Bestimmung von Gewalt hat er sieben Fragen entwickelt, die auf je unterschiedliche Bedeutungselemente des Begriffs hinweisen:
1. „Wer übt Gewalt aus? Dies ist die Frage nach dem / den Täter/n.
2. Was geschieht, wenn Gewalt ausgeübt wird? Dies ist die Frage nach den Tatbeständen und den Abläufen einer als Gewalt verstandenen Handlung.
3. Wie wird Gewalt ausgeübt? Dies ist die Frage nach Art und Weise der Gewaltausübung und den dabei eingesetzten Mitteln.
4. Wem gilt die Gewalt? Dies ist die Frage nach den menschlichen Opfern von Gewalt, denjenigen, die Gewalt erfahren, erleiden oder erdulden müssen.
5. Warum wird Gewalt ausgeübt? Dies ist die Frage nach den allgemeinen Ursachen und konkreten Gründen von Gewalt.
6. Wozu wird Gewalt ausgeübt? Dies ist die Frage nach Zielen, Absichten, Zwecken und möglichen Motiven von Gewalt.
7. Weshalb wird Gewalt ausgeübt? Dies ist die Frage nach den Rechtfertigungsmustern und Legitimationsstrategien von Gewalt.“ (Ebd.: 52)
Nach der Beantwortung dieser Fragen untersucht Imbusch die verschiedenen Anwendungsebenen von Gewalt, indem er auf das Modell Galtungs zurückgreift, jedoch noch eine weitere Ebene hinzufügt – die institutionelle Gewalt. Darüber hinaus unterscheidet er zwischen Gewalt im übertragenen Sinne und Gewalt im ritualisierten Sinne. Auf diese Weise entwickelt Imbusch eine Typologie von Gewaltphänomenen, die sowohl die individuelle, die kollektive als auch die staatliche Gewalt umfasst. (Vgl. ebd.: 52f.)
Eine Definition von Gewalt, welche zunehmend auch von internationalen Organisationen und Gremien akzeptiert wird und einen international bisher größtmöglichen inhaltlichen Konsens darstellt, ist jene der WHO. 2002 veröffentlichte sie in ihrem World Report on Violence and Health folgende Typologie von Gewalt:
„Der absichtliche Gebrauch von angedrohtem oder tatsächlichem körperlichem Zwang oder physischer Macht gegen die eigene oder eine andere Person, gegen eine Gruppe oder Gemeinschaft, die entweder konkret oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Verletzungen, Tod, psychischen Schäden, Fehlentwicklungen oder Deprivation führt“ (ebd.: 54).
Dieser Definition zufolge liegt Gewalt immer eine Absicht zugrunde und zielt auf die Androhung oder Anwendung physischer Stärke oder Macht ab, was zu Verletzungen, psychischen Schäden, Fehlentwicklungen, Deprivation oder zum Tod führt oder führen kann (vgl. Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention (Hrsg.) 2008: 6). Unter diese Definition fallen zwischenmenschliche Gewalt (interpersonale Gewalt), suizidales bzw. selbstschädigendes Verhalten (Gewalt gegen die eigene Person) sowie bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen Gruppen und Staaten (kollektive Gewalt). Interpersonale Gewalt umfasst dabei Gewalt in der Familie und unter Intimpartnern sowie Gewalt, die von Mitgliedern der Gemeinschaft ausgeht. (Vgl. Gugel 2006: 54f.)
Die Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention definiert personale und interpersonale Gewalt wie folgt:
„Personale Gewalt meint 'die beabsichtigte physische und/ oder psychische Schädigung einer Person, von Lebewesen und Sachen durch eine andere Person' […]. […] Der dieser Expertise zugrunde liegende Begriff der interpersonalen Gewalt umfasst die spezifische, zielgerichtete physische und/oder psychische beabsichtigte Schädigung einer/mehrerer Personen durch eine/mehrere andere Person(en), die über eine höhere körperliche und/oder soziale Stärke/Macht verfügt/verfügen“ (Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention (Hrsg.) 2008: 7).
Kollektive Gewalt hingegen meint die instrumentalisierte Gewaltanwendung gegen eine Gruppe oder mehrere Einzelpersonen durch Menschen, die damit politische, gesellschaftliche oder wirtschaftliche Ziele verfolgen und sich einer anderen Gruppe zugehörig fühlen. Auch Bürgerkriege oder Kriege können somit zur kollektiven Gewalt gezählt werden. (Vgl. Gugel 2006: 54f.)
Gugel betont, dass die verschiedenen Definitionen von Galtung, Imbusch und der WHO sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern als einander ergänzend betrachtet werden müssen. Während Galtung und Imbusch eine möglichst breite und komplexe Sicht auf Gewalt eröffnen und für die Vielschichtigkeit von Gewaltphänomenen sensibilisieren, bietet die WHO eine sehr konkrete Typologie, wie sie zur Identifizierung konkreter Ansatzpunkte für Gewaltprävention notwendig ist. (Vgl. ebd.)
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Textes?
Der Text behandelt das Thema Gewaltprävention durch Partizipation von Kindern und Jugendlichen, insbesondere im kommunalen Kontext. Er definiert Schlüsselbegriffe, untersucht verschiedene Partizipationsniveaus und -formen, erörtert entwicklungspsychologische Grundlagen und betrachtet Partizipation als Teil kommunaler Gewaltpräventionsstrategien.
Wie definiert der Text Gewalt?
Der Text betont, dass Gewalt schwer zu definieren ist und es keinen Konsens darüber gibt. Er zitiert verschiedene Definitionen von Gewalt, unter anderem von Galtung (personale, strukturelle und kulturelle Gewalt), Imbusch (der ein Modell mit sieben Fragen zur Gewaltbestimmung entwickelt hat) und der WHO (absichtlicher Gebrauch von Zwang oder Macht, der zu Verletzungen, Tod, psychischen Schäden, Fehlentwicklungen oder Deprivation führt).
Was versteht der Text unter Gewaltprävention?
Der Text definiert Gewaltprävention nicht explizit in einem eigenen Abschnitt, aber er impliziert, dass sie darauf abzielt, die Entstehung von Gewalt zu verhindern, indem individuelle Verhaltensdimensionen und gesellschaftliche Verhältnisse berücksichtigt werden. Partizipation wird als ein wichtiger Bestandteil einer nachhaltigen Gewaltpräventionsstrategie gesehen.
Was bedeutet Partizipation im Kontext dieses Textes?
Partizipation bedeutet die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Entscheidungen, die sie betreffen, insbesondere im öffentlichen Raum. Der Text untersucht verschiedene Formen und Niveaus der Beteiligung und betont, dass es wichtig ist, auch Kinder zu beteiligen, die bislang wenig oder keinen Einfluss nehmen können.
Welche Partizipationsniveaus werden im Text genannt?
Der Text erwähnt die Partizipationsleiter und verschiedene Partizipationslevel, die sich in der Intensität der Beteiligung unterscheiden. Dazu gehören Mitwirkung am Willensbildungs- und Entscheidungsprozess sowie Mitbestimmungs- und Selbstbestimmungsrechte (Entscheidungsrechte). Außerdem werden Inhaltstypen von Partizipationsgegenständen und sieben Grundformen der Beteiligung erwähnt.
Ab wann können Kinder entwicklungspsychologisch mitentscheiden?
Der Text erwähnt entwicklungspsychologische Grundlagen und stellt die Frage, ab wann Kinder in der Lage sind, mitzuentscheiden. Eine detaillierte Antwort wird jedoch im Text nicht gegeben, sondern als Frage aufgeworfen, die im weiteren Verlauf der Arbeit beantwortet werden soll.
Welche Rolle spielt Partizipation in kommunalen Gewaltpräventionsstrategien?
Der Text betont, dass Partizipation ein elementarer Bestandteil einer nachhaltig ausgerichteten Gewaltpräventionsstrategie sein kann. Sie ermöglicht es, Demokratie im Nahraum von Kindern und Jugendlichen erfahrbar zu machen und die Demokratie- und Konfliktfähigkeit zu stärken.
Warum ist es wichtig, Kinder und Jugendliche an Entscheidungen zu beteiligen?
Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Entscheidungen wird als Chance zur Stärkung von Demokratie- und Konfliktfähigkeit und damit einhergehend zur Prävention von Gewalt betrachtet. Es ist wichtig, auch Kinder zu beteiligen, die bislang wenig oder keinen Einfluss nehmen können.
Welche Kritik wird an der aktuellen Partizipation von Kindern und Jugendlichen geäußert?
Der Text kritisiert, dass in der Praxis Kinder und Jugendliche nicht in angemessener Weise an Entscheidungen im öffentlichen Raum beteiligt werden. Die Kinder, die sich einmischen, stammen meist aus Akademikerfamilien. Partizipation hängt stark mit dem Bildungsgrad zusammen.
Welche Definitionen von Aggression werden im Text genannt?
Der Text zitiert Gollwitzer et al., die Aggression als "spezifische, zielgerichtete Verhaltensweisen [...], die im Kern darauf ausgerichtet sind, andere Personen zu schädigen" definieren. Es wird auch auf die synonyme Verwendung von Aggression und Gewalt hingewiesen, wobei Gewalt als schwerere Verletzung und Übertretung von Geboten und Gesetzen verstanden wird.
Welche Unterscheidung wird zwischen Aggression, Aggressivität und aggressivem Verhalten getroffen?
Nach Scheithauer meint Aggression eine Haltung, Einstellung oder Emotion gegenüber Menschen, Tieren, Dingen oder Einrichtungen, mit dem Ziel sie zu beherrschen, zu schädigen oder zu vernichten, aggressives Verhalten die Umsetzung dieser Ziele und Aggressivität die überdauernde Bereitschaft zu aggressiven Verhaltensweisen.
Details
- Titel
- Partizipation als kommunale Gewaltprävention
- Hochschule
- Leuphana Universität Lüneburg
- Veranstaltung
- Erziehungs- und Bildungswissenschaften
- Note
- 1,0
- Autor
- Rabea Drosten (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2012
- Seiten
- 29
- Katalognummer
- V199245
- ISBN (eBook)
- 9783656259633
- ISBN (Buch)
- 9783656259879
- Dateigröße
- 551 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Partizipation Gewaltprävention Partizipation von Kindern und Jugendlichen kommunale Partizipatzion
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 0,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Rabea Drosten (Autor:in), 2012, Partizipation als kommunale Gewaltprävention, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/199245
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-