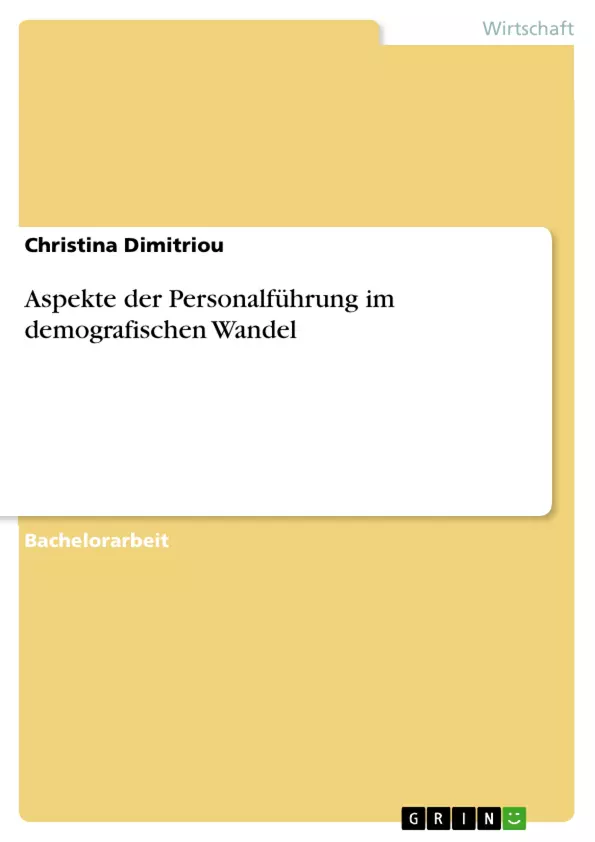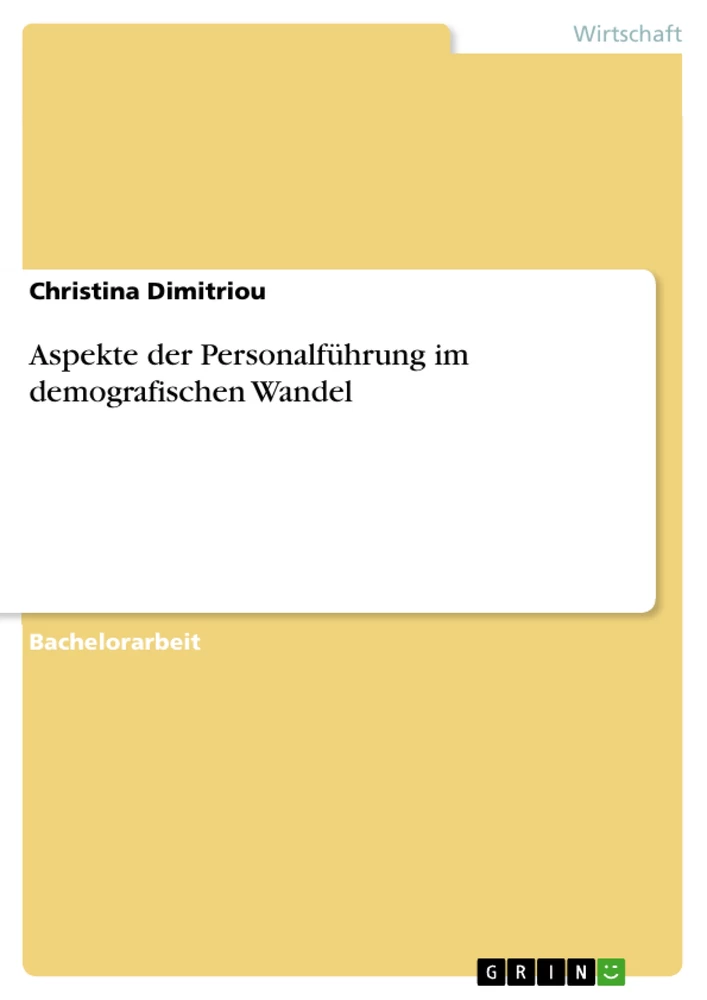
Aspekte der Personalführung im demografischen Wandel
Bachelorarbeit, 2011
39 Seiten, Note: 2,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit
- 2 Der demografische Wandel in Deutschland
- 2.1 Daten und Fakten
- 2.2 Demografie
- 2.3 Altersstruktur der Erwerbstätigen in Deutschland
- 3 Probleme der Personalführung im demografischen Wandel
- 3.1 Personalführung
- 3.2 Problemfelder
- 4 Künftige Anforderungen an die Führungskraft
- 4.1 Interkulturelle Managementfähigkeit
- 4.2 Teamleiter in heterogenen Gruppen
- 4.3 Teamleiter in Teams mit älteren Mitarbeitern
- 4.4 Lebenslanges Lernen
- 4.5 Die weibliche Führungskraft
- 4.6 Kommunikative Kompetenz
- 5 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit den Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Personalführung in Unternehmen. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen, die sich aus einer alternden und schrumpfenden Belegschaft ergeben, und untersucht, welche Anpassungen in der Personalführung erforderlich sind, um diese Herausforderungen zu meistern.
- Der demografische Wandel in Deutschland
- Die Herausforderungen der Personalführung im demografischen Wandel
- Künftige Anforderungen an die Führungskraft im Kontext des demografischen Wandels
- Die Bedeutung von interkultureller Managementfähigkeit und Lebenslangem Lernen
- Die Rolle der weiblichen Führungskraft im demografischen Wandel
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 stellt die Problemstellung der Bachelorarbeit dar. Der demografische Wandel stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen, die sich insbesondere auf die Personalführung auswirken. Die Arbeit analysiert die aktuelle Situation und beleuchtet die Notwendigkeit einer Anpassung der Personalführungsstrategien.
Kapitel 2 befasst sich mit dem demografischen Wandel in Deutschland und liefert relevante Daten und Fakten. Die Arbeit analysiert die Altersstruktur der Erwerbstätigen und die Folgen für den Arbeitsmarkt.
Kapitel 3 beleuchtet die Probleme der Personalführung im Kontext des demografischen Wandels. Die Arbeit identifiziert die Herausforderungen, die sich aus einer alternden und schrumpfenden Belegschaft ergeben, und beleuchtet die Notwendigkeit einer Anpassung der Führungsstrategien.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit den zukünftigen Anforderungen an die Führungskraft im Kontext des demografischen Wandels. Die Arbeit analysiert die Bedeutung von interkultureller Managementfähigkeit, Lebenslangem Lernen, Teamführung in heterogenen Gruppen und die Rolle der weiblichen Führungskraft.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: demografischer Wandel, Personalführung, Altersstruktur, interkulturelle Managementfähigkeit, Lebenslanges Lernen, Teamführung, Diversity, weibliche Führungskraft, zukünftige Anforderungen an Führungskräfte.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst der demografische Wandel die Personalführung?
Führungskräfte müssen sich auf alternde Belegschaften einstellen, Arbeitskraftpotenziale länger im Unternehmen halten und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Generationen moderieren.
Was bedeutet „Lebenslanges Lernen“ im Betrieb?
Es ist die Notwendigkeit, Mitarbeiter aller Altersstufen kontinuierlich weiterzubilden, um mit dem technologischen Wandel Schritt zu halten und die Beschäftigungsfähigkeit zu sichern.
Warum ist interkulturelle Managementfähigkeit heute so wichtig?
Durch Zuwanderung und Globalisierung bestehen Teams zunehmend aus Mitgliedern mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, was eine sensible und kompetente Führung erfordert.
Welche Rolle spielen heterogene Teams?
Teams mit unterschiedlichem Alter, Geschlecht und Hintergrund bieten hohes Innovationspotenzial, stellen aber auch höhere Anforderungen an die kommunikative Kompetenz der Führungskraft.
Was sind die künftigen Anforderungen an Führungskräfte?
Dazu gehören hohe Empathie, Flexibilität bei Arbeitszeitmodellen, Diversity-Management und die Fähigkeit, Wissenstransfer zwischen Alt und Jung zu organisieren.
Details
- Titel
- Aspekte der Personalführung im demografischen Wandel
- Hochschule
- Hochschule Fulda
- Note
- 2,0
- Autor
- Christina Dimitriou (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 39
- Katalognummer
- V200576
- ISBN (eBook)
- 9783656275534
- ISBN (Buch)
- 9783656276272
- Dateigröße
- 712 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Schlagworte
- aspekte personalführung wandel
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 15,99
- Preis (Book)
- US$ 26,99
- Arbeit zitieren
- Christina Dimitriou (Autor:in), 2011, Aspekte der Personalführung im demografischen Wandel, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/200576
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-