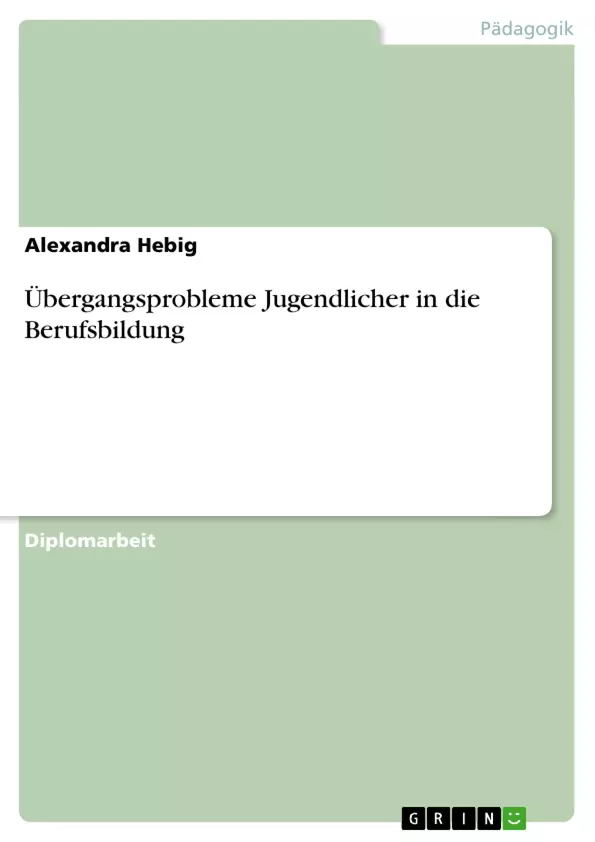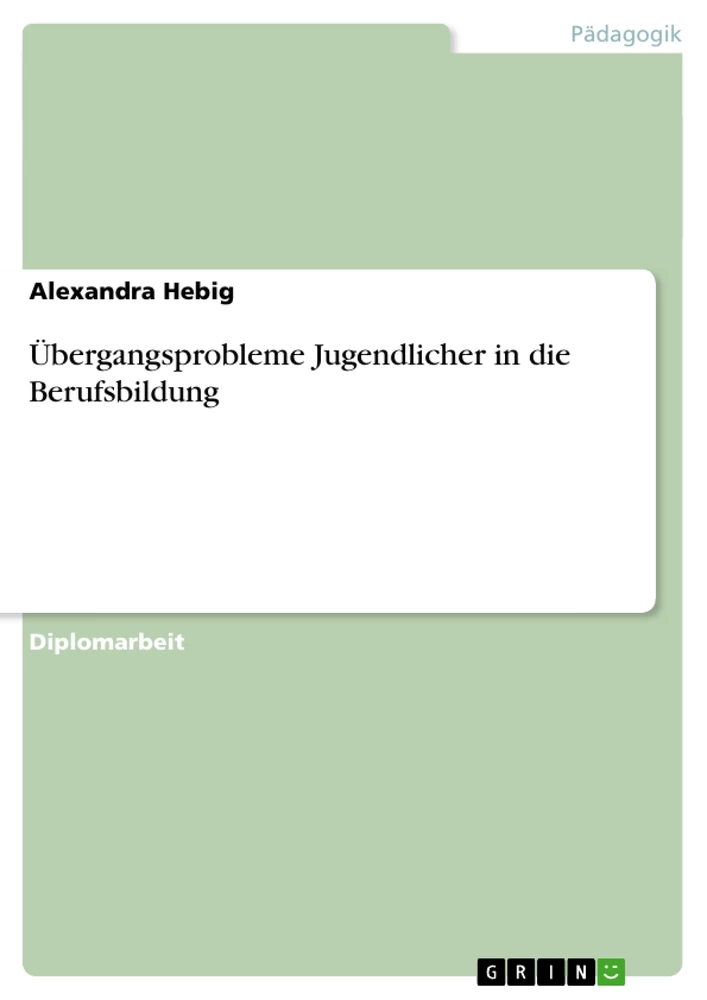
Übergangsprobleme Jugendlicher in die Berufsbildung
Diplomarbeit, 2003
128 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffliche Erläuterungen
- Berufsbildung
- Die erste Schwelle
- Was ist ein Übergang?
- Der Übergangsprozess und das Übergangssystem
- Schulische Bildungswege in Hessen und damit verbundene Übergangsprobleme
- Was ist Benachteiligung?
- Benachteiligungen, die mit der Person zu tun haben
- Soziale Herkunft
- Schulische Vorbildung
- Geschlecht
- Nationalität
- Auswirkungen der Benachteiligung
- Marktbenachteiligte
- Fazit
- Benachteiligungen, die mit der Person zu tun haben
- Ausbildungsplatzbilanz
- Begriffliche Erläuterungen
- Ausbildungsinteressen und Realisierung Jugendlicher im Übergang
- Entwicklungen in Hessen
- Fazit
- Alternative Verbleibsmöglichkeiten Jugendlicher
- Berufsgrundbildungsjahr (BGJ), Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) und Berufsfachschulen (BFS)
- Berufs(ausbildungs)vorbereitende Bildungsmaßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit (BvB)
- Entwicklung der BvB
- Aufgaben und Ziele von BvB
- Inhalte der Maßnahmen
- Funktion der Maßnahmen
- Maßnahmenangebote der Bundesanstalt für Arbeit
- tip- Lehrgang (testen- informieren- probieren)
- Grundausbildungslehrgang (G)
- Förderlehrgang (F)
- Lehrgang zur Verbesserung beruflicher Bildungs- und Eingliederungschancen (BBE)
- Weitere Maßnahmen
- Kritische Betrachtung der Berufsvorbereitung
- Fazit
- Betriebliche Aspekte
- Betriebliche Veränderungen und neue Anforderungen
- Schulische Vorbildung als Anforderungskriterium
- Berufliche Handlungskompetenz als Anforderungskriterium
- Gründe des Ausbildens und Nichtausbildens von Betrieben
- Kosten einer Berufsausbildung
- Nutzen einer Berufsausbildung
- Demographische Entwicklungen als Aspekt für Berufsausbildung und ihre Auswirkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Thematik der Übergangsprobleme Jugendlicher von der allgemein bildenden Schule in die Berufsbildung. Der Fokus liegt dabei auf den Herausforderungen, die sich im Übergangsprozess von der Schule in den Beruf aus der betrieblichen Perspektive ergeben.
- Analyse der Herausforderungen für Jugendliche im Übergang von der Schule in die Berufsausbildung
- Untersuchung der Rolle von Benachteiligungen und ihrer Auswirkungen auf den Übergangsprozess
- Bewertung von alternativen Verbleibsmöglichkeiten für Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz finden
- Beurteilung der Bedeutung betrieblicher Veränderungen und neuer Anforderungen im Kontext der Berufsausbildung
- Identifizierung von Einflussfaktoren auf die Entscheidung von Betrieben, Auszubildende einzustellen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet eine Einführung in das Thema der Übergangsprobleme Jugendlicher und erläutert die Relevanz der betrieblichen Perspektive. Kapitel 1 definiert zentrale Begriffe wie Berufsbildung, Übergang und Übergangssystem. Kapitel 2 beleuchtet die verschiedenen schulischen Bildungswege in Hessen und die damit verbundenen Herausforderungen für Jugendliche im Übergang.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem Konzept der Benachteiligung und untersucht verschiedene Formen der Benachteiligung, die Jugendliche im Übergangsprozess betreffen können. Kapitel 4 analysiert die Ausbildungsplatzbilanz in Hessen und die Entwicklungen auf dem Ausbildungsmarkt.
Kapitel 5 untersucht die Rolle der Bundesanstalt für Arbeit (BvB) bei der Unterstützung von Jugendlichen im Übergang und stellt verschiedene Maßnahmen zur Berufsvorbereitung vor. Kapitel 6 befasst sich mit betrieblichen Veränderungen und neuen Anforderungen im Kontext der Berufsausbildung.
Kapitel 7 analysiert die Gründe, warum Unternehmen ausbilden oder nicht ausbilden und betrachtet dabei die Kosten und den Nutzen einer Berufsausbildung sowie den Einfluss demographischer Entwicklungen.
Schlüsselwörter
Übergangsprobleme, Berufsbildung, Ausbildungsplatzbilanz, Benachteiligung, Betriebliche Perspektive, Berufsvorbereitung, Bundesanstalt für Arbeit, Demographischer Wandel, Schulische Vorbildung, Berufliche Handlungskompetenz.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter der "ersten Schwelle" beim Übergang?
Dies beschreibt den kritischen Übergang von der allgemeinbildenden Schule in die erste berufliche Ausbildung.
Warum scheitern Jugendliche beim Übergang in die Ausbildung?
Gründe sind oft mangelnde schulische Vorbildung, soziale Herkunft, fehlende Ausbildungsplätze oder gestiegene Anforderungen der Betriebe an soziale und fachliche Kompetenzen.
Was ist das Übergangssystem?
Ein System aus Vorbereitungsmaßnahmen (wie BGJ, BVJ oder BvB-Lehrgänge), das Jugendliche auffangen soll, die keinen direkten Ausbildungsplatz gefunden haben.
Welche Rolle spielen Betriebe bei den Übergangsproblemen?
Betriebe haben oft hohe Anforderungskriterien und scheuen die Kosten der Ausbildung, wenn Bewerber nicht über die gewünschten "Schlüsselqualifikationen" verfügen.
Wie wirkt sich die demographische Entwicklung aus?
Trotz sinkender Schülerzahlen bleibt der Wettbewerb um attraktive Stellen hoch, während gleichzeitig in manchen Branchen ein Fachkräftemangel droht.
Was sind BvB-Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit?
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, die die Eingliederungschancen verbessern sollen, indem sie berufliche Grundfertigkeiten vermitteln und bei der Orientierung helfen.
Details
- Titel
- Übergangsprobleme Jugendlicher in die Berufsbildung
- Hochschule
- Universität Kassel (Institut für Berufsbildungs-, Sozial- und Rechtswissenschaften)
- Note
- 1,7
- Autor
- Alexandra Hebig (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2003
- Seiten
- 128
- Katalognummer
- V20069
- ISBN (eBook)
- 9783638240628
- ISBN (Buch)
- 9783638700641
- Dateigröße
- 1557 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Diese Arbeit befasst sich mit den Übergangsproblemen schwach qualifizierter Jugendlicher. Besonders an der ersten Schwelle- dem Übergang in eine Berufsausbildung- scheitern zunehmend Hauptschüler, deren Fach- und Sozialkompetenzen nicht den betrieblichen Anforderungen entsprechen. Folgen dieses veränderten Ausbildungsverhaltens sowie demographische Entwicklungen werden aufgezeigt.
- Schlagworte
- Jugendlicher Schule Berufsbildung Berücksichtigung Perspektive
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 39,99
- Preis (Book)
- US$ 50,99
- Arbeit zitieren
- Alexandra Hebig (Autor:in), 2003, Übergangsprobleme Jugendlicher in die Berufsbildung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/20069
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-