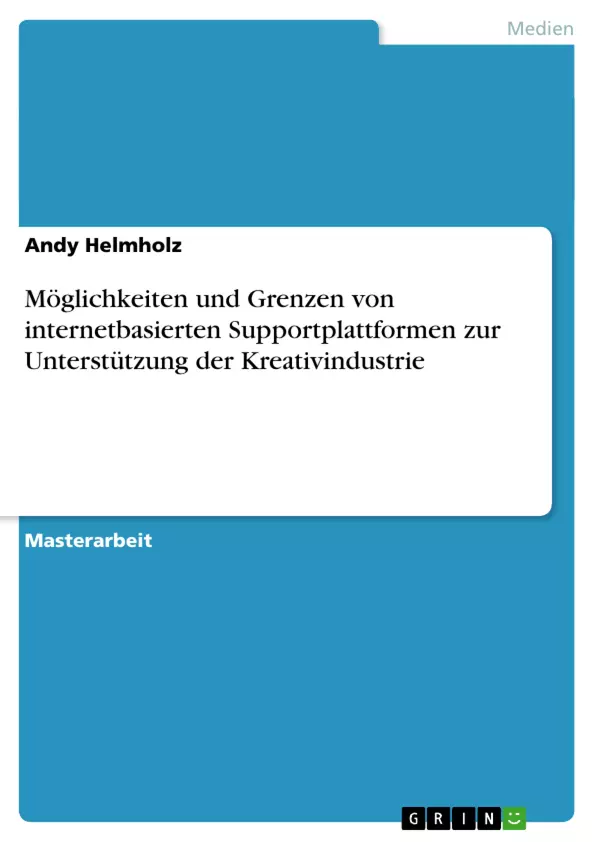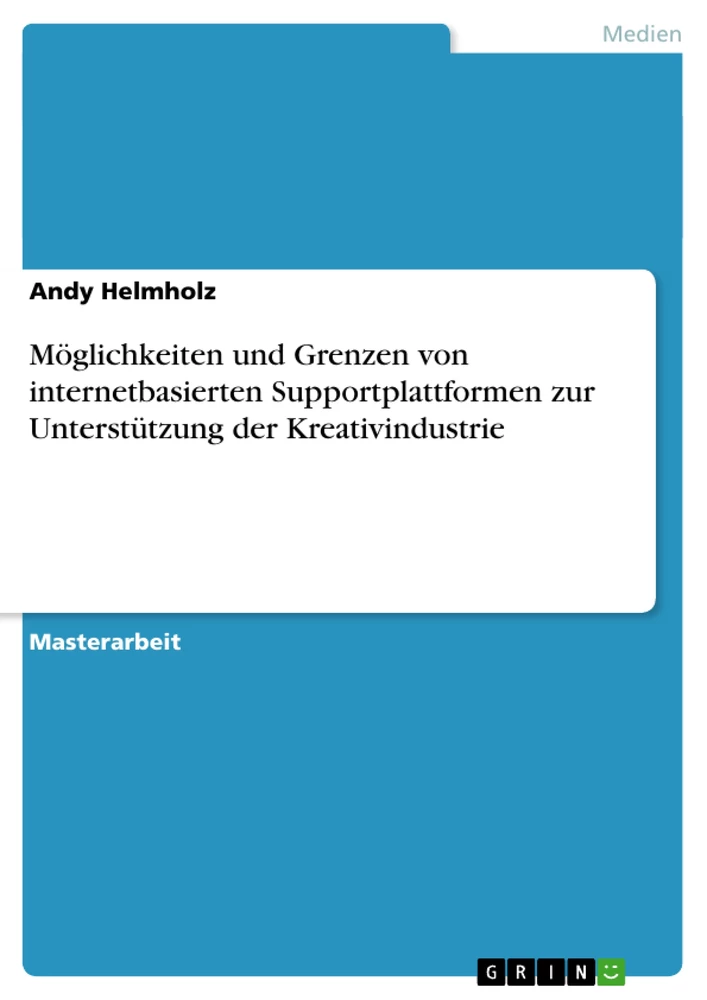
Möglichkeiten und Grenzen von internetbasierten Supportplattformen zur Unterstützung der Kreativindustrie
Masterarbeit, 2012
165 Seiten
Medien / Kommunikation - Multimedia, Internet, neue Technologien
Leseprobe
Inhalt
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Zielsetzung
1.3 Vorgehensweise
2 Untersuchung der Unterstützungspotentiale von Software-Systemen und technischer Infrastruktur für die Kultur- und Kreativindustrie
2.1 Die Kreativ- und Kulturindustrie – Innovationspionier der Wirtschaft
2.1.1 Klassifizierungsmerkmale der Kreativindustrie
2.1.1.1 Schöpferischer Akt
2.1.1.2 Wirtschaftliche Selbstständigkeit
2.1.1.3 Binnensegmentierung
2.1.1.4 Abgrenzung der Kultur- und Kreativindustrie
2.1.2 Gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Einordnung
2.1.3 Idealtypisches Leistungssystem der Kultur- und Kreativindustrie
2.1.4 Bedeutung softwaregestützter Arbeit im Rahmen der Wert-Schöpfung
2.2 Grundlagen von IT-Support
2.2.1 Begriffsdefinition und Einordnung Support
2.2.2 Wandel von computerisiertem zu webbasiertem Support
2.2.3 Akteure von Support
2.2.4 Kundenorientiertes IT-Servicemanagement
2.2.4.1 IT-Service-Management
2.2.4.2 Customer-Relationship-Management
2.2.4.3 Gründe für die Integration von Support in CRM-Konzepte
2.2.5 Operative Dimensionen von Support
2.2.5.1 Support Offline und Online
2.2.5.2 Modi von Support
2.3 Das Internet als Umgebung für Support
2.3.1 Einordnung des Internets
2.3.2 Digitale Stakeholderkommunikation
2.3.3 Virtuelle Netzwerke Im Netzwerk
2.3.4 Web 2.0 Kommunikation
2.3.5 Verlagerung von Daten und Datenverarbeitung ins Internet mittels Cloud-Computing
2.3.6 Datenraten und Mobile Bandbreiten
3 Ausgestaltungsoptionen von webbasiertem Support in der Kultur- und Kreativindustrie
3.1 Anforderungen der Kultur- und Kreativindustrie an webbasierten Support
3.1.1 Beschreibung des supportrelevanten Umfeldes anhand eines idealtypischen Beispiels aus der Designwirtschaft
3.1.1.1 Rechtfertigung für die Auswahl des Beispiels
3.1.1.2 5-Forces Branchenstrukturanalyse
3.1.2 Organisationsrelevante Faktoren
3.1.2.1 Kern- und Supportprozesse
3.1.2.2 Faktoren der Personalorganisation
3.1.3 Probleme und Anforderungen an webbasierten Support
3.1.3.1 Strukturiertheitsgrade von Problemstellungen
3.1.3.2 Problemstellung bei softwaregestützten Kernprozessen
3.1.3.3 Problemstellung bei softwaregestützten Supportprozessen
3.1.3.4 Technische Anforderungen an Services und Support
3.2 Technischer State-Of-The-Art von internetbasiertem Support
3.2.1 Möglichkeiten webbasierten Supports
3.2.1.1 Web-Services und Tools
3.2.1.2 Assisted Service
3.2.1.3 Self-Service
3.2.1.4 Infrastrukturelle Supportumgebungen
4 Fallstudien Support in der Kultur- und Kreativindustrie
4.1 Fallstudie Photoshop von Adobe Systems
4.1.1 Rechtfertigung für die Auswahl des Beispiels
4.1.2 Webbasierte Services und Tools
4.1.3 Assisted Support
4.1.4 Self Service
4.1.5 Infrastrukturelle Tools
4.2 Fallstudie Cubase von Steinberg Media Technologies
4.2.1 Rechtfertigung für die Auswahl des Beispiels
4.2.2 Assisted Support
4.2.3 Self-Service
4.2.4 Infrastrukturelle Tools
4.3 Supportoptimierung durch Funktionsanalyse
4.3.1 Fallstudie Adobe Photoshop
4.3.2 Fallstudie Steinberg Cubase
4.3.3 Optimierung der Supportsysteme von Adobe und Steinberg
5 Grenzen, Kritik, Schlusswürdigung und Ausblick
6 Quellen
6.1 Literatur
6.2 Magazine
6.3 Institutionelle Publikationen
6.4 Internetquellen
7 Anhang
7.1 Interview Marcel Ströter, block
7.2 Interview Roy Reinelt, dialog digital group
7.3 Eidesstattliche Erklärung
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 Interdependenzgeflecht der Kulturindustrie
Abbildung 2 Struktur der Erwerbstätigen in der Kultur- und Kreativwirtschaft
Abbildung 3 Idealisierte Wertschöpfungskette in der Kultur- und Kreativwirtschaft
Abbildung 4 Klassische Wertekette in der Musikwirtschaft vor der Digitalisierung
Abbildung 5 Wertekette in der Musikwirtschaft nach der Digitalisierung
Abbildung 6 Lokale CSS Umgebung zur Erfüllung von Kernprozessen bei der Filmproduktion
Abbildung 7 Architektur webbasierter Supportplattformen
Abbildung 8 Idealisierte Prozesszusammenhänge in der Kultur- und Kreativindustrie
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1 Übertragungstechnologien im Überblick
Tabelle 2 7 Methoden nach Hartschen
Tabelle 3 Kritische Grundanforderungen an Support
Tabelle 4 Services Kernprozesse Adobe
Tabelle 5 Services & Supportinstrumente Supportprozesse, Adobe
Tabelle 6 Services Kernprozesse, Steinberg Cubase
Tabelle 7 Services & Instrumente Supportprozesse, Steinberg Cubase
Tabelle 8 Adobe Instrumente, wohlstrukturierte Probleme Kernprozesse
Tabelle 9 Adobe Optimierung, wohlstrukturierte Probleme Kernprozesse
Tabelle 10 Adobe Instrumente, schlechtstrukturierte Probleme Kernprozesse
Tabelle 11 Adobe Optimierung, schlechtstrukturierte Probleme Kernprozesse
Tabelle 12 Adobe, Instrumente Supportprozesse
Tabelle 13 Adobe Optimierung, Supportprozesse
Tabelle 14 Steinberg Support, wohlstrukturierte Probleme Kernprozesse
Tabelle 15 Steinberg Optimierung, wohlstrukturierte Probleme Kernprozesse
Tabelle 16 Steinberg Support, schlechtstrukturierte Probleme Kernprozesse
Tabelle 17 Steinberg Optimierung, schlechtstrukturierte Probleme Kernprozesse
Tabelle 18. Steinberg Instrumente Supportprozesse
Tabelle 19 Steinberg Optimierung, Supportprozesse
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist im besonderen Maße durch sich stets verändernde Anforderungsprofile geprägt. Kaum eine Branche unterliegt einem ähnlich hohen Innovationsdruck auf technologischer sowie inhaltlicher Basis. Aufgrund ihrer technologie- und innovationsaffinen Eigenschaften übernehmen die Kreativ- und Kulturmärkte eine Pionierfunktionen in der Deutschen Wirtschaft. Die Innovationen der kreativen Industrien beeinflussen durch entsprechende Impulse alle traditionellen Wirtschaftsbereiche und fördern somit den wirtschaftlichen Fortschritt auf vielerlei Ebenen.[1]
Kreative Produkt- und Dienstleistungen werden dabei heute maßgeblich durch den Produktionsfaktor Software geprägt.[2] Ziel der Entwickler dieser Software ist es, den Kreativen und Kulturschaffenden die Produktion, Distribution und Monetarisierung ihrer Produkte und Dienstleistungen durch passende Service- und Produktlösungen zu ermöglichen und sicherzustellen. Die kreativen Schöpfer von Inhalten finden sich in der Presse, Film- und Musikindustrie, Architekturmarkt bis hin zur Game- und Werbewirtschaft. Sie stehen in einer steten Abhängigkeit zu den Herstellern von Produktionssoftware, da ihre Leistungserstellung mithilfe deren Software erst möglich wird.[3] Durch einen kontinuierlichen Austausch werden die Entwicklungen von Arbeitslösungen auf Softwarebasis beschleunigt, was wiederum dazu führt, dass sich die Kompetenzen der Nutzer stets erweitern müssen. Die Konvergenz der Medien und die damit einhergehende Transformation zur Mediengesellschaft tun ein weiteres um die Entwicklung von Technologien und Verarbeitungsmethoden zu fördern. Dieser Prozess führt aufgrund immer kürzer werdender Anforderungsintervalle bestimmt durch neue Technologien oder Verarbeitungsmethoden dazu, dass Unterstützung seitens Experten häufiger nötig ist. Die sich stets wandelnde Arbeitsumgebung fördert einen steigenden Bedarf von Unterstützung bei z.B. dem Erlernen neuer Verarbeitungstechniken, oder der Lösung von Problemen zur Sicherstellung der digitalen Produktionsumgebung
Die Produzenten von kreativem Output sehen sich stets täglich mit neuen Herausforderungen konfrontiert und müssen diese flexibel unter zeitlichem und finanziellem Druck bewältigen.[4] Aufgrund der Zahl an individuellen Aufgabenstellungen und damit individuellen Problemen liegt die Schwierigkeit für Softwareanbieter darin Support möglichst zeitnah und unter Einhaltung ökonomischer Prinzipien kundengerecht zu leisten. Das führt zu der Überlegung, dass neben der telefonischen und persönlichen Betreuung, das Internet im Zuge steigender Bandbreiten und multimedialer Kommunikations-technologien eine bedeutsame Rolle bei der Lösung dieser Aufgaben spielen kann.
1.2 Zielsetzung
In der vorliegenden Arbeit werden die informations- und kommunikationstechnischen Möglichkeiten zur Unterstützung der Kultur- und Kreativwirtschaft untersucht. Die Anforderungen der Kreativindustrie an internetbasierten Support werden analysiert mit dem Ziel, die wichtigsten Kernpräferenzen und Entwicklungstreiber zu identifizieren. Daraufhin werden die derzeit bestehenden Systeme mit Kundenpräferenzen verglichen um Defizite zu eruieren. Dies geschieht mittels einer Nutzenkontextanalyse und einer Analyse der Funktionen von Online-Support-Instrumenten. Anschliessend folgt unter Berücksichtigung dieser Defizite und unter Zuhilfenahme neuer Technologien eine Optimierung bestehender Systeme. Diese Optimierung wird anhand zweier Supportsysteme von Softwareanbietern illustriert und kritisch hinterfragt. Zusätzlich werden die Möglichkeiten jeweils mit strukturierten Interviews konkretisiert. Hierbei wird insbesondere auch auf die Grenzen im Sinne der Machbarkeit der Optimierungen, durch konkrete Einschränkungen bei der Software-technischen Implementierung, eingegangen.
1.3 Vorgehensweise
Im theoretischen Teil des nachfolgenden Kapitels Zwei wird zu Beginn der Branchenquerschnitt der Kultur- und Kreativindustrie mittels politischer und wirtschaftlicher Klassifizierungsmerkmale definiert und eingegrenzt. Als verbindendes Element der Branchen der Kreativindustrie wird der Begriff des „schöpferischen Aktes“ geklärt und die damit verbundenen „Arbeitsweisen“ erläutert. Des Weiteren wird die Bedeutung von Software gestützter Arbeit im Zusammenhang des Leistungssystems geklärt.
Daraufhin werden Gegenstand und Gründe für Support hinreichend untersucht, um dann anschließend ihre Bedeutung als Disziplin zur Gestaltung von Kundenbeziehungen zu skizzieren. Zur Verdeutlichung, wie in diesem Zusammenhang Support im Unternehmen integriert werden kann, werden Customer-Relationship- und IT-Service-Management miteinander in Beziehung gesetzt. Im Anschluss daran wird auf die operativen Dimensionen von Support eingegangen. In diesem Abschnitt werden Arten und Modi von Support und Akteure zur Realisierung verschiedener IT-Teilbereiche unterschieden.
Im letzten Teil des zweiten Kapitels wird schließlich das Internet als Kommunikationsinfrastruktur erläutert und die Rahmenbedingungen elektronischer Kommunikation umrissen. Abschliessend wird die Relevanz von technischen Neuerungen wie LTE, Web 2.0, Cloud-Intelligenz, und VPN-Verbindungen bezüglich der Themenstellung der Arbeit bewertet.
Darauf aufbauend wird im dritten Kapitel veranschaulicht, in wie weit sich die gefundenen Aussagen zu webbasiertem Support in der Literatur auf den hier schwerpunktmäßig betrachteten Bereich der Kreativwirtschaft transferieren lassen. Zu diesem Zweck werden die Anforderungen der Kultur- und Kreativindustrie identifiziert und analysiert. Dies geschieht mittels einer Analyse des Nutzungskontextes. Dafür werden die Beziehungen zwischen Kern- und Supportprozessen erläutert, externe Faktoren via Branchenstrukturanalyse geklärt und interne Problemlösungsansätze diskutiert. Darüber hinaus wird die Frage geklärt, in wie weit die heutigen Informations- und Kommunikationstechnologien in der Lage sind die dabei jeweils zu unterscheidenden Problembereiche umfassend zu unterstützen.
Im folgenden Kapitel Vier wird zunächst der Frage nachgegangen, welche informationstechnischen Systeme bei der Unterstützung der Kreativwirtschaft im Rahmen wohlstrukturierter Problemlösungsprozesse bestehen. Darauf aufbauend werden Praxis-Lösungsansätze anhand zweier Fallstudien in Augenschein genommen. Ein Vergleich der Anforderungen und der bestehenden Systeme findet mit Hilfe einer Funktionsanalyse der eingesetzten Instrumente statt. Auf der Basis der dabei festgestellten Defizite wird anschließend eine Optimierung erarbeitet.
Im abschließenden Kapitel Fünf wird eine kritische Bestandsaufnahme der Möglichkeiten und Grenzen von internetbasierten Supportplattformen zur Unterstützung der Kreativindustrie, sowie eine Bewertung des entwickelten Analyseansatzes vorgenommen. Die Bewertung der optimierten Systeme im Vergleich zu den bestehenden Systemen schließt dabei das Kapitel ab. Anschließend wird ein Ausblick in die nähere Zukunft des internetbasierten Supports vorgenommen
2 Untersuchung der Unterstützungspotentiale von Software-Systemen und technischer Infrastruktur für die Kultur- und Kreativindustrie
2.1 Die Kreativ- und Kulturindustrie – Innovationspionier der Wirtschaft
Als Kultur- und Kreativindustrie bezeichnet die Forschung einen heterogenen Querschnitt an Branchen mit mehrheitlich dienstleisterischem Charakter. Aufgrund wachsender Bedeutung von Inhalten und Wissen innerhalb unserer modernen Mediengesellschaft übernimmt diese daher eine Vorreiterrolle in der volkswirtschaftlichen Entwicklung. Diese Entwicklung zeichnete sich zum einen durch einen rasanten Anstieg von Kulturgütern und Dienstleistungen innerhalb der letzten Dekade aus, zum anderen insbesondere durch die informations- und kommunikationstechnologisch bedingten ökonomischen Umwälzungen der Wirtschaft. Hinzu kommt die zunehmende Sichtweise, dass technologische Produkte und Infrastrukturen sich nur mit Inhalten optimal vermarkten lassen.[5] [6] Auch bezüglich der Nutzung und Etablierung von modernen Technologien, insbesondere in der Informationsverarbeitung und Kommunikation, übernimmt die Kultur-und Kreativindustrie eine Pionierfunktion. Die Arbeitsweisen wie auch die Produkte sind außerordentlich innovativ und zeichnen sich wesentlich durch Prototypen und Einzelanfertigungen aus. Im Gegensatz zu verarbeitenden Betrieben anderer Industrien wird mehrheitlich auf Projektbasis gearbeitet. Die in dieser Industrie Tätigen sind dabei nicht nur einfache User von Software. Im Gegenteil, sie tragen oft zu Weiterentwicklungen von Technologien und Verarbeitungsmethoden maßgeblich bei. Die wirtschaftspolitische Definition dieser Querschnittsbranche wird auf internationaler Ebene unterschiedlich diskutiert und befindet sich in einem steten Wandel. Neben der in Deutschland geltenden Einigung, welche sich aus vergleichstaktischen Gründen an dem der EU orientiert, existieren u.a. weitere Ansätze und Modelle der UNCTAD[7] , OECD[8] oder der britischen Regierung[9] .
Des Weiteren haben in den USA die Forscher Prof. Richard Florida[10] und John Howkins[11] jeweils mit eigenen Ansätzen zur Definition von kreativ- und kulturrelevanten Brancheneinteilungen zur Debatte beigetragen. Diese sprechen von einer „kreativen Klasse“ bzw. „Creative-Community“, welche eine weiter reichende Einordnung von Unternehmen und Akteuren zulässt. Die Unterschiede der definitorischen Ansätze sind schwerwiegend und komplizieren daher auch die internationale Vergleichbarkeit, sowie den wirtschaftspolitischen Diskurs.[12] In dieser Masterarbeit wird aufgrund datentechnischer Gründe der in Kontinentaleuropa geltende Ansatz favorisiert. Zu nennen wären als Quellen hier insbesondere die Publikationen und Kulturwirtschaftsberichte der Länder und des Bundes. Diese Veröffentlichungen beinhalten statistische Erhebungen, welche Hinweis über Marktdaten der Kreativ- und Kulturwirtschaft in Deutschland geben.
2.1.1 Klassifizierungsmerkmale der Kreativindustrie
Gemäß des „Endberichts zur Kultur und Kreativindustrie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie“ sind die Klassifizierungsmerkmale die erwerbswirtschaftliche Selbstständigkeit von Unternehmen, Marktakteuren wie Künstler und Kreative, Binnensegmentierung, Branchenabgrenzung und der schöpferische Akt. Im folgenden Abschnitt werden diese näher definiert.
2.1.1.1 Schöpferischer Akt
Das grundsätzlich verbindende Element der Kultur- und Kreativindustrie ist der sogenannte Schöpferische Akt. Dieser ist Grundlage aller Produkte und Dienstleistungen im genannten Branchenquerschnitt und definiert sich über einen ästhetischen Kern oder Bezug.[13] Dieser ästhetische Kern entsteht in einem kreativen Prozess unter Anwendung der Fähigkeit, Sinnbezüge zwischen zwei nicht verbundenen Gegebenheiten sinnvoll herzustellen und zu gestalten.[14] Die dem schöpferischen Akt zugrundeliegenden Denkprozesse sind weitestgehend unterbewusst und werden oft als Eingebungen überpersönlicher Intelligenz, bzw. als mystisches „ geführt-werden “ erlebt.[15] Laut Landau liegt dieses kreative assoziative Potential allen Individuen vor und kann in jeder Lebenssituation angewandt werden.[16] In der Praxis werden zur Förderung der Kreativität oft sog. Kreativitätstechniken eingesetzt, um Ideen für die gesuchten Sinnbezüge zu generieren. Die Künstler und Kreativen sind diejenigen, die am Anfang der Wertschöpfungskette diesen Akt vollziehen und damit Inhalte für die nachgelagerten Unternehmen liefern. Dies kann sowohl von nur einem Künstler oder Kreativem, als auch von Mehreren durch einen kreativen Prozess umgesetzt werden. In vielen Fällen geschieht dies auf eine kollaborative Art und Weise: Z.B. bei der Produktion eines Musikstücks, bei der mehrere Akteure zusammenspielen. Es sind in diesem Fall Songwriter, Texter, Studiomusiker, Interpret, Soundingenieur und Produzent die am Schaffensprozess gleichermaßen durch ihre jeweiligen Expertisen teilhaben. Zur Generierung von schöpferischen Prozessen werden häufig Kreativitätstechniken wie Brainstorming oder Meta-Plan genutzt.[17]
Schlussendlich ist es für die Wertschöpfung unerheblich ob dieser Prozess dann ein analoges Unikat, eine Liveaufführung oder eine digitale Produktion als „First-Copy“ zur Folge hat. Die Vermarktung kann heutzutage mittels moderner Medien- und Vertriebstechnologien auf jede erdenkliche Art umgesetzt werden. Diese ästhetischen Grundlagen sind dabei im urheberrechtlichen Sinne in jedem Falle geschützt werden aber nicht zwangsläufig im vermarktungsrechtlichen Zusammenhang vom Urheber behalten.[18]
Die Bezeichnung der Kultur- und Kreativindustrie ist politisch gewachsen und gestaltet sich hierdurch mithin als problematisch, was die wissenschaftliche Definition angeht. Der schöpferische Akt und die damit verbundene Kreativität wird genutzt um einen Branchenquerschnitt zu definieren. Dabei wird aber vernachlässigt, dass diese Kreativität auch in anderen Teilen der Ökonomie bestand hat. Beispielsweise sind Ingenieure oder Mathematiker auch kreativ tätig was ihre Domänen betrifft. Es ist jedoch stark anzunehmen, dass deren kreatives Schaffen im Kontext der Content-orientierten Gesellschaft weniger Gewicht hat als die in der EU gemeinhin unter dem Begriff der Kultur- und Kreativwirtschaft zusammengefassten Branchen. Die in dieser Arbeit angewandte Definition des schöpferischen Aktes, welche der politisch pragmatischen entspricht, zielt darauf ab, dass hierdurch generiertes geistiges Eigentum nicht nur ideellen, sondern auch ökonomischen Wert hat.[19]
2.1.1.2 Wirtschaftliche Selbstständigkeit
Aufgrund von starken förderungspolitischen Bestrebungen des Staates und der Länder ist die wirtschaftliche Selbstständigkeit als Merkmal definiert worden. Dies bedeutet allerdings nicht, dass Kreative nicht auch im öffentlichen oder intermediären Bereich tätig sind. Diese Teilsektoren sind per Definition im Non-Profit Bereich dem übergeordneten Kultursektor zuzuordnen, dem auch zu Teilen die Kreativwirtschaft angehört.[20] Diese, nicht marktwirtschaftlich agierenden Unternehmen, stehen dennoch oft in einem Verhältnis zu den privatwirtschaftlich orientierten. Besonders deutlich wird dies bei der Betrachtung des Rundfunk- und TV-Marktes in dem Öffentlich-Rechtliche mit den Privaten konkurrieren.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1 Interdependenzgeflecht der Kulturindustrie
Benkert[21]
2.1.1.3 Binnensegmentierung
Die Binnensegmentierung unterscheidet die Marktteilnehmer nach ihren strukturellen Merkmalen und ihrer Größe. Die Praxis hat gezeigt, dass bestimmte Positionen innerhalb der Wertschöpfung durch strukturelle Merkmale begünstigt oder gar erst ermöglicht werden. Hierbei unterscheidet die Politik die üblichen Typen Einzelunternehmer bzw. Kleinstunternehmen, Klein- und Mittelständler sowie Majors bzw. Konzerne.
- Kleinstunternehmen
Besonders im Focus dieser Masterarbeit befindet sich der Bereich der Kleinstunternehmer, da diese den innovativen Kern der Branche darstellen und fast immer zu Beginn der Wertschöpfungskette stehen. Diese Einzelunternehmen treten meist in Form von kleinen Büros, Ateliers, Agenturen oder losen Netzwerken auf. Ihr Betätigungsfeld ist meist die Schaffung von Prototypen und Einzelstücken (bzw. First Copies). Sie stellten 2006 rund drei Viertel der gesamten Kultur- und Kreativindustrie.[22] Die höchsten Umsätze relativ zum gesamten Branchenumsatz generierten zu diesem Zeitpunkt die Kleinstunternehmen in den Teilmärkten für Kunst (39%), angewandte Kunst (59%), die Design-Wirtschaft ohne Anteil der Werbegestaltung (75%) und am meisten im Architekturmarkt (78%).[23] Die Unterscheidung von Kleinstunternehmen und KMU ist darin begründet, dass Künstler als besondere Akteure in der Regel als Kleinstunternehmer agieren. Die Europäische Union dagegen fast diese Unternehmen normalerweise zusammen.[24]
- KMU
Die kleinen und mittelständischen Unternehmen sind häufig als GmbH organisiert. Sie sind etablierte Unternehmen deren Arbeitsprozesse weitestgehend standardisiert sind. Wirtschaftspolitisch ist dieses Segment der wichtigste Träger innerhalb der Wertschöpfung. Im Gegensatz zu den Einzelunternehmen wird auf experimentelles Arbeiten zu Gunsten von Unternehmensprinzipien wie Stabilität und Nachhaltigkeit verzichtet. Das Produkt- und Dienstleistungsangebot unterscheidet sich zu den KMUs insofern, dass hier zunehmend sich reproduzierende Tätigkeiten ausgeführt werden.[25]
- Majors und Konzerne
Der Begriff „Majors“, welcher besonders für Konzerne der Musikindustrie verwendet wird, steht für die Großunternehmen der Kultur- und Kreativindustrie. Sie sind Marktakteure, die Leistungen der Kulturschaffenden vielfältig einkaufen und international vermarkten. Diese Unternehmen sind fest etabliert und in ihre Marktposition historisch hinein gewachsen. Sie verfügen meist über mehrere tausend Mitarbeiter und unterhalten Verträge mit unzähligen kleineren Unternehmen und Künstlern. Sie fungieren nach standardisierten Prinzipien, reproduzieren und vertreiben die Kulturgüter in großem Maßstab. In allen elf Teilmärkten [26] sind diese Großunternehmen nur in geringe r zweistelliger Anzahl vertreten. [27]
2.1.1.4 Abgrenzung der Kultur- und Kreativindustrie
- Branchenabgrenzung
Die Wirtschaftsministerkonferenz, wie auch die Länderberichte zur Kulturindustrie, haben folgende neun Teilmärkte zum Querschnitt der Kulturindustrie zusammengefasst: Musikwirtschaft, Buchmarkt, Kunstmarkt, Filmwirtschaft, Rundfunkwirtschaft, Darstellende Kunst, Design-Wirtschaft, Architekturmarkt und Pressemarkt.[28] Hinzukommen die Märkte Werbemarkt, Software und Games-Markt. Diese werden der Kreativwirtschaft zugeordnet.[29] Zusammen bilden sie die 11 Teilmärkte der Kultur- und Kreativindustrie. Grund für die Branchengliederung ist eine pragmatische Orientierung an den etablierten Marktstrukturen und verfügbaren Statistiken.
- Abgrenzung zur Medien- oder IT-Klassifizierung
Die Kultur- und Kreativindustrie, welche sich fundamental durch den schöpferischen Akt als verbindendes Element definiert, umfasst Schnittmengen der Branchenquerschnitte der Medien- und IT-Wirtschaft. Grund hierfür sind unterschiedliche Definitionsmerkmale bzw. -kerne. Geht es bei der Medienwirtschaft in erster Linie um Content-Packager wie auch um Hersteller von Infrastrukturen, so geht es bei der Kultur- und Kreativindustrie um die Produzenten von Inhalten.[30] Im Fokus der Kultur- und Kreativwirtschaft ist daher immer der schöpferische Akt als sinnstiftendes Merkmal. Diese Kategorisierung trifft nicht für Netzbetreiber oder Hersteller von Datenverarbeitungssoftware im herkömmlichen Sinne zu, da diese keine Inhalte als Resultat eines schöpferischen Aktes im Fokus der unternehmerischen Tätigkeit haben.[31] In diesen Branchenquerschnitten sind die definitorischen Merkmale die mediale oder technologische Beschaffenheit der Produkte oder Dienstleistungen.
2.1.2 Gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Einordnung
Laut BMWi erwirtschaftete die Kultur- und Kreativindustrie im Jahr 2006 eine Wertschöpfung von etwa 61 Milliarden Euro, was ca. 2,6% des Bruttoinlandsproduktes entspricht. Verglichen mit der Automobilindustrie (3,1%) und der Chemieindustrie (2,1%) befinden sich die Kulturmärkte in einer guten Mittelposition. Betrachtet man den Gesamtumsatz von 2006 mit 126,5 Milliarden Euro dessen Exportanteil nur 5,2 Milliarden Euro betrug, so spiegelt sich eine noch relativ geringe Relevanz von Dienstleistungen im Exportmarkt wider. Der Anteil an Dienstleistungen im Export betrug im selben Zeitraum nur 13%.[32] Des Weiteren sind genannte Zahlen ein Hinweis auf einen starken Binnenmarkt für Kultur- und Kreativgüter, da nur 4% des Umsatzes im Export erwirtschaftet wurden.[33] Aufgrund der Heterogenität des Branchenquerschnitts variieren die Anteile derer die am Teilmarktumsatz beteiligt sind erheblich. Mehr als ein Drittel der Umsätze wird von Großunternehmen und Konzernen erwirtschaftet obwohl diese nur 1% des Marktes darstellen. In der Rundfunkwirtschaft wie auch im Verlagswesen setzen Konzerne 70-80% des Marktumsatzes um. Diese Umsatzverteilung gilt aber nicht für alle Teilmärkte: In der Architekturbranche generieren die Kleinstunternehmen ca. 80% der Umsätze. Ausgewogener ist die Verteilung in der Softwareindustrie. Hier erwirtschaften kleine, mittlere und große Unternehmen in etwa je ein Drittel des gesamten Teilmarktvolumens.
Im Jahr 2006 waren ca. 1,4 Millionen Personen in der Kultur- und Kreativwirtschaft beschäftigt.[34] Zu diesem Zeitpunkt waren davon 381.000 Personen selbstständig und 1.021.000 sozialversicherungspflichtige und geringfügig-beschäftigte Arbeitnehmer. Von den Selbständigen ist ein Anteil von 162.000 nur geringfügig tätig mit einem Jahresumsatz unter 17.500 €. Zu diesen gehören z.B. Studenten oder nebenberuflich Arbeitende. Bei den übrigen 219.000 ist mehrheitlich von Freiberuflern mit einem höheren Einkommen auszugehen. Diese überdurchschnittlich hohe Quote an Selbstständigen spiegelt sich auch in der großen Anzahl der Kleinstunternehmen wider (ca. 213.000).
Der Vergleich mit der Automobilindustrie gibt leicht Auskunft über die Bedeutung der jeweiligen Unternehmenstypen für die Kulturindustrie hinsichtlich der Branchenleistungen. Kleinst- und Kleinunternehmen haben etwa 42% des Umsatzes geleistet, wohingegen in der Fahrzeugindustrie von ca. 1% auszugehen ist. Auch die Mittelständischen haben hier nur ca. 2% Anteil des Gesamtumsatzes. Die Kreativindustrie setzt dagegen in diesem Unternehmensbereich 17% um.[35]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2 Struktur der Erwerbstätigen in der Kultur- und Kreativwirtschaft
BMWi[36]
2.1.3 Idealtypisches Leistungssystem der Kultur- und Kreativindustrie
Um die Anforderungen an Support für die Kultur- und Kreativindustrie bewerten zu können, ist es von besonderem Interesse die Beschaffenheit der anfallenden Kernaufgaben zu berücksichtigen. Der Grund hierfür liegt in der existentiellen Bedeutung der Kernprozesse für die Unternehmen.[37] Die Bezeichnung Kreativ- industrie ist eine politisch-pragmatische Bezeichnung, die eine Vereinfachung komplexer realer Gegebenheiten impliziert. Im folgenden Abschnitt wird die Wertschöpfung im Sinne des BMWi demnach auch vereinfacht schematisch skizziert.[38]
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie definiert die Wertschöpfungsbeziehungen der Kultur- und Kreativindustrie trotz struktureller Unterschiede der Teilmärkte über eine idealtypische Darstellung in Wertschöpfungsketten. Grund dafür ist die pragmatische Erfassung der jeweiligen Wertschöpfungsprozesse mit dem Ziel der empirischen Bestandaufnahme. Außerdem definiert das BMWi Markteilnehmer der Kultur- und Kreativindustrie als all jene, die an der Schaffung, Produktion und Verteilung von kulturellen Gütern beteiligt sind.[39]
,
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3 Idealisierte Wertschöpfungskette in der Kultur- und Kreativwirtschaft
Enquetekommission 2007[40]
2.1.4 Bedeutung softwaregestützter Arbeit im Rahmen der Wert-Schöpfung
Die Digitalisierung von Gütern der Kultur- und Kreativindustrie zog zu weiten Teilen auch eine Digitalisierung von Prozessen mit sich. Der Begriff „digitale Güter“ bezieht sich besonders auf Text-, Audio- oder Videodateien[41] aber auch auf digitale Trägermedien[42] , welche die analogen Medien[43] zunehmend verdrängt haben.[44] Am Beispiel der Musik- und Filmindustrie kann man auf etwa allen Wertschöpfungsstufen das Phänomen der Digitalisierung beobachten. Manche Ebenen der Wertschöpfung wurden modifiziert und rationalisiert, andere Ebenen wurden sogar komplett umgangen. Die Arbeitsprozesse der Wertschöpfung profitieren auf vielfältige Art und Weise von der Transformation in die digitale Arbeitsumgebung. Probleme können unabhängig ihres Strukturiertheitsgrades mit Software unterstützt werden. Beispielsweise geschieht dies über intuitive HCIDs, Presets oder besondere Organisations- oder Menüstrukturen.[45]
Zur Illustration der Tragweite der Transformation von Arbeitsvorgängen finden sich nachfolgend zwei Grafiken. Zum einen die Wertschöpfungskette vor und zum anderen nach der Digitalisierung am Beispiel der Musikwirtschaft:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4 Klassische Wertekette in der Musikwirtschaft vor der Digitalisierung.
Eigene Darstellung nach Wirtz &Werkmann[46]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5 Wertekette in der Musikwirtschaft nach der Digitalisierung.
Eigene Darstellung nach Wirtz & Werkmann
Neben der Wertschöpfung von Kulturgütern wurde auch die Kommunikation der Marktteilnehmer untereinander durch die Digitalisierung verändert. In der Kultur- und Kreativindustrie gelten außerdem auch die generell in der Geschäftswelt geltenden Umwälzungen, welche durch die Digitalisierung verursacht wurden.[47] State-Of-The-Art Informationstechnologien wie Online-Knowledge-Bases, Live-Meeting, Cloud-Computing finden sich meist sehr früh in der Kultur- und Kreativindustrie. Aufgrund der 99,4%[48] Kleinst- und KM-Unternehmen, deren Arbeitsprozesse zu weiten Teilen nicht standardisiert sind, verfügen diese, gemessen an Unternehmen anderer Umsatzgrößen, über eine hohe Innovationsaffinität. Gründe für diese Bereitschaft sind der geringe formale Organisationsgrad, wie auch der Innovationsdruck innerhalb der Branche.[49]
Die softwaregestützte Produktion stellt für fast alle Unternehmen der Kultur und Kreativindustrie einen kritischeen Faktor dar. Da Software als Bestandteil der Produktionsprozesse nicht mehr wegzudenken ist, sind die Kreativschaffenden auf leistungsfähige und fehlerfreie Systeme angewiesen. Gründe hierfür sind die Marktanforderungen, wie das Erfüllen technischer Standards und der Bedarf nach innovativen konkurrenzfähigen Produkten.[50]
2.2 Grundlagen von IT-Support
In diesem Abschnitt zur Realisation von IT-Support-Systemen werden zunächst der Begriff des „Support“ und seine Gründe geklärt, um diesen in Kontext der Fragestellung einzuordnen. Als nächstes werden die Akteure kurz umrissen und die für diese Arbeit notwendigen Management-Ansätze skizziert. Zuletzt wird auf die operativen Dimensionen Online und Offline Support sowie die Modi von Support eingegangen.
2.2.1 Begriffsdefinition und Einordnung Support
Definition und Zweck
Der Begriff Support leitet sich aus dem englischen Verb „to support“ ab, welches auf Deutsch etwas unterstützen bedeutet.[51] Aber was unterstützt „Support“ eigentlich? Um diese Frage zu beantworten muss im Kontext dieser Arbeit der Begriff des Supports nicht nur in der Unternehmenspraxis betrachtet, sondern auch als Forschungsgegenstand kategorisiert werden.
“Web-based Support-Systems (WSS) is a domain of study on how to provide assistance to various human activities with the web as a user interface. It can be viewed as a multidisciplinary research involving the integration of domain specific studies and other disciplines such as computer.-science, information-systems and web-technology.”- [52]
Yao definiert Support als jede Unterstützung menschlicher Aktivitäten bestimmter Bereiche, basierend auf dem Einsatz von Computerwissenschaft, aufgabenspezifischer, sowie Informations- und Netztechnologie. Webbasierter Support ist zudem das Produkt eines Evolutionsprozesses.
Diese Definition impliziert somit, dass Software Kernprozesse zur Wertschöpfung unterstützt durch:
- Funktionen der Kernprozesse
Software unterstützt insbesondere in der Kultur und Kreativindustrie die kreativen Kernprozesse innerhalb der Wertschöpfungsstufen in Form von Video-[53] , Ton-, Bildbearbeitungssoftwares, sowie multimedialen Vertriebs- und Marketingprogrammen. Software stellt somit heute einen unmittelbaren Produktionsfaktor dar.[54] Diese Programme bedingen leistungsstarke Rechnersysteme und Hardware und fallen daher derzeit mehrheitlich in den Bereich der computergestützten Support Systeme.[55]
- Funktionen der Supportprozesse
Supportprozesse dienen der Sicherstellung von Kernprozessen bei Aktivitäten wie z.B. der Installation, Registrierung, Konfiguration und der sachgerechten Nutzung von Software. Zur Sicherstellung der Kernprozesse bzw. zur Unterstützung von CSS-Systemen, können wiederum integrierte lokale computerbasierte Systeme[56] , oder webbasierte Systeme unterstützend herangezogen werden.
Die Komplexität von netzbasierten Unterstützungsplattformen stellt eine große Herausforderung für die Entwickler dar. Am Anfang der Entwicklung von derartigen Systemen bedarf es der Kenntnis über Anforderungen der Nutzer und deren Wertschöpfungsprozesse. Diese jedoch ändern sich genauso, wie auch die Informationen die verwaltet werden sollen. Änderungen können durch neue Produktionsprozesse, Produkte und Dienstleistungen sowie durch technische Neuerungen wie Formate usw. entstehen. Daher sind diese Zusammenhänge bei der Skalierbarkeit und der Möglichkeit der Weiterentwicklung von Support stets zu berücksichtigen. Darüber hinaus liegt eine weitere Schwierigkeit bei der Entwicklung erreichbarer, sicherer und personalisierbarer Interfaces.
2.2.2 Wandel von computerisiertem zu webbasiertem Support
Der Nutzen von Computern bei der Lösung menschlicher Aufgaben ist unbestritten. Die Kombination von Software und Hardware hat zu einer erheblichen Rationalisierung bei der Durchführung von Arbeitsaufgaben gesorgt. Betrachtet man alte analoge Schnitt- und Editiertechnologien haben sich nicht nur die technischen Möglichkeiten erweitert, sondern auch die Workflows erheblich beschleunigt. Die Vielseitigkeit der Unterstützungspotentiale von „Computerized-Support-Systems“ (CSS) reicht unter anderem von Lehr- und Lernunterstützung (LSS)[57] , Datensammlung und –Ordnung (RSS)[58] , medizinischer Unterstützung (MSS)[59] bis hin zu Entscheidungsunterstützung (DSS)[60] .
Computerized Support Systems (CSS)
Computerisierte Unterstützung menschlicher Aktivitäten ist stets das Ergebnis der Kombination mindestens zweier oder mehrerer wissenschaftlicher Disziplinen. Zum Beispiel ist eine Software zur Unterstützung von bestimmten Design-Tätigkeiten (CAD) immer ein hybrides Ergebnis aus Computerwissenschaft und der Design-Disziplin der Ingenieurswissenschaft. Generell gilt also, dass ein bestimmtes Supportsystem nur bestimmte unterstützende Leistungen innerhalb eines definierten Bereiches erfüllt.[61]
CSS-Programme haben im Bereich der Kultur- und Kreativindustrie, insbesondere bei der Produktion und Postproduktion, relativ hohe Mindestanforderungen an Hardware-Systemvoraussetzungen. Einige Parameter die zu erfüllen sind betreffen die Rechnerkomponenten wie z.B. SSD Festplatten, OpenGL Grafikkarten, Soundkarten, AD-Wandler, Arbeitsspeicher und Prozessorleistung. Andere Parameter betreffen Interfaces und externe Effekt- und Rechenmodule.[62] Zudem müssen die generierten Daten noch verwaltet, geteilt und gelagert werden, was wiederum einen lokalen Speicherserver voraussetzt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6 Lokale CSS Umgebung zur Erfüllung von Kernprozessen bei der Filmproduktion.
Eigene Darstellung
Webbased Support Systems (WSS)
Das Internet mit seinen neuen technischen Möglichkeiten hinsichtlich der Lagerung, Darstellung, Sammlung, Teilung und Verarbeitung eröffnet demnach neue Vorteile für die Nutzung von Support-Systemen. Derzeit dienen WSS, aufgrund der hohen Systemanforderung für Kernprozesse, mehrheitlich der Unterstützung von Supportprozessen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 7 Architektur webbasierter Supportplattformen
Eigene Darstellung in Anlehnung an Yao.[63]
Yao formuliert die wichtigsten Vorteile[64] webbasierter Supportplattformen wie folgt:
- Bereitstellung einer Infrastruktur zur Informationsverarbeitung
- Zeitlich und räumlich unabhängige Informationen
- Benutzerfreundliche Interfaces (Browser)
Die Integration von CSS in das Internet ist als eine natürliche Evolution zu betrachten. Die hierdurch entwickelten „Web-based-Support-Systems“ (WSS) können also als Erweiterung von schon existierenden Unterstützungs-technologien gesehen werden. Es ist also festzuhalten, dass die zwingende Vorrausetzung für webbasierten Support die Anbindung von CSS an das Internet ist.
Support in der Praxis
Support und Service dienen dem Geschäftszweck indem sie ihn in vielerlei Hinsicht unterstützen, da diese als Bindeglied mehrerer Unternehmensbereiche wichtige Aufgaben übernehmen und als direkte Schnittstelle in Kommunikation mit dem Kunden steht. Support kann beispielsweise „inhouse“ zur Unterstützung von Mitarbeiten behilflich sein, Produktfehler identifizieren, Kunden bei Produktproblemen unterstützen und hierdurch die Kundenbindung stärken, was damit wiederum einen Mehrwert hinsichtlich des Marketingaspekts leistet.
Prinzipiell lässt sich in der Praxis Support in zwei Bereiche nämlich den technischen Support und den Kundendienst untergliedern. Unter Kundendienst versteht man im gebräuchlichen Sinne die unternehmensseitige Kundenbetreuung bei Fragen zur Rechnungsabwicklung, Lieferung, Rückgabe und Garantieleistungen. Der technische Support hingegen zielt auf die Unterstützung der Kunden bei der Handhabung von Produkten ab. Diese Unterstützung kann je nach Service-Level-Agreement (SLA) kostentechnisch variieren.[65] Es handelt sich dabei um eine Unterstützungsleistung mit bestimmten vertraglichen Eskalationsstufen nach dem Kauf. Externe Leistungen gelten als Teil des After-Sales-Customer-Relationship-Managements.[66] Interne Unterstützungsleistungen finden sich dagegen fast ausschließlich in mittleren und großen Unternehmen. Diese unterhalten in der Regel eine eigene IT-Abteilung um die Abwicklung des operativen Geschäfts zu sichern. „Kunden“ des Service sind in diesen Fällen eigene Mitarbeiter.
Hinsichtlich der Fragestellung dieser Arbeit beschäftigt sich der folgende Abschnitt nur mit der Betrachtung des technischen Supports und dies insbesondere als Kundenleistung bei externen Kunden.
2.2.3 Akteure von Support
Im folgenden Abschnitt werden die Hauptakteure des Support-Prozesses charakterisiert. Diese Anspruchsgruppen sind auf der einen Seite die User bzw. die Support-Suchenden und auf der anderen die Support-Leistenden. Leister von Support, welche dem Hilfesuchenden entweder Assisted-Support oder mit Daten zum Self-Service zur Seite stehen, sind in der Praxis Hersteller, Service-Partner und andere User.
- User
User in großen oder mittleren Unternehmen lassen ihre Probleme in der Regel erst von der eigenen IT-Abteilung lösen bevor dieser dann den externen Support konsultiert. Da die weitausüberwiegende Mehrheit der Unternehmen der Kultur- und Kreativindustrie aus Kleinst- und Kleinunternehmen[67] , besteht und davon auszugehen ist, dass diese keine eigene IT-Support Abteilung unterhalten, wird der hausinterne Support in dieser Arbeit nicht weiter behandelt.
Im Kontext der Frage nach den Akteuren können User sowohl im B2C- wie auch B2B-Bereich gemeint sein. Es ist dabei unerheblich, welchen Kenntnisstand der Hilfesuchende hat, da beispielsweise sogar Entwickler bei bestimmten Tasks Hilfe von Spezialisten in Anspruch nehmen müssen.[68]
Aufgrund der sich permanent verändernden Arbeitsumgebung und Weiterentwicklung von IT-Infrastruktur sehen sich Anwender zunehmend Überforderungen ausgesetzt. Durch Änderungen in der operativen Arbeitsumgebung z.B. bei Nutzung oder Installation gibt es immer wieder Situationen bei denen Sachkundige zu Rate gezogen werden müssen.[69] Dies kann beim Aufsetzen von PCs, Netzwerken, Druckern, Smartphones, Routern, ERP/CRM- oder Produktionssystemen in Soft- und Hardware der Fall sein.[70] Hinzu kommen Probleme bei Anwendungen, Logins, Störungen oder Virenbefall.[71]
- Hersteller von Produkten und Dienstleistungen
Der klassische Anbieter von Support sind die Hersteller von Produkten oder Dienstleister. Ihr Support und Kundenservice geschieht heute meist im Rahmen des CRM-Ansatzes. Dieser steuert alle unternehmensseitigen Aktivitäten mit Focus auf die Kundenbeziehung. Häufig verfügen Hersteller über eigene Supportabteilungen, welche über die verschiedenen Instrumente die Unterstützung des Kunden gewährleisten. Praxisbeispiele sind die IT-Supportabteilungen von Adobe[72] oder Microsoft.[73]
- Service-Partner und Dritte
Service-Partner können Händler, eigens auf ein bestimmtes Feld spezialisierte oder auch generalistische Dienstleister sein. Wichtigstes Kriterium ist hierbei, dass die Dienstleister in einer kommerziellen Beziehung zum Kunden stehen, aber nicht Hersteller des Produkts sind. Als Beispiel für händlerseitigen Support kann der reguläre Kundendienst von lizensierten Hard- und Software-Händlern wie Gravis[74] oder Thomann[75] herangezogen werden.
Supportdienstleister deren Geschäftsmodell der Support ist und die nicht durch den Handel mit IT-Produkten in Beziehung zum Kunden stehen, sind meist kleine und mittelständische Unternehmen mit regionalem Aktionsradius. Deren Tätigkeiten beschränken sich meist auf Notdienste bei der Neuinstallation von Betriebssystemen, Konfiguration von Netzwerken oder Entfernung von Viren und Trojanern.[76]
Andere dritte Akteure können webbasierte Netzwerk-Websites sein, welche im Sinne von Wirtzs 4C-Modell ein „Connection“-Geschäftsmodell betreiben[77] . Websites wie Justanswer.de[78] oder Livewebsupport.com[79] bieten eine Antwortdienstleistung für verschiedene Themen für B2C- oder B2B-Kunden an. Die dort gestellten Fragen werden an ein Expertennetzwerk weitergegeben und über einen Chat oder Email beantwortet.
- Peer-Service
Unter Peer-Support oder Peer-Service versteht man in der Praxis, wenn Nutzer anderen Nutzern bei der Lösung von Problemen helfen. Beispiele sind Newsgroups[80] , Communities[81] , Blogs[82] oder Foren[83] ,[84] in denen sich User für Support organisieren. In der Regel scheint diese Support-Handlung ohne kommerzielles Motiv. Es ist anzunehmen, dass meist die Eigeninitiative von Fortgeschrittenen oder Experten sich gegenseitig zu unterstützen der Grund für Peer-Support ist. Ihre Aktivität kollidiert mit dem Ziel der Kommunikationshoheit der Unternehmen.[85]
2.2.4 Kundenorientiertes IT-Servicemanagement
Die Orientierung von IT-Service Management mit dem Fokus auf den Kunden ist bei dieser Arbeit von zentraler Bedeutung. Um die Unterstützungspotentiale von webbasiertem Support für die Kultur- und Kreativindustrie auf technischer Ebene erfassen zu können, muss kundenorientiertes Management vorausgesetzt werden. Warum dies nicht für z.B. Preisführerschaft orientierte Unternehmen gilt ist, offensichtlich. Der Support als Mittel zur Gestaltung von Kundenbeziehungen würde, da es in der Regel kein Profit-Center ist, vernachlässigt werden. Es wird also im Rahmen dieser exemplarischen Ausarbeitung das Geschäftsziel der Kundenzufriedenheit vorausgesetzt. In der Praxis heisst dies, dass z.B der ITIL-Leitfaden, der für das strategische Management operationalisierbare Ziele voraussetzt, angewandt wird. Die Kundenzufriedenheit entspricht dieser Voraussetzung, da sie anhand der Anzahl der Folgegeschäfte abgeleitet werden kann.[86]
ITSM[87] als Administrative des Supports und Service, in strategischer Ausrichtung zum Kunden z.B. durch Integration in ein ganzheitliches CRM-Konzept, ist also zur Beantwortung dieser Ausarbeitung ein Paradigma. Im folgenden Abschnitt werden die Begriffe IT-Service- und Customer-Relationsship-Management geklärt um damit die Management-Ebenen des Supports im Blickwinkel dieser Arbeit zu festigen.
2.2.4.1 IT-Service-Management
IT-Service-Management ist die Managementdisziplin, welche alle Maßnahmen und Services zur Bereitstellung von Informationstechnologie (IT) hinsichtlich des Kundennutzens koordiniert. Ziel dieses Managements ist dem Kunden Hilfe bei Applikationen, IT-Infrastruktur und Entwicklung zu gewährleisten.
Nach Betz sind insbesondere folgende Charakteristiken und Kompetenzen von IT[88] erstrebenswert:
- IT muss flexibel und zeitnah Unterstützung bei operativen und
strategischen Bedürfnissen von Unternehmen leisten
- IT muss die Betriebsfähigkeit von computergestützten Systemen und
Infrastruktur sicherstellen
- IT muss transparent, kosteneffizient und kosteneffektiv operieren
- IT muss Kompetenzen in Risiko- und Sicherheitsmanagementbesitzen.
Im Rahmen des ITIL Ansatzes wird zusammengefasst, dass ITSM-Prozesse sich an konfligierende Anforderungen richten müssen um erfolgreich zu sein. Seine Aufgabe ist „ geplante “ und „ ungeplante “Tasks zu organisieren. „Geplant“ meint in diesem Zusammenhang geplante Verbesserungen oder Projekte wie zum Beispiel Integrations- oder Implementationsarbeiten. Wohingegen „ungeplante“ Tasks Probleme im Arbeitsablauf, Hilfestellungen oder Beratungen sein können.[89]
2.2.4.2 Customer-Relationship-Management
Das Customer-Relationship-Management (CRM) ist ein im Marketing angewandter strategischer Ansatz zur Kundengewinnung und Pflege von Kundenbeziehungen. Support wird aus CRM-Perspektive als Teil eines alle Unternehmensbereiche umfassenden Instrumentariums zum Management des Kundenlebenszyklus angesehen. Im Zentrum des CRM steht der Kunde. Mittels einer Integration von betrieblichen Prozessen und Instrumenten wird versucht, die Nachhaltigkeit von Kundenbeziehungen zu verbessern und somit eine Kundenbindung zu schaffen.
Ziel von CRM-Strategien ist es langfristig einen höheren Customer-Equity-Wert[90] als CRM-Kosten zu generieren und zukünftige Zuflüsse an Mitteln zu sichern. Demnach hat Support indirekt auch Einfluss auf den Wertschöpfungsprozess bei CRM-orientierten Unternehmen. Kundentreue ist in vielen Fällen erwiesenermaßen wesentlicher Bestandteil eines langfristigen Markterfolges, was wiederum bedürfnisgerechte Leistungen auch im Sinne des Unternehmers legitimiert.
Wesentliche Vorteile von CRM[91] , die sich auf die Hersteller von unterstützender Software übertragen lassen. sind unter anderem:
- Vertriebskosten für bestehende Kunden liegen weit unter Kosten der Neuakquise
- Produktlogik ist dem Kunden bekannt und muss daher nicht im vollen Umfang erklärt werden
- Zufriedene Kunden sind wertvolle Multiplikatoren
- Bestehende Kundenpotentiale lassen sich durch Up- und Cross-Selling erweitern
- Qualifizierte Marketing-Feedbacks, welche hilfreich für die Gestaltung individueller Kundenansprachen sind
- Langfristig sinkende Service- und Supportkosten
Die Organisationsbestandteile eines CRM-orientierten Managements sind Enterprise-Resource-Planning (ERP), Computer-Integrated-Manufacturing (CIM) und Supply-Chain-Management-Systemen (SCM).[92] Diese organisationstechnologischen Ansätze werden z.B. über sogenannte Ticketing-Systeme vernetzt und mit Analysetools sowie operativen Support-Applikationen verbunden. Kundenservice und Support werden in solchen Applikationen zusammengefasst und neben den anderen Organisationsbestandteilen in einem globalen System integriert.[93]
2.2.4.3 Gründe für die Integration von Support in CRM-Konzepte
Warum muss Support geleistet werden? Für Anbieter von Supportleistungen gibt es hierfür verschiedene Gründe. Im folgenden Abschnitt wird auf die für diese Arbeit wichtigsten Gründe eingegangen.
- „Service is the next Marketing“
In Zeiten gesättigter Märkte und steigenden Preiskampfes kann der Ansatz des Services-als-Marketing zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden. Entscheidet sich ein Unternehmen, das seine Produkte in einem hart umkämpften Markt anbietet, für eine Differenzierung durch Service, so kann es damit ein neues Alleinstellungsmerkmal schaffen. Auch für Unternehmen die keine ganzheitliche strategische Differenzierung Z.B. im Sinne einer Blue-Ocean-Strategie anstreben, ist Kundenzufriedenheit relevant.[94] Support schafft maßgeblich einen zusätzlichen Wert zum Produkt für den Kunden. Eine positive Erfahrung im Kundenkontakt entscheidet oft über mögliche Folgegeschäfte bei mehr oder weniger generischen Gütern, sowie über eine mögliche positive oder negative Funktion als Multiplikator.[95] Service und Support können durch positive Kundenerfahrungen präferenzbildende Effekte bei Dritten schaffen, welche sich zusätzlich besonders über Social-Media-Kanäle verwerten lassen.[96] Support als Dienstleistung ist somit den CRM-Zielen zuträglich.[97]
- Kommunikationshoheit als Grund für Kundenunterstützung
Dass dem User mit der neu gewonnenen Autonomie des Webs 2.0 selbst zu Medienschaffenden zu avancieren, kann zum Albtraum einer jeden Kommunikationsabteilung werden. Bekanntwerden von Service-Fehlern, Defekten, Störungen aber auch Fehlverhalten bis hin zu Gesetzesübertretungen lässt sich kaum mehr vermeiden. Support und Kundenservice bleiben auch von der medialen Emanzipation, dem Web 2.0 , nicht unangetastet. Verärgerte Kunden berichten über Pannen und schlecht, bis gar nicht ausgeführten Kundenservice.[98] Durch die Verbreitung dieser Erfahrungen via Blogs, Sozialen Netzwerken, Audio- und Video-podcasts verlieren Unternehmen zunehmend die Kontrolle über die eigene Marke.[99] Überdies tendieren zunehmend User, bei steigender Popularität einer Software, selbst zum Supporter zu werden. Sie gründen Blogs mit Tutorials oder laden Videomitschnitte zu verschiedensten Themen für andere User unterschiedlichster Wissensstände ins Netz.[100] Als Motiv hierfür nennen Nauman, S. Khan und Khan das Missverhältnis der Anforderungen der User zu den bestehenden Hilfe-Systemen. Auch hier wird der Einfluss des Unternehmens auf die eigene Marke bedroht.[101]
- Support als Quelle für Kundeninformationen
Unter Customer-Data versteht man die Summe an gesammelter Information über den Kunden. Support im Sinne des Customer-Relationship-Managements ist eine Möglichkeit zur Gewinnung kundenbezogener Daten. Bei sachgemäßer Interpretation solcher Daten aus den verschiedenen Kanälen ergibt sich ein recht umfassendes Bild des Kunden, dessen Interessen und Kaufverhalten.[102] . Mit diesen Daten werden Kundensegmente identifiziert und zu Clustern zusammengefasst. Die Cluster können z.B. Informationen zum Markt und Kundenstamm liefern und bei strategischen und kommunikationsrelevanten Überlegungen helfen. Konsolidierte Daten ermöglichen im operativen Geschäft Sachbearbeitern alle zum Kunden verfügbare Informationen aufzurufen und somit Fragen oder Probleme nach dessen Bedürfnissen zu bearbeiten.[103] Besonders der Organisation von Support und Kundendienst kann dies ein entscheidender Vorteil, sein um gute Kundenerfahrungen zu schaffen.
- Kontinuierliche Produkt- und Dienstleistungsverbesserung
Support steht stets in einer engen Beziehung zu Produkt oder Dienstleistung. Durch User-Device Interaktion werden produktinhärente Fehler oder Usability-Probleme häufig erst deutlich.[104] ,[105] Sie sind der eigentliche Grund für den Bedarf an Unterstützung bei der Handhabung von Soft- und Hardware. Hilfeanfragen sind also auch Hinweise auf Defizite der Produkte und helfen dabei, Fehler zu identifizieren. Supportanwendungen sind demnach auch ein nützliches Feedback- und Optimierungstool. Treten z.B. viele Hilfeanfragen zu einem bestimmten Thema auf, so kann dies ein Hinweis auf ein größeres Problem sein. Wird dieser Hinweis nicht für eine Korrektur genutzt, kann dies durch häufige Betreuungsanfragen oder sogar Schadensersatzforderungen kostspielig für den Hersteller werden. Ist ein solches Problem identifiziert so kann es bestenfalls über einen „Patch“ oder ein Update gelöst und damit eine grundsätzliche Produktverbesserung vorgenommen werden. ITSM-Systeme können also bei richtiger Anwendung im Bereich Support zusätzlich Treiber für Innovation im Unternehmen sein.[106]
2.2.5 Operative Dimensionen von Support
Im folgenden Abschnitt wird auf die kommunikationsrelevanten Dimensionen des operativen Supportgeschäfts eingegangen.
2.2.5.1 Support Offline und Online
Unterscheidet man Support im Bereich der Supportprozesse danach, wo dieser formal in der Praxis stattfindet, so kann man grundsätzlich zwischen Online und Offline Services differenzieren. Im Grunde ist die Transformation von Supporthandlungen aus der realen Welt in die virtuelle Realität des Internet ein logischer Akt der Weiterentwicklung.
Offline Support sind in der Regel Dienstleistungen in Call-Centern, Vor-Ort-Services und lokale computergestützte Support-Systeme. Diese Art des Supports wird insbesondere in der Industrie von Großunternehmen z.B. in Form eines Ersatzteilservice oder bei der Implementation von Abwicklungssystemen angewandt. Auch Wartungsarbeiten welche nicht online abgewickelt werden können, werden auf diese Weise erledigt.[107] Bei Offline-Dienstleistungen mit Personalbeteiligung ist davon auszugehen, dass diese gemeinhin kostenintensiver sind als vergleichbare Online Lösungen bei selben Problemtypen. Gründe hierfür sind in erster Linie Reise- und Personalkosten aber auch Schulungskosten für kundengerechte Kundenkommunikation bei Callcentern. Nachteil von lokalen computergestützten Supportsystemen ist das deren Menge an Supportinformationen limitiert ist.
Online Support sind alle Support-Dienstleistungen, welche via Internet-Kommunikation durchgeführt werden. Im Laufe der Digitalisierung, der Netzverbreitung, Entwicklung mobiler Netze und der Erhöhung von Bandbreiten hat sich eine Fülle von neuen Instrumenten zur Unterstützung von Usern entwickelt, welche im Abschnitt zum technischen State-Of-The-Art[108] näher erläutert werden. Typische Instrumente sind: Knowledge-Basis, Web- und Text-Chats, Instant Messenger, FAQs, Automatische Email, Screen Sharing, Remote Control und Diagnose, Elektronic-Case-Submission, Foren, Webinars, Cloud- Anwendungen und Social-Media Applikationen.
2.2.5.2 Modi von Support
Unter Modi von Support soll im Kontext dieser Masterarbeit die Arten von Supporttätigkeiten unterschieden werden. In diesem Sinne meint „Modus“[109] die Unterscheidung, ob die Instrumente von Support jeweils von dem Supportsuchenden, oder Supportleistenden aktiv oder passiv bedient werden. Grundsätzlich unterscheidet man hierbei Assisted-Support und den Self-Service.
- Assisted-Support
Unter Assisted-Support versteht man in der Praxis alle Supporthandlungen die aktiv von einem Supportleistenden durchgeführt werden. Der Begriff „Assisted-Support“ leitet sich vom englischen Verb „assist“, welches so viel wie assistieren, mitwirken oder nachhelfen bedeutet, ab.[110] ,[111] Typische Assisted-Support-Instrumente sind u.a. Remote-Services, Chats, Telefonsupport, Voice-Over-IP und Emails.
- Self-Service
Das Gegenteil von Assisted-Support ist der sogenannte Self-Service. Dieser Begriff beschreibt das Vorgehen seitens des Hilfesuchenden, welches sich dadurch auszeichnet, dass jener dazu tendiert selber nach Lösungen seines Problems zu suchen anstatt den Support zu kontaktieren. Diese Kunden suchen in Knowledge-Bases, FAQs und im Social-Web nach Inhalten, laden sich selber Patches oder Bug-fixes herunter und installieren diese. Die jeweiligen Daten in denen der Hilfesuchende nach Problemlösungen sucht können von jeder Art Supportleistendem ins Netz gestellt werden. Eine Studie von ServiceXRG (2008) besagt, dass die Suche nach Hilfe bei technischen Problemen 79% der User auf die Website des Herstellers führt. Alternativen sind Special-Interest-Foren, Produktforen oder die Suche im Web und Web 2.0.[112] Self-Service spielt daher schon aus Gründen der Kommunikation für den Supportleister eine wichtige Rolle.
2.3 Das Internet als Umgebung für Support
Um die Hintergründe des Online-Supports einzuordnen, wird im folgenden Teil der Arbeit das Medium Internet in einen globalen kommunikativen Kontext eingeordnet, die Entwicklung vom computerisierten Support hin zum webbasierten Support dargelegt und die Faktoren Medienkonvergenz, Virtuelle Netzwerke, Web 2.0 und Cloud Computing identifiziert.
2.3.1 Einordnung des Internets
Das Internet gilt heutzutage als die wichtigste Instanz der Informations- und Kommunikationstechnologie. Es ist ein dezentrales, globales, öffentliches Netzwerk von Computersystemen, welches über elektronische Datenübertragung Informationen vermittelt.[113] Die Verbindungen dieser Netzwerke sind kabellos, elektronisch oder optisch und übertragen über den Verbindungsstandard zur Netzwerkerkennung TCP/IP Daten.[114] Das Internet bietet vielfältige Möglichkeiten Netzwerke und Kommunikation für Unternehmen zu nutzen. Hinzu kommt, dass es alte Medien formal in sich vereint und neu definiert[115] , sowie neue Medien[116] schafft.
2.3.2 Digitale Stakeholderkommunikation
Durch die Digitalisierung und Steigerung von Übertragungsbandbreiten wurde es möglich, einst traditionelle Medien wie Rundfunk, Telefonie, Bücher, Zeitschriften, Computerspiele oder Musik umgestalten und neu zu definieren.[117]
Die Digitalisierung bildet die technologische Basis der medialen Konvergenz wobei die steigenden Übertragungsraten es ermöglichen, wachsende Mengen an digitalisierten Daten über das Internet zu übertragen.[118] Durch die Transformation von Medien aus der analogen Welt in die Digitale ergeben sich somit verbesserte Rahmenbedingungen für unternehmerische Kommunikation zur Überbrückung räumlicher und zeitlicher Distanzen.
Mit der Überbrückung dieser Klüfte ergibt sich eine weitere Betrachtungsweise. Es entstehen neue Chancen der synchronen[119] und asynchronen[120] Stakeholderkommunikation. Als asynchrone Kommunikation wird bezeichnet in diesem Kontext die Kommunikation, welche zeitlich ungebunden ist. Emails sind ein typisches Beispiel für eine asynchrone Computer-Vermittelte-Kommunikation. Eine synchrone netzbasierte Kommunikation ist dagegen der Chat oder die Internettelefonie. Zwingendes Merkmal ist die zeitgleiche Anwesenheit der Kommunikatoren.
Überdies gibt es neben der Synchronen / Asynchronen Unterscheidung noch die Kategorisierung der Kommunikation nach der Anzahl der Beteiligten[121] in:
- One-To-One
Nur ein Sender und ein Empfänger kommunizieren
- One-To-Many
Ein Sender kommuniziert mit vielen Empfängern
- Many-To-Many
Viele Sender kommunizieren mit vielen Empfängern
2.3.3 Virtuelle Netzwerke Im Netzwerk
Durch die Datenübertragung von Datenpaketen in elektronischenNetzwerken, welche zusammen das Internet ergeben, ist es aber nicht nur möglich im herkömmlichen Sinne zu kommunizieren, sondern auch über sogenannte VPN-Verbindungen eigene virtuelle Netzwerke im Internet zu erstellen und dort Fernzugriffe auf Computersysteme auszuüben.[122] ,[123] Das Akronym „VPN“ steht für Virtuell-Private-Netzwerke. Ein „VPN“ ist also eine private Verbindung von Netzwerken durch Nutzung öffentlicher Kommunikationsinfrastrukturen. Durch diese Netzwerkverbindungen ist es möglich Rechner zu steuern und damit Aufgaben über große Distanzen auszuführen.[124] ,[125] VPN Verbindungen sind der technologische Grundstein für die Ausführung von ferngesteuerter Programmwartung, -installation und -konfiguration.
Zu unterscheiden sind zwei unterschiedliche Einsatzmodi:
- VPN als optische Übertragungstechnik. Hierbei hat der Supporter nur die Möglichkeit die Arbeitsumgebung des Anwenders passiv einzusehen um dann über eine Chatleiste oder VoIP Instruktionen zu geben.[126]
- VPN als aktive Verbindung bei welcher, der Supportleistende direkten Zugriff auf den Rechner des Anwenders hat.[127]
2.3.4 Web 2.0 Kommunikation
Social-Media oder Web 2.0 sind Überbegriffe für interaktive, kollaborative Konzepte der Internetkommunikation. Diese Konzepte der Nutzung von Internettechnologien erlauben es den Nutzern selbst zu Medienschaffenden zu werden und nicht mehr wie in der Vergangenheit nur Konsument von Medien zu sein.[128] Soziale Medien sind Treiber für soziale Interaktionen zwischen Usern im Internet. Inhalte werden also von Usern im Social-Web selber generiert und nicht mehr nur rezipiert. Hierdurch werden die „Consumer“ oder „User“ zu sog. „Prosumern“ bzw. „Produsern“.[129] Im Unternehmenskontext bietet das Web 2.0 neue Anwendungsmöglichkeiten und Instrumente, welche in die bestehende Unternehmenskommunikation integriert werden können.[130] ,[131]
[...]
[1] BMWi [2011] S. 19
[2] Fesel, Däubler [2007] S. 31
[3] BMWi [2009, 1] S.142
[4] Mundelius [2009] S. 17
[5] Vgl. BMWi [ 2009], S.1 ff.
[6] Vgl. Europäische Kommission [2010] , S.8
[7] Vgl. UNTCAD [2010], S. 3
[8] Vgl. Yamada, [2007], S. 2 ff.
[9] Vgl. department for culture, media and sports [2011], S.6 ff
[10] Vgl. creativeclassgroup [2012]
[11] Vgl. Howkins [2012]
[12] Vgl. Mundelis [2009]
[13] Vgl. BMWi, [2009] S. 25
[14] Definition nach Holm-Hadulla: „Kreativität =Neukombination von Informationen“. Vgl. Görike [2011]
[15] Vgl. Smeyers [2012]
[16] Vgl. Landau [1984] S. 14
[17] Vgl. Krippahl [2012]
[18] Vgl. UrhrG, [2012], §2 ff
[19] Vgl. Merkel [2008], S.20
[20] Vgl. BMWi [ 2009], S.27
[21] Benkert, W. [1998] S. 13
[22] Vgl. Fesel B. / Däubler C. [2007], S. 21
[23] Vgl. BMWi [ 2009], S.
[24] Vgl. KfW, [2012]
[25] Vgl. Europäische Kommission [2005], S. 12 ff.
[26] Siehe Punkt 2.1.1.3 Branchenabgrenzung
[27] Vgl. BMWi [ 2009], S.29, 126
[28] Vgl. Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes NRW [2012], S. XII
[29] Vgl. Bundesrat [2009] S. 6
[30] Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon [2012]
[31] Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon [2012]
[32] Vgl. BMWi [ 2009], S.49, 59,
[33] Vgl. Statista [2006]
[34] Siehe Abb. 2
[35] Vgl. BMWi [ 2009], S. 56- 66 ff.
[36] Vgl. BMWi [2009], S. 58
[37] Vgl. Erdmann [2000], S.27, 73
[38] Vgl. Merkel [2008], S. 20 ff.
[39] BMWi [2009], S. 24
[40] BMWi [2009], S. 30
[41] Z.B. MP3s, AVIs, MPEG-3
[42] Z.B. CD, DVD oder Blu-Ray-Disc
[43] Z.B. Vinyl, Audio-Cassette, VHS, Tonband, Betacam
[44] Vgl. BVMI [2010] S. 23
[45] Z.B. Interface von Ableton Live 8, Live Performance Software für Musiker
[46] Vgl. Helmholz [2011] S. 11
[47] Vgl. Capgemini Consulting [2011] S.3
[48] BMWi [2009, 2] S. 28
[49] BMWI, Kultur- und Kreativwirtschaft nach Umsatzgrößenklassen [2006]
[50] Vgl. Gierke [2001] S.85
[51] Dict.Leo.org [2012]
[52] Tao-Yao [2005] S. 1
[53] Z.B. Sony Vegas, Steinberg Cubase, Adobe Photoshop
[54] Vgl. Gierke [2001] S. 95-98
[55] Vgl. Systemvoraussetzungen Avid Studio. avid-force.com [2012]
[56] In den Produktionssoftwares integrierte Help-Applikationen.
[57] Z.B. atutor.ca [2012]
[58] Z.B. genios.de [2012]
[59] Z.B. icehealthsystems.com [2012]
[60] Z.B. Cognos® von IBM. IBM.com [2012]
[61] Vgl. Tao-Yao [2005] S. 1-2
[62] Z.B. Systemanforderungen für Autodesk Maya 2013 oder Avid Pro-Tools HD 10. Autodesk.de,
Avid.com [2012]
[63] Vgl. Yao [2005, 2] S. 3
[64] Vgl. Yao [2005, 2] S. 1-2
[65] Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon [2012]
[66] Vgl. Angermeier [2012]
[67] Zahlen 2008: 225.868 Kleinstunternehmen und 5.336 Kleinunternehmen von insgesamt 232.578 Unternehmen. BMWi 2 [2009]S. 28
[68] Vgl. Schuster [2010] S. 13
[69] Vgl. Support Squad [2012]
[70] Vgl. ICM [2012]
[71] Vgl. Symantec [2012]
[72] Adobe.com/Support [2012]
[73] Support.microsoft.com [2012]
[74] Gravis.de/Services [2012]
[75] Thomann.de/Helpdesk [2012]
[76] Diverse KMU mit regionalen IT-Dienstleistungen [2012]
[77] Vgl. Wirtz [2011] S. 695 ff.
[78] Justanswer.de [2012]
[79] Livewebsupport.com [2012]
[80] Z.B. Atozed.com [2012]
[81] Z.B. Steinberg Community [2012]
[82] Z.B. Photoshopsupport.com [2012]
[83] Z.B. Studionu.com [2012]
[84] Z.B. thewombforums.com [2012]
[85] Siehe Absatz zu Gründen für Support, Punkt 2.2.4.3
[86] Vgl. OGC [2010] S. 35-37
[87] Siehe IT-Service Management, Punkt 2.2.4.1
[88] Vgl. Betz [2007] S. 4-5
[89] Vgl. ITIL Application Support [2008] S. 3-4
[90] Kumulierte monetäre (Customer-Lifetime-Values) und nicht-monetäre Werte aller Kunden des Unternehmens. Gabler [2012, 2]
[91] Vgl. Reichheld, Teal [2001] S. 42-48
[92] Z.B. Zendesk.com [2012]
[93] Vgl. Holland [2012]
[94] Vgl. Chan-Kim, Mauborgne [2004] S. 2
[95] Vgl. Resellerguide.com [2007]
[96] Vgl. Körner [2012] S.14
[97] Siehe Gründe für die Integration von Support in CRM- Konzepte, Punkt 2.2.3.2
[98] Vgl. Alpar, Paul ; Blaschke, Steffen [2008] S. 41-47
[99] Vgl. Gilhooly [2009] S. 1
[100] Z.B. webdesignerledger.com [2012]
[101] Vgl. Nauman, Kahn, S. Kahn [2010] S. 45
[102] Neben dem Support z.B. Verkauf, Marktforschung oder Disposition
[103] Vgl. Sarenac [2012]
[104] Vgl. Mekovic [2007] S. 2
[105] Zur „qualifizierten“ Evaluierung durch den User mittels E-Service oder des Support bedarf es jedoch i.d.R. zusätzlich einer systematischen „E-Service Quality Evaluation“. Die häufige Kundeninteraktion hinsichtlich eines bestimmten Problems ist jedoch häufig schon Hinweis auf Handlungsbedarf.
[106] Vgl. Bon, [2008] S. 39
[107] Z.B. Siemens Service Portfolio
[108] Siehe Möglichkeiten webbasierten Supports, Punkt 3.2.1
[109] Latein für „Art und Weise“
[110] Vgl. Orbán [2007]
[111] Supportindustry.com [2012]
[112] Vgl. Gilhooly [2009] S. 2-3
[113] Vgl. Cantoni [2006] S. 1-4
[114] Vgl. pcmag.com [2012]
[115] Z.B. eBooks
[116] Z.B. Instant Messenging
[117] Vgl. Europäisches Zentrum für Medienkompetenz GmbH [2008] S. 2-3
[118] Vgl. Wirtz [2011] S. 48
[119] Z.B. Chat, VoIP, Videokonferenzen
[120] Z.B. Email, Mailinglisten, Internetforen, Blogs
[121] Vgl. Moore, Brauch, Haustein, Schneider [2008]
[122] Vgl. Binder [2008]
[123] Vgl. Zimmer [2008]
[124] Vgl. Olifer [2012] S. 3 ff.
[125] Vgl. vpnc.org [2008]
[126] Z.B. Teamviewer.com [2012]
[127] Z.B. Sysaid.com [2012]
[128] Vgl. Alpar; Blaschke [2008] S. 290
[129] Vgl. Herrmann [2011] S. 10-11
[130] Vgl. Schulz-Bruhdoel [2011] S. 129 ff.
[131] Vgl. Baumgart [2010] S. 4-6
Details
- Titel
- Möglichkeiten und Grenzen von internetbasierten Supportplattformen zur Unterstützung der Kreativindustrie
- Hochschule
- Hochschule Fresenius; Köln
- Autor
- Andy Helmholz (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2012
- Seiten
- 165
- Katalognummer
- V201122
- ISBN (eBook)
- 9783656281887
- ISBN (Buch)
- 9783656282426
- Dateigröße
- 1881 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- webbasierte Supportplattformen websupport medienmanagement adobe photoshop steinberg cubase WSS CSS RSS kulturwirtschaft kreativwirtschaft Kultur- und Kreativindustrie Kulturindustrie Kreativindustrie Mediendesign Medienproduktion Musikproduktion Filmproduktion Cloudcomputing
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 41,99
- Preis (Book)
- US$ 55,99
- Arbeit zitieren
- Andy Helmholz (Autor:in), 2012, Möglichkeiten und Grenzen von internetbasierten Supportplattformen zur Unterstützung der Kreativindustrie, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/201122
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-