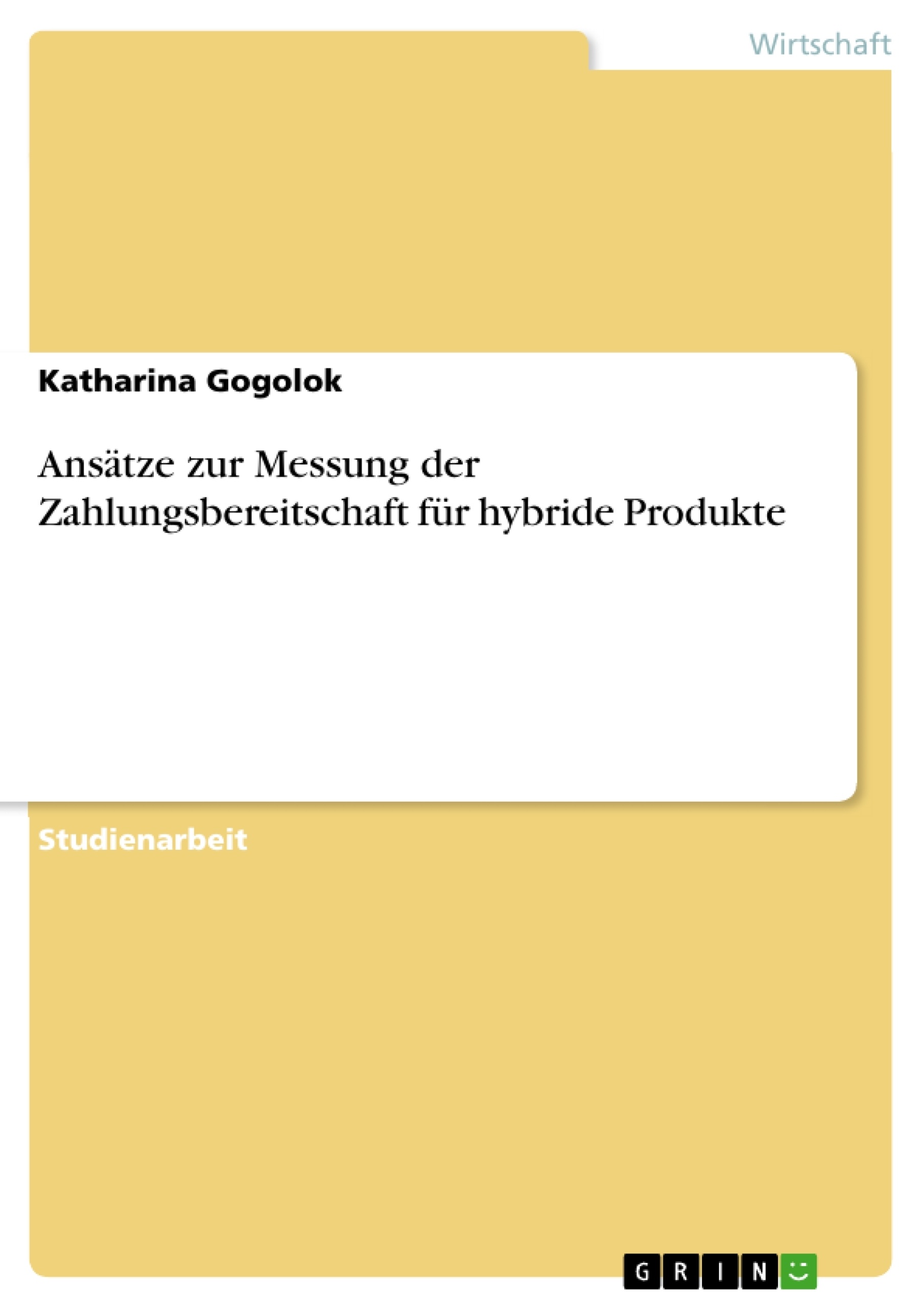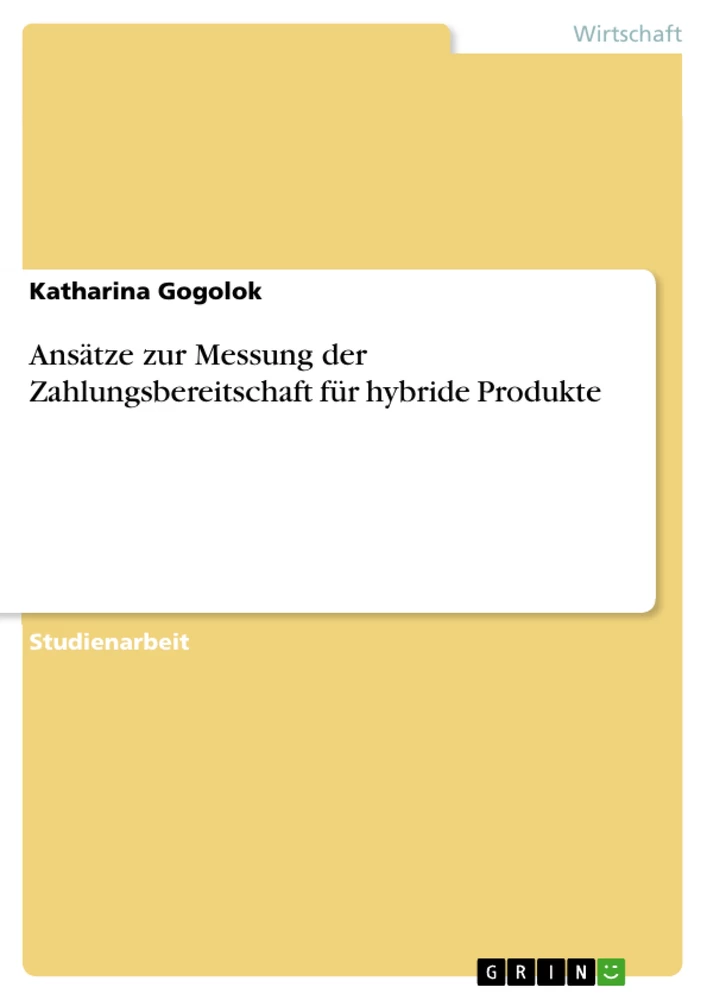
Ansätze zur Messung der Zahlungsbereitschaft für hybride Produkte
Seminararbeit, 2011
32 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Kenntnis der Zahlungsbereitschaft für hybride Produkte als Voraussetzung erfolgreicher Wertschöpfung
2. Messung der Zahlungsbereitschaft im Kontext hybrider Produkte
2.1 Begriffsverständnis hybrider Produkte
2.2 Einflussfaktoren auf die Zahlungsbereitschaft hybrider Produkte
2.3 Anforderungen an Methoden zur Ermittlung der Zahlungsbereitschaft für hybride Produkte
2.3.1 Anforderungen an Methoden zur Eignung der Zahlungsbereitschaftsmessung für hybride Produkte
2.3.2 Anforderungskriterien an Messmethoden aus Marktforschungssicht
3. Methoden zur Ermittlung der Zahlungsbereitschaft hybrider Produkte
3.1 Überblick über ausgewählte Methoden zur Messung der Zahlungsbereitschaft
3.2 Beurteilung der Methoden anhand der Anforderungen
3.2.1 Eignungsprüfung der Messmethoden für hybride Produkte
3.2.2 Bewertung geeigneter Methoden hinsichtlich Anforderungskriterien aus Marktforschungssicht
4. Notwendigkeit weiterer empirischer Untersuchungen geeigneter hybrider Conjoint-Analyse Verfahren für hybride Produkte
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was sind hybride Produkte?
Hybride Produkte sind Leistungsbündel, die aus einer Kombination von Sachleistungen und Dienstleistungen bestehen, um kundenindividuelle Lösungen anzubieten.
Warum ist die Messung der Zahlungsbereitschaft hier schwierig?
Aufgrund der Komplexität, der Vielzahl an Merkmalen und der Beschaffungsunsicherheit stoßen klassische Methoden oft an ihre Grenzen.
Was ist die HILCA-Methode?
Die HILCA (Hybrid Individualized Limit Conjoint Analysis) kombiniert kompositionelle Ansätze mit der Limit Conjoint Analysis, um kundenindividuelle Präferenzen bei komplexen Bündeln besser zu erfassen.
Wie unterscheidet sich HILCA von der herkömmlichen LCA?
Während die LCA bei mehr als fünf Merkmalen ungenau wird, erlaubt die HILCA die Auswahl der individuell wichtigsten Merkmale aus einer großen Menge von Optionen.
Welche Rolle spielt die Beschaffungsunsicherheit?
Kunden sind oft unsicher bezüglich der Qualität von Dienstleistungsanteilen. Die Arbeit stellt fest, dass dieser Aspekt in aktuellen Messmodellen noch zu wenig berücksichtigt wird.
Details
- Titel
- Ansätze zur Messung der Zahlungsbereitschaft für hybride Produkte
- Hochschule
- Universität des Saarlandes
- Note
- 1,7
- Autor
- Katharina Gogolok (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 32
- Katalognummer
- V201894
- ISBN (eBook)
- 9783656283102
- ISBN (Buch)
- 9783656283232
- Dateigröße
- 555 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- schriftliche Note betrug 1,3. Aufgrund einer etwas schlechteren Präsentation wurde die Note mit 1,7 festgesetzt
- Schlagworte
- hybride Produkte Zahlungsbereitschaft
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 17,99
- Preis (Book)
- US$ 21,99
- Arbeit zitieren
- Katharina Gogolok (Autor:in), 2011, Ansätze zur Messung der Zahlungsbereitschaft für hybride Produkte, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/201894
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-