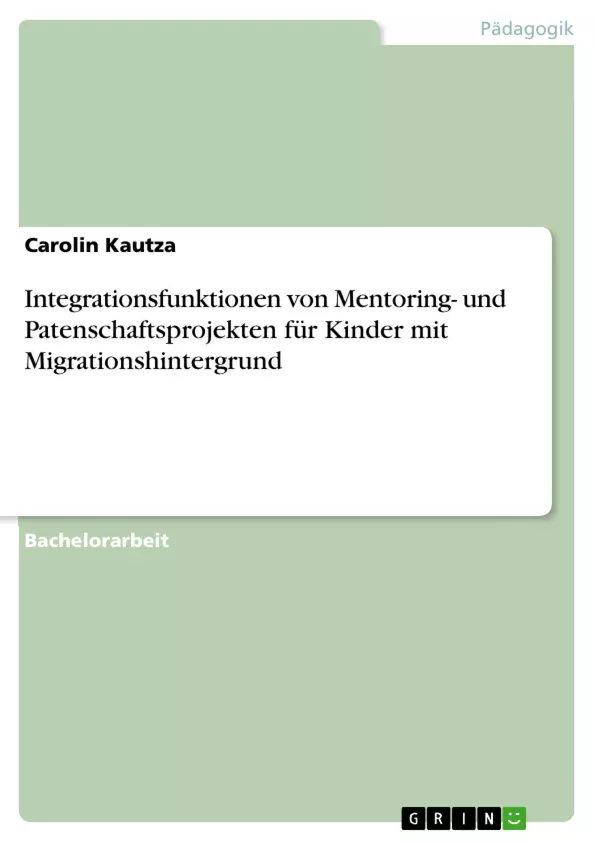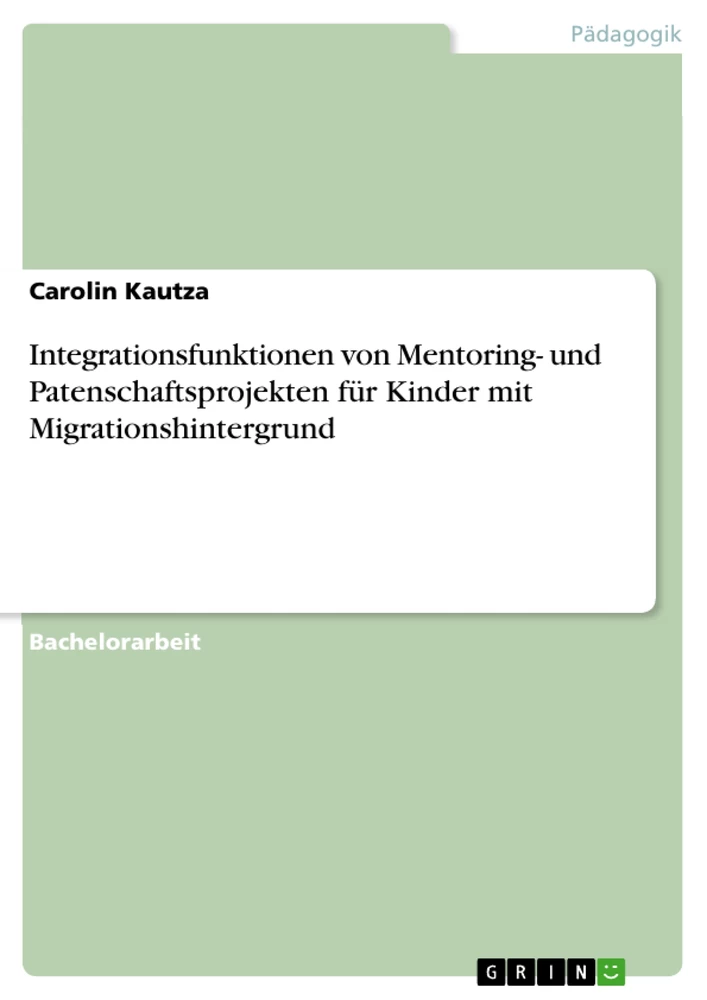
Integrationsfunktionen von Mentoring- und Patenschaftsprojekten für Kinder mit Migrationshintergrund
Bachelorarbeit, 2010
42 Seiten, Note: 1,3
Didaktik für das Fach Deutsch - Pädagogik, Sprachwissenschaft
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Definitionen und Begriffe
2.1 Patenschaft
2.2 Mentoring
2.3 Migration
2.4 Integration
3 Handlungsfelder von Integration
3.1 Handlungsfeld Sprache
3.2 Handlungsfeld Bildung
3.3 Handlungsfeld Beruf
3.4 Handlungsfeld Gesellschaft
3.4.1 Integration vor Ort
3.4.2 Die kulturelle Integration
3.4.3 Gleichstellung zwischen Männern und Frauen
3.5 Bürgerliches Engagement
4 Analyse
4.1 Patenschaftsprojekte für Kinder
4.1.1 Bildungspatenschaften
4.1.1.1 Bildungspatenschaft „Bildung für alle!“
4.1.1.2 Mentoren- und Stipendienprojekt „Ağabey – Abla“
4.1.2 Lesepatenschaften
4.1.2.1 Leseprojekt „LiA – Lesen in Altona“
4.1.2.2 Integrationsprojekt „MärchenKinder“
4.2 Mentoringprojekte für Jugendliche
4.2.1 Mentoringprojekt „Hürdenspringer“
4.2.2 Mentoringprojekt „Neue Wege in den Beruf“
4.3 Zusammenfassende Betrachtung der Analyse
5 Fazit
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Patenschaft und Mentoring?
Die Arbeit definiert beide Begriffe im Kontext der Integrationsförderung für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund.
In welchen Bereichen fördern diese Projekte die Integration?
Zentrale Handlungsfelder sind Sprache, Bildung, Beruf und die allgemeine gesellschaftliche Teilhabe.
Was ist das Zuwanderungsgesetz von 2005?
Ein Gesetz, mit dem Deutschland die Integration erstmalig als offizielle staatliche Aufgabe anerkannte.
Welche konkreten Projekte werden in der Arbeit analysiert?
Behandelt werden unter anderem „Ağabey – Abla“, „Lesen in Altona“ (LiA) und das Mentoringprojekt „Hürdenspringer“.
Warum ist bürgerliches Engagement für Integration wichtig?
Da staatliche Maßnahmen allein nicht ausreichen, leistet die Zivilgesellschaft durch Mentoring einen entscheidenden Beitrag zur kulturellen Integration.
Details
- Titel
- Integrationsfunktionen von Mentoring- und Patenschaftsprojekten für Kinder mit Migrationshintergrund
- Hochschule
- Freie Universität Berlin
- Veranstaltung
- -
- Note
- 1,3
- Autor
- Carolin Kautza (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2010
- Seiten
- 42
- Katalognummer
- V202508
- ISBN (eBook)
- 9783656308522
- ISBN (Buch)
- 9783656311454
- Dateigröße
- 515 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Beurteilung vom 1. Prüfer: - gut gegliedert - Textteile angemessen gewichtet - umfangreiches Literaturverzeichnis - sehr guter Gesamteindruck
- Schlagworte
- Migration Mentoring Patenschaft Migrationshintergrund Pädagogik Mentor Pate Integration Handlungsfelder von Integration Bildungspatenschaften Lesepatenschaften Mentoringprojekte Patenschaftsprojekte Kinder Jugendliche Bachelorarbeit Funktionen Integration
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 15,99
- Preis (Book)
- US$ 26,99
- Arbeit zitieren
- Carolin Kautza (Autor:in), 2010, Integrationsfunktionen von Mentoring- und Patenschaftsprojekten für Kinder mit Migrationshintergrund, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/202508
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-