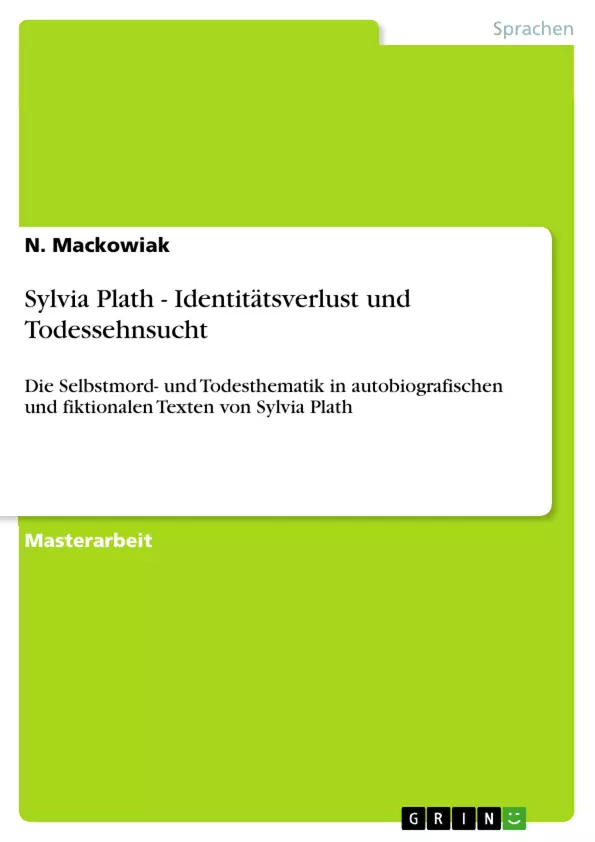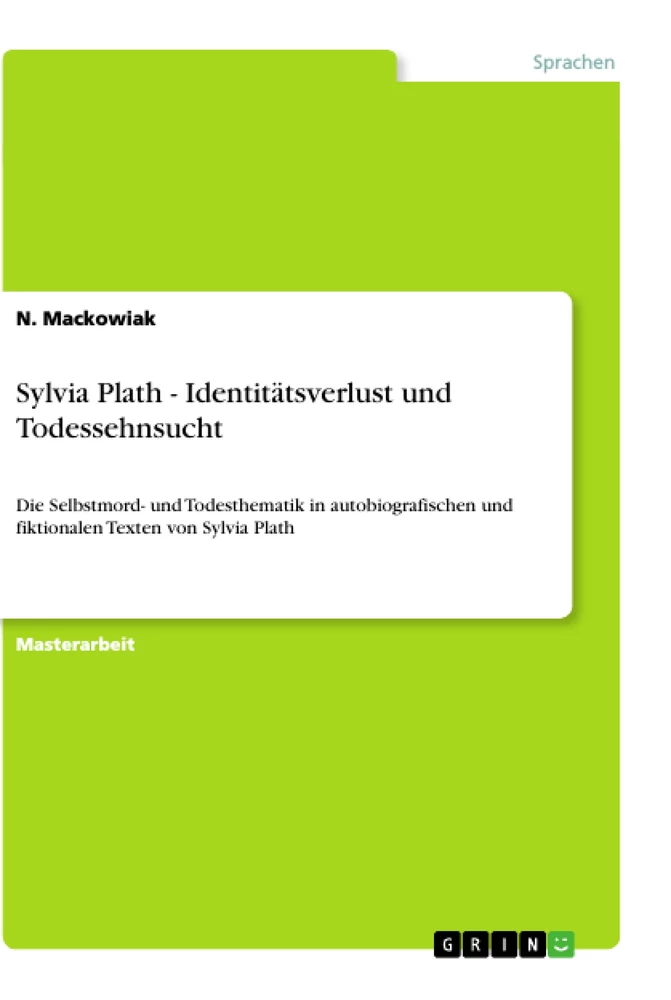
Sylvia Plath - Identitätsverlust und Todessehnsucht
Masterarbeit, 2012
70 Seiten
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Sylvia Plath und gesellschaftspolitische Kontexte
- 1.1 Biografisches
- 1.2 Ideologie und Gesellschaft
- 1.3 Der Rollenkonflikt als Krisenherd
- 2 Der Tod im Roman - Die Glasglocke
- 2.1 Entstehung und Inhalt
- 2.2 Die Vorzeichen des Todes: Esthers Identitätssuche
- 2.2.1 Der Feigenbaum
- 2.2.2 Die Doubles
- 2.2.3 Doreen
- 2.2.4 Dodo und Mrs. Willard
- 2.3 Selbstmord als Möglichkeit
- 2.3.1 Die Krankheit zum Tode
- 2.3.2 Der Entschluss
- 2.3.3 Durchführung und Wiedergeburt
- 2.3.4 Joan
- 3 Der Tod als Chiffre – Die späte Lyrik
- 3.1 Sylvia Plath als „Confessional Poet“
- 3.1.1 Merkmale und Begriffsbestimmung
- 3.1.2 Die Auflösung des Du
- 3.2 Ariel und die Gesichter des Todes
- 3.2.1 Die Wiederbelebung des Du
- 3.2.2 Identität und Initiation
- 3.2.3 Wiedergeburt
- 3.2.4 Reinheit
- 3.2.5 Der duale Tod
- 4 Der reale Tod als Ausgangspunkt – Die Tagebücher
- 4.1 Ted Hughes als Herausgeber
- 4.2 Die Schwierigkeit der Authentizität
- 4.3 Die Selbstmordthematik als roter Faden
- 4.3.1 Das Double oder die Distanzierung vom Ich
- 4.3.2 Liebe
- 4.3.3 „The air of pressure“
- 4.4 Briefe nach Hause - Ein Deutungsversuch
- 5 Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Thematik von Identitätsverlust und Todessehnsucht in den autobiografischen und fiktionalen Texten Sylvia Plaths. Ziel ist es, die Darstellung des Todes und des Selbstmordes in ihren verschiedenen literarischen Werken – dem Roman „Die Glasglocke“, der Lyrik (insbesondere „Ariel“) und den Tagebüchern – zu analysieren, ohne die Werke allein biografisch zu interpretieren. Die Arbeit hinterfragt die gängige Gleichsetzung von Biografie und Werk und konzentriert sich auf eine werkimmanente Interpretation.
- Identitätsverlust als zentrales Motiv in Sylvia Plaths Werk
- Darstellung des Todes und Selbstmordes in verschiedenen literarischen Genres
- Die Rolle gesellschaftspolitischer Kontexte für die Entstehung der Krisen
- Analyse der literarischen Mittel zur Gestaltung der Thematik
- Untersuchung des Verhältnisses zwischen Biografie und literarischer Fiktion
Zusammenfassung der Kapitel
1 Sylvia Plath und gesellschaftspolitische Kontexte: Dieses einleitende Kapitel liefert einen notwendigen biographischen Überblick über Sylvia Plaths Leben und ordnet ihre Werke in den gesellschaftspolitischen Kontext der 1950er Jahre in Amerika ein. Es werden die Zwänge und Erwartungen an Frauen in dieser Zeit beleuchtet, die als wichtige Faktoren für Plaths Lebens- und Schreibkrise betrachtet werden. Der Fokus liegt auf der Rolle der Frau in Beruf und Ehe, und wie diese Konformitätserwartungen Plaths Existenzkrise beeinflusst haben könnten. Der Holocaust wird als ein Beispiel für die in ihren Gedichten evozierten Bilder des Bösen genannt, die als Ausdruck innerer Konflikte verstanden werden können.
2 Der Tod im Roman - Die Glasglocke: Dieses Kapitel analysiert Sylvia Plaths Roman „Die Glasglocke“ und konzentriert sich auf die Thematik des Identitätsverlustes und den Selbstmordversuch der Protagonistin Esther Greenwood. Es werden Esthers gescheiterte Suche nach einer neuen Identität und die Rolle der „Doubles“, ihrer weiblichen Rollenvorbilder, untersucht. Die Analyse beleuchtet, wie gesellschaftspolitische Strukturen auf Esthers Leben und ihre Lebenskrise einwirken. Der Roman wird nicht als reine Biografie interpretiert, sondern als fiktionale Auseinandersetzung mit den Themen Tod und Identität.
3 Der Tod als Chiffre – Die späte Lyrik: Dieses Kapitel befasst sich mit Sylvia Plaths später Lyrik, insbesondere dem Band „Ariel“, und analysiert den Tod als zentrales Motiv und Chiffre. Es wird der Begriff des „Confessional Poet“ erläutert und die Auflösung und Wiederbelebung des „Du“ in den Gedichten untersucht. Die Analyse konzentriert sich auf die verschiedenen Facetten des Todes in Plaths Lyrik und thematisiert Aspekte wie Wiedergeburt, Initiation, Reinheit und den „dualen Tod“. Der Fokus liegt auf der literarischen Gestaltung dieser Thematik und deren Bedeutung im Kontext ihres Werkes.
4 Der reale Tod als Ausgangspunkt – Die Tagebücher: Dieses Kapitel behandelt Sylvia Plaths Tagebücher, die den realen Tod als Ausgangspunkt nehmen. Es diskutiert die Herausforderungen der Authentizität und die Rolle von Ted Hughes als Herausgeber. Die Selbstmordthematik wird als roter Faden analysiert, wobei Aspekte wie das „Double“, Liebe und das Gefühl von „Druck“ (“The air of pressure“) in den Tagebüchern untersucht werden. Die Briefe nach Hause werden ebenfalls in die Analyse einbezogen und unter dem Aspekt der Deutung des gesamten Themenkomplexes beleuchtet.
Schlüsselwörter
Sylvia Plath, Identitätsverlust, Todessehnsucht, Selbstmord, „Die Glasglocke“, „Ariel“, Tagebücher, Confessional Poetry, Biografische Interpretation, Werkinterpretation, Gesellschaftspolitische Kontexte, Frauenrolle, Existenzkrise, Identitätssuche, Tod als Metapher.
Häufig gestellte Fragen zu: Sylvia Plath - Identitätsverlust und Todessehnsucht
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Thematik von Identitätsverlust und Todessehnsucht in den autobiografischen und fiktionalen Texten Sylvia Plaths. Sie untersucht die Darstellung des Todes und des Selbstmordes in ihrem Roman „Die Glasglocke“, ihrer Lyrik (insbesondere „Ariel“) und ihren Tagebüchern. Dabei wird eine werkimmanente Interpretation angestrebt, die die gängige Gleichsetzung von Biografie und Werk hinterfragt.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Motiven wie Identitätsverlust, der Darstellung von Tod und Selbstmord in verschiedenen literarischen Genres, der Rolle gesellschaftspolitischer Kontexte für die Entstehung von Krisen, der Analyse literarischer Mittel und dem Verhältnis zwischen Biografie und literarischer Fiktion. Konkret werden Aspekte wie die Frauenrolle in den 1950er Jahren, Esthers Identitätssuche in „Die Glasglocke“, die verschiedenen Facetten des Todes in Plaths Lyrik (Wiedergeburt, Initiation, Reinheit, dualer Tod) und die Authentizität ihrer Tagebücher untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel. Kapitel 1 bietet einen biographischen Überblick und ordnet Plaths Werk in den gesellschaftspolitischen Kontext ein. Kapitel 2 analysiert „Die Glasglocke“ mit Fokus auf Identitätsverlust und Selbstmordversuch. Kapitel 3 befasst sich mit der späten Lyrik, insbesondere „Ariel“, und dem Tod als Chiffre. Kapitel 4 behandelt die Tagebücher und die Herausforderungen der Authentizität. Kapitel 5 fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Rolle spielt der Kontext der 1950er Jahre?
Der gesellschaftliche und politische Kontext der 1950er Jahre in Amerika, insbesondere die Zwänge und Erwartungen an Frauen, wird als wichtiger Faktor für Plaths Lebens- und Schreibkrise betrachtet. Die Arbeit beleuchtet die Rolle der Frau in Beruf und Ehe und wie Konformitätserwartungen Plaths Existenzkrise beeinflusst haben könnten. Der Holocaust wird als Beispiel für die in ihren Gedichten evozierten Bilder des Bösen genannt, die als Ausdruck innerer Konflikte verstanden werden können.
Wie wird der Roman „Die Glasglocke“ interpretiert?
„Die Glasglocke“ wird nicht als reine Biografie interpretiert, sondern als fiktionale Auseinandersetzung mit Tod und Identität. Die Analyse konzentriert sich auf Esthers gescheiterte Identitätssuche und die Rolle ihrer weiblichen Rollenvorbilder („Doubles“). Der Einfluss gesellschaftspolitischer Strukturen auf Esthers Leben und ihre Lebenskrise wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Bedeutung hat die Lyrik, insbesondere „Ariel“?
In „Ariel“ wird der Tod als zentrales Motiv und Chiffre analysiert. Es wird der Begriff des „Confessional Poet“ erläutert und die Auflösung und Wiederbelebung des „Du“ in den Gedichten untersucht. Die Analyse fokussiert auf verschiedene Facetten des Todes: Wiedergeburt, Initiation, Reinheit und den „dualen Tod“. Die literarische Gestaltung dieser Thematik und deren Bedeutung im Kontext ihres Werkes stehen im Mittelpunkt.
Welche Rolle spielen die Tagebücher?
Die Tagebücher werden als Ausgangspunkt für die Analyse des realen Todes betrachtet. Die Arbeit diskutiert die Herausforderungen der Authentizität und die Rolle von Ted Hughes als Herausgeber. Die Selbstmordthematik wird als roter Faden analysiert, mit Fokus auf Aspekte wie das „Double“, Liebe und das Gefühl von „Druck“ („The air of pressure“). Die Briefe nach Hause werden ebenfalls in die Analyse einbezogen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sylvia Plath, Identitätsverlust, Todessehnsucht, Selbstmord, „Die Glasglocke“, „Ariel“, Tagebücher, Confessional Poetry, biografische Interpretation, Werkinterpretation, gesellschaftspolitische Kontexte, Frauenrolle, Existenzkrise, Identitätssuche, Tod als Metapher.
Details
- Titel
- Sylvia Plath - Identitätsverlust und Todessehnsucht
- Untertitel
- Die Selbstmord- und Todesthematik in autobiografischen und fiktionalen Texten von Sylvia Plath
- Hochschule
- Humboldt-Universität zu Berlin
- Autor
- N. Mackowiak (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2012
- Seiten
- 70
- Katalognummer
- V203073
- ISBN (eBook)
- 9783656307679
- ISBN (Buch)
- 9783656308249
- Dateigröße
- 787 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Tod
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 31,99
- Preis (Book)
- US$ 41,99
- Arbeit zitieren
- N. Mackowiak (Autor:in), 2012, Sylvia Plath - Identitätsverlust und Todessehnsucht, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/203073
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-