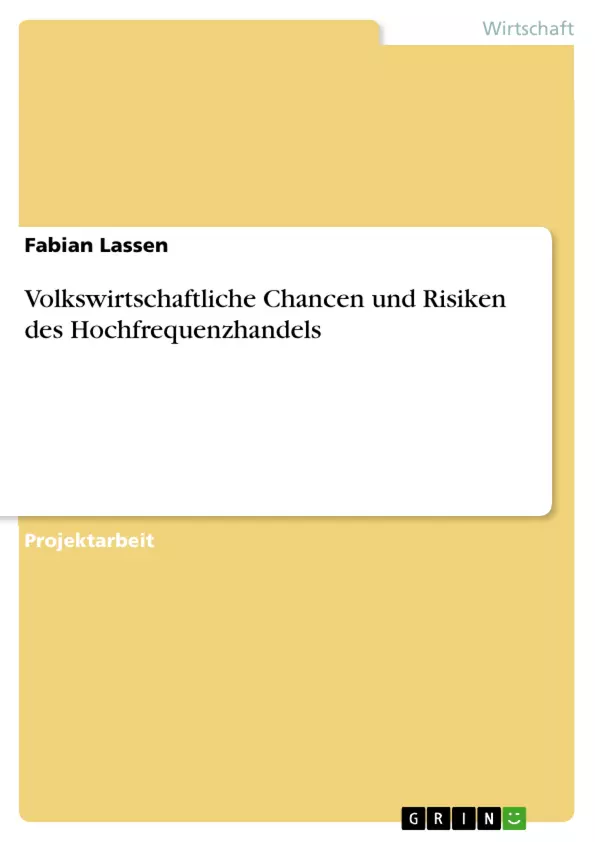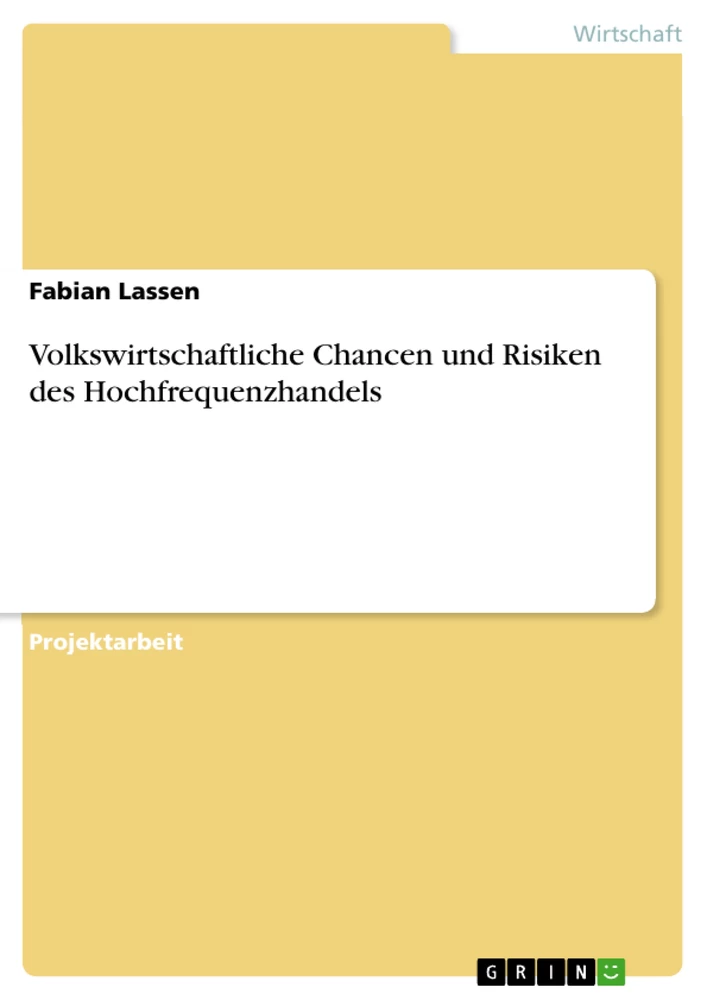
Volkswirtschaftliche Chancen und Risiken des Hochfrequenzhandels
Projektarbeit, 2012
34 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhalt
Abstract
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Wertpapierhandel
2.1 Die Börse als Handelsplatz von Wertpapieren
2.2 Volkswirtschaftliche Bedeutung des Wertpapierhandels
2.3 Entwicklung und Automatisierung des Wertpapierhandels
3 Der Hochfrequenzhandel
3.1 Definition des Hochfrequenzhandels
3.2 Entwicklung des Hochfrequenzhandels
3.3 Erläuterung der Funktionsweise des Hochfrequenzhandels
3.4 Chancen des Hochfrequenzhandels
3.5 Risiken des Hochfrequenzhandels
4 Fazit
Literaturverzeichnis
Anhang
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le trading à haute fréquence (THF) ?
C'est un processus boursier où des titres sont échangés à une vitesse extrême de manière entièrement automatisée par des ordinateurs.
Quels sont les avantages économiques du THF ?
Il améliore la liquidité du marché, augmente le volume des transactions et peut aider à réduire la volatilité des titres et des devises.
Quels sont les risques associés à cette pratique ?
Les critiques soulignent le manque de transparence des banques d'investissement et le risque d'instabilité systémique en cas de mouvements de marché imprévus.
Pourquoi le THF est-il au centre des débats politiques ?
En raison de sa croissance rapide depuis 2005 et de son opacité, les régulateurs envisagent des mesures qui pourraient limiter son impact.
Quel est le rôle de la bourse dans ce contexte ?
La bourse sert de place de marché où l'automatisation permet une formation des prix plus rapide et plus efficace à l'échelle mondiale.
Le trading à haute fréquence va-t-il continuer de croître ?
Malgré les projets de régulation, les experts s'attendent à une croissance continue de cette technologie à long terme.
Details
- Titel
- Volkswirtschaftliche Chancen und Risiken des Hochfrequenzhandels
- Hochschule
- Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim, früher: Berufsakademie Mannheim
- Note
- 1,7
- Autor
- Fabian Lassen (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2012
- Seiten
- 34
- Katalognummer
- V203188
- ISBN (eBook)
- 9783656297505
- ISBN (Buch)
- 9783656298007
- Dateigröße
- 790 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Hochfrequenzhandel Chancen Risiken Highfrequency Trading Börse Aktien Aktienhandel Crash flash crash
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 18,99
- Preis (Book)
- US$ 20,99
- Arbeit zitieren
- Fabian Lassen (Autor:in), 2012, Volkswirtschaftliche Chancen und Risiken des Hochfrequenzhandels, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/203188
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-