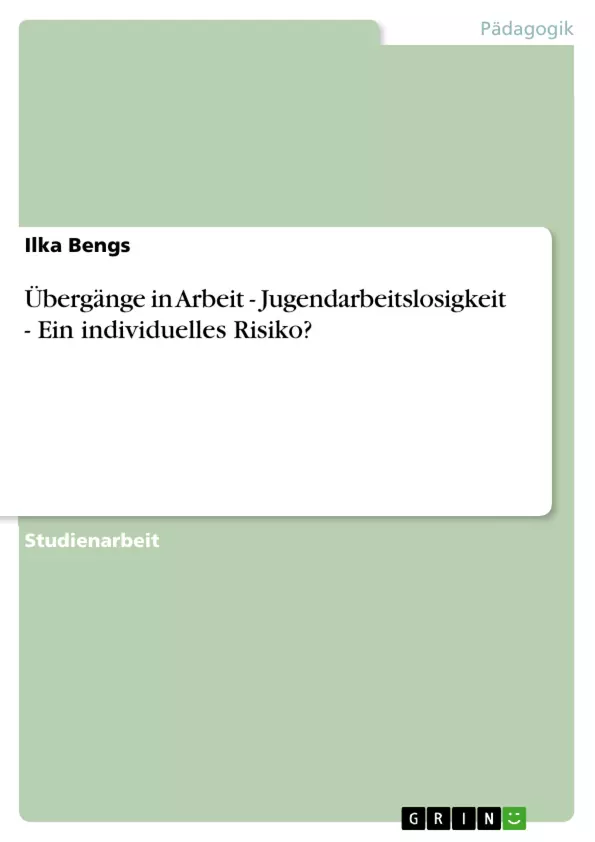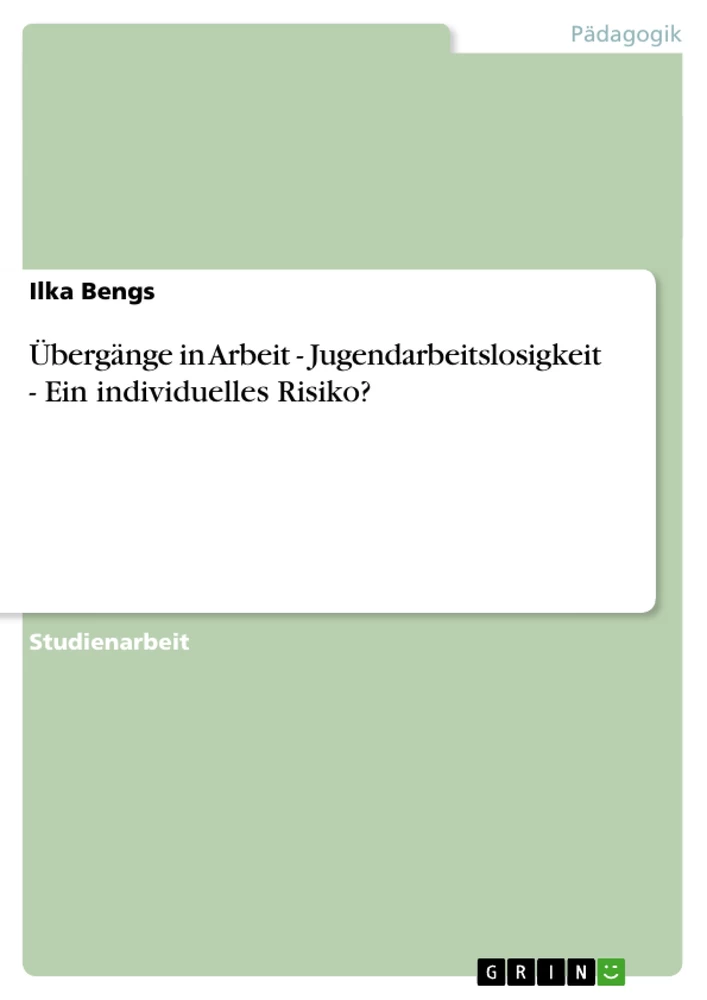
Übergänge in Arbeit - Jugendarbeitslosigkeit - Ein individuelles Risiko?
Hausarbeit, 2010
13 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Arbeit
2.1 Definition von Arbeit als Erwerbsarbeit
2.2 Funktionen und Darstellung von Arbeit
3 Probleme im Zugang zu Arbeit
3.1 Der Wandel der Arbeitsgesellschaft
3.2 Der gewandelte Ausbildungsmarkt
3.3 Die gewandelte Jugend (?)
4 Interventionsformen
4.1 Jugendarbeitslosigkeit - ein individuelles Risiko?
4.2 Was kann Jugendhilfe leisten? – Ein Ausblick
5 Fazit
6 Literaturverzeichnis
Einleitung
Die Arbeitslosigkeit der Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist nicht nur ein Problem, vielmehr schafft es noch mehr Probleme, wie z.B. aus haushaltspolitischer, sozialer, wirtschaftlicher Ebene.
Die vorliegende Ausarbeitung beschäftigt sich mit dem Text von Lutz „Jugendarbeitslosigkeit“ und soll zunächst drei Fragen beantworten:
Welches Verständnis von Arbeit liegt dem Text zu Grunde und welche Funktionen werden ihr zugeschrieben?
Welche Probleme im Zugang zu Arbeit werden formuliert?
Welche Interventionsformen werden beschrieben?
Darüber hinaus soll die Frage beantwortet werden, was diese Betrachtung für das Handlungsfeld der Jugendberufshilfe bedeutet.
2. Arbeit
2.1 Definition von Arbeit als Erwerbsarbeit
Wenn ich im Folgenden von Arbeit spreche, meine ich die Erwerbsarbeit, die ein zeitlich, rechtlich und tariflich standardisierte abhängiges unbefristetes Vollzeit-Arbeitsverhältnis darstellt, das dem Arbeitnehmer als einzige Einkommens- und Versorgungsquelle dient (Christe 2002, S. 121).
2.2 Funktionen und Darstellung von Arbeit
Arbeit sei ein, für das Individuum, Tage, Wochen und Jahre einteilende; soziale Beziehungen schaffende, sowie finanziell entlohnende Struktur, die das Individuum in ein Kollektiv integriere und ihm dort einen veränderbaren sozialen Status zuordne (vgl. Lutz 2003, S. 423). Sie wird als Erwerbsarbeit im Normalarbeitsverhältnis durch eine „Normalbiographie“ strukturiert und strukturiert somit gleichsam das Leben. Denn auch wenn die Erwerbstätigkeit nur ca. 50 Jahre beträgt, was ca. die Hälfte der erwartbaren Lebenszeit entspricht, so beginnt die Berufsvorbereitung schließlich schon im Kindergarten und so bedingt die vorherige Erwerbstätigkeit auch den Status im Rentenalter. Darüber hinaus gibt es dem Individuum Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung, was ein Grundbedürfnis des Menschen ist.
Doch für Lutz ist Arbeit „nicht nur für den Einzelnen hinsichtlich seines weiteren beruflichen und sozialen Werdegangs wesentlich, es müssen auch komplexe gesellschaftliche und soziale Kontexte berücksichtigt werden.“ (ebd., S. 413). Ohne sie fiele es uns schwer unseren Platz und unsere Funktion in der Gesellschaft zu finden und einzunehmen. Könne man sich nicht selbst an diesem Platz setzen, wird man zu den „Überflüssigen“ gezählt, zu denen, die sich nicht an der Gesamtproduktion beteiligen (vgl. ebd., S. 414). So würde eine Klassenlinie gezogen zwischen denen, die Arbeit haben und denen, die keine haben (vgl. ebd., S. 413).
Der Mangel an Arbeit bringt noch mehr Funktionen von Arbeit zu Tage, so sagt Lutz auch, dass man um Arbeit zu bekommen Anstrengungen in Kauf nimmt, wie zum Beispiel in andere Bundesländer zu Pendeln oder Abzuwandern. Doch er beschreibt aber auch das andere Extrem: ein geringer Teil der Jugendlichen würde auf Grund von negativen Erfahrungen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz förmlich den „Kopf in den Sand“ stecken (vgl. ebd., S. 422).
Die Arbeit kann man aus verschiedenen Blickwinkeln darstellen und ihr daher auch verschiedene Funktionen zuschreiben. Im Text von Lutz wird eine traditionelle Auffassung der Arbeitsgesellschaft dargestellt, die außerdem eine Mittelschichtsorientierung vermuten lässt. In seiner Darstellung ist das Selbstbild von dem Platz in der Gesellschaft, also von seiner Arbeit bedingt und ohne Arbeit fehlt die Struktur des Lebens und auch die Möglichkeit zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Sie ist eine Schlüsselkategorie der Gesellschaft, bei der Arbeitslosigkeit nicht zur Normalität gehört.
Diese Einstellung läuft allerdings nicht mit denen aller Jugendlichen konform. Sie stimmt bei Jugendlichen, die sich an der Mittel- oder Oberschicht orientieren, doch gerade in der Jugendberufshilfe geht es nicht hauptsächlich um diese Jugendlichen, sondern um den großen Teil der Jugendlichen, die aus der Unterschicht stammen. Ihre Eltern sind/waren eventuell selbst (Langzeit-)Arbeitslos, leben prekären Lebensverhältnissen und weisen vielleicht noch andere Benachteiligungen auf. Für sie ist ein Leben ohne Arbeit denkbar und auch machbar, solange der Lebensunterhalt irgendwie bestritten werden kann (vgl. Krafeld, S. 126).
3. Probleme im Zugang zu Arbeit
Die Probleme im Zugang zu Arbeit hängen eng mit dem Wandel der Arbeitsgesellschaft, aber auch mit den Entwicklungen, die sich daraus für die Jugendlichen ergeben, zusammen.
3.1 Der Wandel der Arbeitsgesellschaft
Die traditionelle Arbeitsgesellschaft hat sich grundlegend gewandelt, wobei die tradierten, festgefügten Strukturen wie die „Normalbiografie“ und „Lebenslaufleitbilder“ durch die Pluralisierung der Formen von Nicht-Normalarbeitsverhältnissen aufbrechen. Trotz dem Zwang der Individualisierung, der von der enttradierten Gesellschaft ausgeht, unterstützen individuelle Lebenswege die Aufweichung der normalbiografischen Lebensläufe und unterstützen die Pluralisierung sozialer Strukturen wie der Familie (vgl. Lutz 2003, S. 415), was zu weiterer Erodierung der traditionellen Arbeitsgesellschaft führt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes?
Der Text behandelt die Arbeitslosigkeit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen und deren Auswirkungen auf verschiedenen Ebenen (haushaltspolitisch, sozial, wirtschaftlich). Er analysiert die Ursachen, Probleme und möglichen Lösungsansätze.
Welches Verständnis von Arbeit wird im Text zugrunde gelegt?
Der Text definiert Arbeit primär als Erwerbsarbeit, d.h. eine zeitlich, rechtlich und tariflich standardisierte, abhängige, unbefristete Vollzeit-Arbeitsstelle, die als einzige Einkommens- und Versorgungsquelle dient. Dies entspricht dem Normalarbeitsverhältnis.
Welche Funktionen werden der Arbeit im Text zugeschrieben?
Arbeit strukturiert den Alltag, schafft soziale Beziehungen, ermöglicht finanzielle Entlohnung und integriert das Individuum in ein Kollektiv, wodurch ihm ein sozialer Status zugeordnet wird. Sie bietet Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung und ist ein Grundbedürfnis des Menschen.
Welche Probleme im Zugang zu Arbeit werden im Text formuliert?
Der Text thematisiert den Wandel der Arbeitsgesellschaft, den gewandelten Ausbildungsmarkt und die veränderte Situation der Jugendlichen. Die traditionellen Strukturen brechen auf, und es kommt zu einer Pluralisierung von Arbeitsverhältnissen und Lebensläufen. Die Individualisierung führt zu einer "Entkollektivierung sozialer Risiken", wodurch Arbeitslosigkeit zu einem individuellen Problem wird.
Welche Interventionsformen werden im Text beschrieben?
Der Text fragt, ob Jugendarbeitslosigkeit ein individuelles Risiko ist und welche Leistungen die Jugendhilfe erbringen kann. Es wird angedeutet, dass die Bewältigung von Arbeitslosigkeit oft einem "Knappheitsmanagement" ähnelt.
Was bedeutet der Wandel der Arbeitsgesellschaft?
Der Wandel der Arbeitsgesellschaft bezieht sich auf den Aufbruch traditioneller, festgefügter Strukturen wie der "Normalbiografie" durch die Zunahme von Nicht-Normalarbeitsverhältnissen und die Individualisierung.
Was bedeutet "Entkollektivierung sozialer Risiken"?
Entkollektivierung sozialer Risiken bedeutet, dass Arbeitslosigkeit nicht mehr als homogenes Problem betrachtet wird, sondern als individuelle Herausforderung. Die Probleme der Menschen werden komplexer und individueller, wodurch sie mit ihren Schwierigkeiten alleine dastehen.
Welche Rolle spielen Netzwerke im Kontext von Arbeitslosigkeit?
Netzwerke sind wichtig, um der Entkollektivierung entgegenzuwirken und soziale Unterstützung zu finden. Sie helfen, die individuellen Probleme im Kontext der Arbeitslosigkeit zu bewältigen.
Details
- Titel
- Übergänge in Arbeit - Jugendarbeitslosigkeit - Ein individuelles Risiko?
- Hochschule
- Universität Münster (Institut für Erziehungswissenschaften)
- Veranstaltung
- Übergänge in Arbeit - Was kann Jugendhilfe leisten?
- Note
- 1,3
- Autor
- B.A. Ilka Bengs (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2010
- Seiten
- 13
- Katalognummer
- V203513
- ISBN (eBook)
- 9783656301974
- ISBN (Buch)
- 9783656302902
- Dateigröße
- 438 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- übergänge arbeit jugendarbeitslosigkeit risiko
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 0,99
- Preis (Book)
- US$ 16,99
- Arbeit zitieren
- B.A. Ilka Bengs (Autor:in), 2010, Übergänge in Arbeit - Jugendarbeitslosigkeit - Ein individuelles Risiko?, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/203513
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-