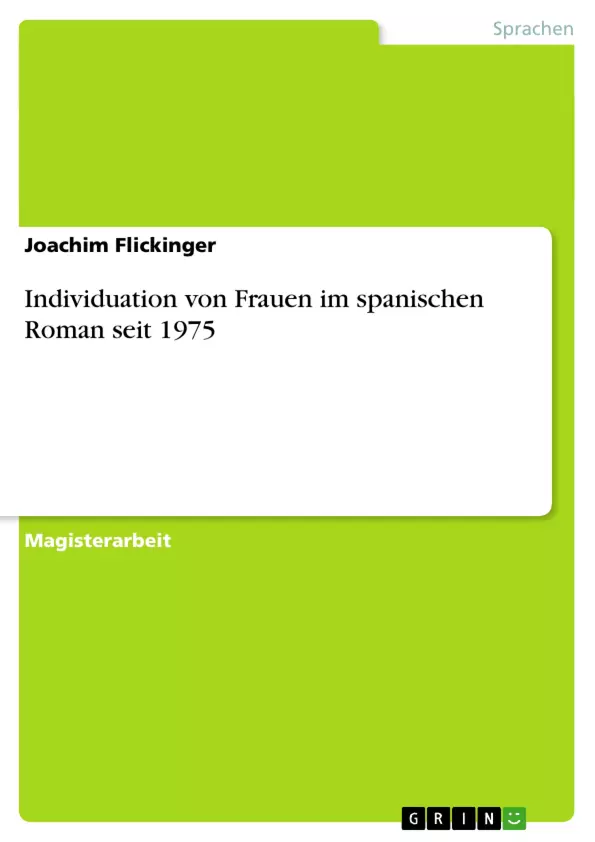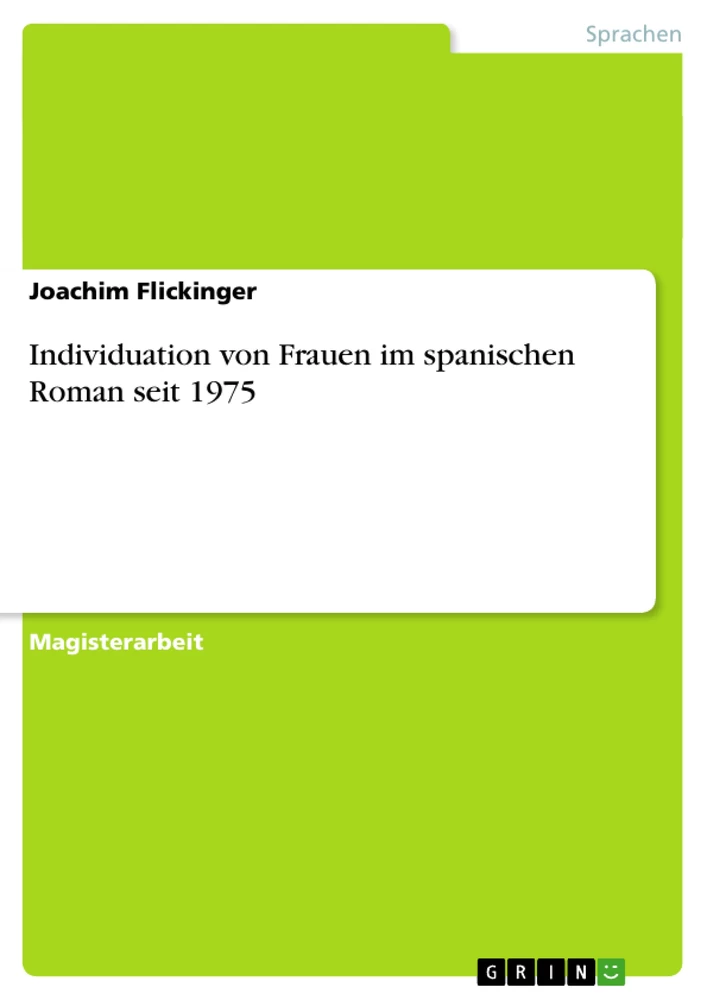
Individuation von Frauen im spanischen Roman seit 1975
Magisterarbeit, 2005
91 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhalt
1. Einleitung
1.1 Klärung des Themas
1.2 Aufbau der Arbeit
2. Der Prozess der Individuation
2.1 Carl Gustav Jungs Individuationstheorie
2.2 Das Selbst und die Anderen
3. Die Auswahl der Werke
3.1 Vitae
3.2. Überblick über den Inhalt der ausgewählten Werke
4. Die Individuation von Frauen am Beispiel der ausgewählten Werke
4.1 Die katholische Kirche
4.2 Die Eltern
4.3 Männer: Vertraute - Geliebte - Partner
5. Abschließende Betrachtungen
5.1 Grundkonflikte
5.2 Weitere für die Individuation der Protagonistinnen bedeutende Figuren
6. Bibliographie
6.1 Primärliteratur
6.2 Sekundärliteratur
6.3 Internetartikel
1 Einleitung
1.1 Klärung des Themas
Das Thema dieser Arbeit lässt zunächst einige Fragen aufkommen. Warum heißt es beispielsweise die Individuation von Frauen und nicht der Frau ? Warum im spanischen Roman seit 1975? Und: Was hat es mit dem Begriff der Individuation auf sich? Die Beantwortung dieser Fragen schätze ich insofern als wichtig ein, als dass die einzelnen Bestandteile des Titels den Rahmen der Arbeit abstecken. Eine präzise Eingrenzung des Themas trägt wiederum zum besseren Verständnis sowie einer Definition der Ansprüche dieser Arbeit bei.
Die erste Frage lässt sich in meinen Augen wie folgt beantworten: Die Frau gibt es nicht. Jede Frau - und somit jede weibliche Romanfigur als Projektion real vorkommender Charaktere - ist ein Wesen mit individuellen Zügen, die sie von anderen unterscheiden. Das Konzept der Frau wird nicht nur durchbrochen durch eine Loslösung von traditionellen Rollenbildern, sondern auch durch die Tatsache, dass Frauen von heute - welchen Grad von Emanzipation sie auch erlangt haben mögen - keine homogene Gruppe bilden, sondern die erlangte Selbstständigkeit auf verschiedenste Weisen leben oder eben nicht. Durch gesellschaftlichen Wandel und den daraus folgenden Möglichkeiten, Problemen und auch durch den aufkommenden Druck, wird die Frau als (Stereo)Typ und Rolleninhaberin weitgehend abgelöst durch Frauen als Individuen.
Um Missverständnissen vorzubeugen, möchte ich zunächst klarstellen, dass es mir in dieser Arbeit nicht darum geht, eine spezifisch weibliche Literatur nachzuweisen, denn egal, ob es sich um eine feministische oder eine Auslegung handelt, die sich an den biologischen Unterschieden der Geschlechter und deren Einflüssen auf das Wesen eines Menschen orientieren, wie sie meist von männlichen Kritikern herangezogen werden, wird das Ergebnis eine eindeutige Wertung sein. Feministische Herangehensweisen können die Literatur von Frauen einseitig als Aufruf zur Befreiung werten und dabei andere literaturkritische Dimensionen vernachlässigen, während jene erwähnten männlichen Kritiker sich in ebenso unwissenschaftlicher Weise auf biologische Unterschiede beziehen, nur um die Literatur von Frauen abzuwerten oder ihre Besonderheiten auf „typisch weibliche“ Komponenten zurückzuführen. Ein Beispiel für den letztgenannten Diskurs beschreiben José Luis Campal Fernández und Andrea Rössler:
„Con tal denominación [(sensibilidad femenina)], y aun conviniendo que la biología impone diferencias ente el hombe y la mujer, se han cometido bastantes y tendenciosas manipulaciones [...].”1
„Tatsächlich kann die Analyse von Texten aus weiblicher Feder nicht das Ziel haben, in ihnen Elemente einer weiblichen Ästhetik im Sinne eines biologischen Differenzmodells hervorzuheben, das Spuren des weiblichen Körpers in den Texten von Frauen - sei es in Metaphern, sei es in
Erzählstrukturen - zu finden bemüht ist. Die Frage nach einer weiblichen Ästhetik führt dann ins Leere, wenn sie stilistische oder thematische Konstanten auszumachen versucht, die auf die biologische Geschlechtszugehörigkeit der einzelnen Autorinnen zurückgeführt werden.“2
Campal Fernández verweist sogar auf eine mögliche Gettoisierung der Literatur von Frauen, wenn man darauf besteht, dass es hier unbedingt Unterschiede zur Literatur von Männern gebe:
„Aludir a una «novela femenina» en el sentido de novela autónoma supondría casi que debería haber una «novela masculina» y que cada una de ellas dispondría de rasgos definidos y particulares. Insistir por esta vía podría conducirnos, como ha señalado la novelista Almudena Grandes, a una absurda división entre «literatura» y «literatura femenina».”3
Um solch einen Diskurs der „biologischen Sackgasse“4 zu umgehen, wird in dieser Arbeit die Aufmerksamkeit in erster Linie auf die weiblichen Figuren und ihre psychosozialen Merkmale gerichtet und nicht auf angeblich biologisch konstatierte Merkmale der Autorinnen.
Das Jahr 1975 war für Spanien ein in jeglicher Hinsicht bedeutendes Jahr: Fancos Tod war nicht nur für die politische, soziale und wirtschaftliche Entwicklung bedeutend, sondern es war auch der Ausgangspunkt für tief greifende kulturelle Veränderungen. Für diese Arbeit ist das Datum insofern von Bedeutung, als dass die transición für die spanischen Frauen eine Fülle neuer Möglichkeiten und Rechte bedeutete, sie aber gleichzeitig vor das Problem stellte, ihre traditionell geprägten Rollen zu verwinden und schließlich mit der neu erlangten Freiheit zurecht zu kommen5. Eine der wichtigsten Veränderungen ist zu dieser Zeit sicherlich der Eintritt der Frau in die Arbeitswelt. Diese Möglichkeit nutzten auch die Autorinnen, deren Werke hier besprochen werden sollen, die über einen Beruf - etwa als Akademikerinnen oder Journalistinnen - zum Schreiben kamen. In der Zeit nach 1975 beginnen spanische Autorinnen, an feministische Literaturen anderer Nationen anzuknüpfen, diese auszubauen oder neue Wege einzuschlagen. Diese explizit feministische Bewegung in der Literatur löst sich allerdings gegen Ende der 1980er Jahre als organisierte Strömung auf und es bleiben nur noch einzelne Gruppen von Autorinnen, deren Literatur als feministisch im Sinne der Anfangsphase der spanischen Gegenwartsliteratur von Frauen zu sehen ist6.
In dieser Arbeit kann kein umfassender Überblick über die Literatur von Frauen in Spanien seit 1975 geliefert werden. Ich beschränke deshalb mich auf die folgenden vier Werke: Adelaida García Morales: La lógica del vampiro (1990)
Almudena Grandes: Malena es un nombre de tango (1994) Josefina Molina: Cuestión de azar (1997)
Rosa Montero El corazón del Tártaro (2001)
Alle diese Werke stammen also aus einer Zeit, in der es ein explizit feministisches Literatur- schaffen in Spanien nicht mehr als bestimmende Strömung gab. Aufgrund dieser Annahme und der postfeministischen Herangehensweise erübrigt sich die Frage, ob eine, mehrere oder gar alle oben genannten Autorinnen Feministinnen sind und wenn ja, ob ihre Literatur dadurch geprägt wurde. Als Schwerpunkt wird die Entwicklung von Frauen zu Individuen gelegt.
Damit bin ich beim thematischen Kern dieser Arbeit angelangt - der Individuation. Eine genauere begriffliche Bestimmung wird noch folgen. Nur so viel vorweg: Über den Prozess der Individuation (also den Prozess der „Selbstwerdung“) wird klar, wie heterogen die Prägungen und Erfahrungen von Frauen sind und waren und dass deshalb keine leichtfertigen Aussagen über den Lebensweg der Frau getroffen werden können. Die Autorinnen selbst befinden sich im andauernden Prozess der Individuation und genau das übertragen sie auf ihre Figuren. Aus dieser Überlegung wird auch deutlich, warum es nicht angebracht ist den Begriff der „Generation“ auf die Autorinnen Spaniens nach 1975 anzuwenden: „[...] er trägt maßgeblich dazu bei, individuelle Stile und Themen zugunsten vermeintlicher Gemeinsamkeiten einer Gruppe von Autoren und einer vorschnellen Pauschalisierung zu vernachlässigen“7.
1.2 Aufbau der Arbeit
In Kapitel 2 werde ich das Thema der Individuation als theoretische Analysebasis dieser Arbeit erläutern. Dabei gehe ich auf die Thesen C.G. Jungs ein und erläutere die für die Individuation bedeutsamen „Instanzen“ Institution, Gruppe und Individuum. Außerdem zeige ich anhand von Ansätzen einiger zeitgenössischer Psychologen und Soziologen zeitgemäße Arten des Umgangs mit Jungs Thesen auf.
Überlegungen zur Auswahl der Werke werde ich in Kapitel 3 dieser Arbeit ausführen. Außerdem werde ich einen groben Überblick über die vitae der Autorinnen geben und schließlich die Inhalte der vier zur Analyse stehenden Texte umreißen, um den Einstieg in die Untersuchung zu erleichtern.
In Kapitel 4 folgt die Analyse der Werke hinsichtlich der Individuation der Protagonis- tinnen. Dazu werde ich exemplarisch auf o.g. „Individuations-Instanzen“ eingehen, die sich als für den Individuationsprozess bedeutende Kategorien erweisen. Hierbei ist zu beachten, dass nicht alle Kategorien in jedem Werk zu finden sind, weswegen nicht jedes Werk bei jeder Kategorie beachtet wird. An das Ende jedes thematischen Abschnitts werde ich ein Fazit stellen, in dem die in der jeweiligen Kategorie behandelten Werke in ihren Grundzügen gegenübergestellt werden.
Um weitere Einflüsse im Prozess der Individuation aufzuzeigen, die aus Gründen des Umfangs nicht in den Analyseteil aufgenommen werden können bzw. die nicht in den Rahmen der Kategorien des Analyseteils passen, werde ich in Kapitel 5 bei der Nachzeichnung der Individuation der Protagonistinnen an wichtigen Eckpunkten ihrer Entwicklungen in den jeweiligen Romanen diese weiteren Einflüsse in reduziertem Umfang einbauen. Aus diesem letzten Kapitel der Arbeit werden außerdem die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Romane, was die Frauen und ihre Entwicklung angeht, hervorgehen.
2. Der Prozess der Individuation
Der Terminus „Individuation“ fällt in das Arbeitsgebiet der Sozialwissenschaften. Insofern bietet sich ein Blick in psychologische und soziologische Handbücher an, um ein erstes Bild von seiner Bedeutung zu bekommen.
In Gerd Reinholds Soziologie-Lexikon finden wir die Individuation als Gegenteil von Sozialisation, in der die „[...] Gesellschaftsmitglieder an die gesellschaftliche Ordnung angepasst werden sollen“. Individuation heißt hier also der Prozess, „in dem ein Individuum autonom, eigenverantwortlich, persönlich gefärbt und bewußt handelt, evtl. auch gegen die soziale Norm. I.[ndividuation] meint also die reflektierte Distanz von gesellschaftlichem Druck und intendierte Individualität“1. Die Möglichkeit, im Prozess der Individuation auch gegen die soziale Norm zu handeln sowie die Bemerkung der „reflektierten Distanz“ können zu dem Irrtum führen, es handle sich bei der Individuation um einen Prozess der Isolierung und Abschottung. Karl-Heinz Hillmann stellt hingegen fest, dass es sich eben gerade darum nicht handelt, sondern dass Individuation eine „[...] betont eigenverantwortliche, kreative und selbstproduktive Stellung des Individuums gegenüber den ges.[ellschaftlichen] Gruppen u. deren Werten u. Normen“2 darstellt.
Der Irrtum, Individuation sei durch die Isolierung des Einzelnen gekennzeichnet, rührt von einer Missinterpretation der entsprechenden Stellen im Werk C. G. Jungs her, auf den wir bei einer Suche nach dem Begriff Individuation im psychologischen Wörterbuch stoßen. Hier erfahren wir, dass C.G. Jung (1875-1961) das Thema der Individuation in einer Reihe von Philosophen wie Aristoteles, Albertus Magnus, Leipniz u.a. aufnimmt und fortführt. Das folgende Teilkapitel widmet sich C.G. Jungs Individuationstheorie.
2.1 Carl Gustav Jungs Individuationstheorie
C.G. Jung, der lange Zeit mit Sigmund Freund (1856-1939) zusammen arbeitete, bettete die Individuationstheorie in seine Psychoanalyse als den Teil ein, der sich mit der Reifung des Selbst befasst. Jungs eigene Definition von Individuation lautet dabei: „Individuation bedeutet: zum Einzelwesen werden, und, gleichbare Einzigartigkeit verstehen, zum eigenen Selbst werden. Man könnte «Individuation» darum auch als «Verselbstung» oder als «Selbstverwirklichung» übersetzen“3. Hinter dieser scheinbar einfachen Definition stecken etliche unterschiedliche Komponenten und Bedingungen, die den Prozess der Individuation beschreiben. So stellt Jung z.B. gleich zu Beginn seiner Überlegungen fest, dass sich die Selbstverwirklichung unterscheidet von dem, was er „Selbstentäußerung“ nennt - nämlich der selbst verantworteten Isolierung des Individuums4.
Überhaupt spielt das Innen und Außen bei Jung eine große Rolle: Er geht davon aus, das Selbst sei im Individuationsprozess bestimmt durch Extra- und Introversion, wobei erstere die Identifikation mit der Außenwelt, die Anpassung an das kollektive „Man“, das Streben nach Prestige etc. meint, während letztere die Reflektion und Vermeidung von Außenweltkontakten bezeichnet5. Die Introversion sei ein unabstreitbarer Bestandteil der Individuation, die nach Jung in der Lebensmitte (zwischen dem 35. und 40. Lebensjahr) einsetzt. Dabei spielt das Selbst eine große Rolle, das Jung als „eine Art Kompensation für den Konflikt zwischen Innen und Außen“6 bezeichnet und das vom Ich zu unterscheiden sei: „Das Ich ist der einzige Inhalt des Selbst, den wir kennen“7. Die weiteren Bestandteile des Selbst sind8:
Persona: Außendarstellung, Fassade. Durch Beruf, Amt, Titel und soziale Rolle gekennzeichnet.
Schatten: Ereignisse, Vorstellungen, Wünsche, Impulse und Phantasien, „die vom Individuum aufgrund seiner Moralvorstellungen sowie aufgrund von kollektiv wirksamer Tabuisierung verleugnet und verdrängt werden.“
Animus und Anima: „[...] Vorurteile und Meinungen, die jeder über das eigene und das andere Geschlecht verinnerlicht hat und auf den anderen projiziert.“ Archetypen: „[...] ererbte Urbilder der Seele, menschheitsgeschichtliche Symbole, [...] stammesgeschichtlich angenommene, instinktive Verhaltensweisen“. Die Archetypen haben ihren Ursprung im kollektiven Unbewussten. Kollektives Unbewusstes: Stammesgeschichtliche Erfahrungen unserer Ahnen und die Wesenszüge des Menschen als „Art“, die „vererbt“ werden.
Persönliches Unbewusstes: Beinhaltet die Affekte und Kritik, die wir uns selbst verbieten. Im Individuationsprozess soll dieses Selbst nun sozusagen „aufgeräumt“ werden. Man soll durch Introversion die Eigenheiten des Selbst sozusagen über eine Abgleichung mit dem Außen kennen lernen und akzeptieren, nur dann wird man „man selbst“ und erreicht so das Ziel der Individuation.
Kritisch betrachtet weist Jungs Herangehensweise allerdings Defekte auf. Beispielsweise orientiert er seine Thesen zunächst an seiner eigenen Person, was an deren Relevanz zweifeln lässt und es bleibt zu fragen, warum die Individuation eines Menschen erst mit ca. 40 Jahren einsetzen sollte. Nachfolgend soll über Überlegungen anderer Autoren nachgezeichnet werden, dass eine kritische Auseinandersetzung und vor allem Ausdifferenzierung der Ansätze Jungs auch außerhalb der Psychoanalyse durchaus zu brauchbaren Ergebnissen führen und für eine literarische Analyse wertvoll sein kann.
Will man die Individuation eines Menschen - im Falle dieser Arbeit die Individuation von Frauen - in einem literarischen Werk nachzeichnen und analysieren, sollte man sich im Klaren darüber sein, welche Geschehnisse und Gegebenheiten die Individuation inwiefern beeinflussen. Hier bereits kommt Jungs Ansatz ins Spiel: je besser man also die Komponenten des Selbst einer Person kennt, desto klarer wird der Einblick in den Individuationsprozess dieser Person sein. In den hier untersuchten Werken ist die Individuation der weiblichen Figuren, deren Beeinflussung und Bedeutung besonders klar nachgezeichnet, da es sich um Literatur unter dem Einfluss gesellschaftlicher Umbrüche handelt, während derer die Konflikte Innen/Außen, Selbst/Anderer etc. besonders stark zu Tage treten.
2.2 Das Selbst und die Anderen
Hillmann gibt in seiner Definition von Individuation einen entscheidenden Hinweis auf einen wichtigen Faktor der Individuation: die Beziehungen des Einzelnen zu verschiedenen sozialen Gruppen. Die große Bedeutung von anderen Menschen für das Individuum erschließt sich als faktisch, wenn man bedenkt, dass niemand ohne Beziehungen zu anderen Menschen leben kann. Martin Buber hat es so formuliert: „Der Mensch wird am Du zum Ich. Gegenüber kommt und entschwindet, Beziehungsereignisse verdichten sich und zerstieben [...]“9. Individuen sind physisch und psychisch von anderen abhängig und das nicht erst seit heute. Der Einfluss von Gruppen, einzelnen Individuen oder Institutionen, von denen wir abhängig sind, hat sich jedoch über die Zeit hinweg verändert und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass etwa die sozialen Institutionen einen größeren Einfluss auf das Individuum hätten als einzelne Personen, nur weil die Institutionen eine im Vergleich zur einzelnen Person allgemeine gesellschaftliche Macht besitzen. Es ist gerade aufgrund der emotionalen Nähe einzelner Personen zueinander wahrscheinlicher, dass unter diesen prägende Beeinflussungen stattfinden und „ohne bewusst anerkannte und akzeptierte Bezogenheit auf den Neben- menschen gibt es überhaupt keine Synthese der Persönlichkeit“10.
Ein Beispiel einer sozialen Institution, die Einfluss auf die Mitglieder aller Schichten ausübt, ist die Kirche. Robert Strubel11 weist darauf hin, das es im Falle Europas der christliche, zunächst katholische Glaube ist, der dem mittelalterlichen Menschen sein Seelenheil durch die Zugehörigkeit zur religiösen Gemeinschaft gewährleistet: Die Formel „Extra ecclesiam nulla salus“12 spiegelt den Hintergrund der gesamten mittelalterlichen Vorstellung von Gemeinschaft wider, die sich selbst auf die Staatsführung übertrug. Während der Reformation, einer wichtigen Phase für die (Selbst)Wahrnehmung des Christentums, wird diese Aussage um 180° gedreht: Wer sein Seelenheil in der Unterordnung unter die kirchliche Obrigkeit sucht, so Luther, wird es verfehlen13. Im Zeitalter der Aufklärung wird der Religion schließlich wieder ein neuer Stellenwert zugewiesen: Die Religion wird über die Vernunft als oberstes und letztes Gebot des aufgeklärten Menschen zur reinen „Privatsache“, nachdem auch die absolute Herrschaft von Gottes Gnaden abgeschafft war14. Weitere Beispiele für soziale Institutionen, die das Individuum beeinflussen und über den Lauf der Geschichte Veränderungen erfahren haben wären z.B. das Bildungssystem mit seinen sich wandelnden Erziehungsmethoden und -zielen, die Ehe mit ihrer sich wandelnden Bedeutung für den Menschen, das Rechtssystem etc.
Die nächste Instanz, die das Individuum in seiner Entwicklung beeinflusst, ist die soziale Gruppe, also eine für das Individuum wesentlich überschaubarere soziale Erscheinung als die Institutionen. Hierzu zählt beispielsweise die Familie, die aufgrund ihres emotionalen Charakters besonders bedeutend für die Individuation im Kindesalter ist. Die Familien- mitglieder wirken über ihre Rollenverteilung aufeinander ein. Die Familie als Gruppe hat die wichtige Aufgabe, dem Kind als sich entwickelndem Individuum essentielle Fähigkeiten zu vermitteln, die eine Individuation erst möglich machen. Die Familienmitglieder müssen bereit und fähig sein, sich als Individuen zu entwickeln und immer neue Formen von Beziehungen einzugehen15. Das heißt z.B., dass Eltern bereit sein müssen, ihre Kinder in einem gewissen Alter loszulassen, damit diese ihre psychische und soziale Konstitution auch in anderen Umfeldern weiterentwickeln können. Besteht diese Bereitschaft nicht, wird das Kind in seiner Entwicklung gehemmt und es wird Schwierigkeiten haben, Beziehungen zu anderen Personen außer den Mitgliedern der eigenen Familie aufzubauen. Während seiner Entwicklung zum Individuum differenziert sich der/die Heranwachsende nach innen und grenzt sich nach außen ab, nimmt wahr, erkennt, integriert und bewertet Handlungen und Geschehnisse, erlebt sich als dauerhaft in seinem Körper beheimatet und wird zum Zentrum der eigenen Bedürfnisse, Ziele, Interessen, Rechte etc.16. Gegenwärtige Ansätze wie der von Stierlin aufgezeigte gehen davon aus, dass bereits während dieser Zeit die Individuation einsetzt; und zwar zunächst gegenüber den Eltern und evtl. Geschwistern. Stierlin spricht von „Individuation mit“ und „Individuation gegen“ die Eltern, wobei sich die erstgenannte „als Ausdruck und Folge zahlloser, gleichsam reibungslos, kooperativ und großenteils unbewußt ablaufender Aus- tauschprozesse zwischen heranwachsendem Kind und elterlicher bzw. familiärer Umwelt [zeigt]“17. Demgegenüber steht die „Individuation gegen“, die vergleichbar ist mit der Arbeitsweise des menschlichen Immunsystems: Es wird unterschieden zwischen „mein“ und „nicht mein“ und letzteres wird schroff zurückgewiesen durch die aufkommende Fähigkeit, Nein zu sagen18. Man muss allerdings berücksichtigen, dass weder die „Individuation mit“ noch die „Individuation gegen“ allein auftritt; jedes Kind durchlebt beide Varianten. Um sich allerdings mit als auch gegen die Eltern individuieren zu können, muss das Kind sich an die Realität der Eltern angepasst haben, d.h., die Sozialisation in die Familie muss stattgefunden haben.
In seiner weiteren Entwicklung wird der Mensch mit anderen Gruppen in Kontakt treten - aus freien Stücken (z.B. Vereine) oder gezwungenermaßen (z.B. Schule). Die „Pflicht“-Gruppen können dabei als wichtig für die Ausbildung und den Umgang mit Werten und Normen der jeweiligen Gesellschaft gesehen werden, während die frei gewählten Gruppen die Entwicklung der persönlichen Werte beeinflusst19. Dabei ist es nach Jungs Ansicht normal und wichtig, in Gruppen nicht nur einzutreten, sondern sie bei einem gewissen Entwicklungsstand auch wieder zu verlassen20:
„Wo immer, sei es in einzelnen Individuen, sei es in Gruppen von solchen, der Kulturprozeß im Weiterschreiten begriffen ist, da finden Loslösungen von Kollektivüberzeugungen statt... Ein Fortschritt beginnt daher immer mit Individuation [...]“21
Eine sich aus dem Wechsel von Gruppen und Kontakten ergebende Vielfalt von äußeren Impulsen ist insofern wichtig für die Individuation, als dass das Individuum so die Möglichkeit zur Nachahmung bekommt, die es befähigt, gezielt zu lernen22. Diese Nach- ahmung und auch die Anpassung an Gruppen als notwendiger Schritt dafür darf aber nicht verstanden werden im Sinne rein äußerlicher und bedingungsloser Angleichung, weil in diesem Fall eine Blockade der Individuation das Resultat wäre23. Eine Anpassung geschieht, weil man sich z.B. von einer bestimmten Gruppe die besten „Anregungen“ für sich selbst erwartet, die wieder die Individuation voranbringen24. Es geht also nicht darum, „[...] glatt, harmonisch, abgeschliffen zu werden, sondern immer mehr an sich wahrzunehmen, was man ist, was stimmig ist in der eigenen Persönlichkeit samt Ecken und Kanten“25.
Über den Gedanken der stetigen Abwägung, der impliziten Frage, ob man sich (noch) im für sich richtigen sozialen Umfeld bewegt bzw. was verändert werden muss, um der Mensch zu werden, „der man ist“, kommen wir zum Thema Emanzipation, das eng verknüpft mit der Individuation ist. Individuation heißt nicht nur Ausdifferenzierung der eigenen Persönlichkeit, sondern auch streben nach mehr Autonomie, „Man-selbst-Werden heißt also auch mündig zu werden“26. Emanzipation kann im Zusammenhang mit Individuation wie folgt erklärt werden: Strebt eine Gruppe von Menschen (also Individuen) nach der Befreiung von Unterdrückung jeglicher Art, handelt es sich um eine emanzipatorische Bewegung. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass jedes dieser Individuen vorher eine entsprechende Individuation durchlebt hat. Individuation ist also Voraussetzung der Emanzipation27.
Laut Jung ist die Mutter als erstes wichtiges Individuum im Leben eines Kindes und sener Beeinflussung zu sehen, weil es sich hier um die erste Beziehung handelt, die alle nachfolgenden Beziehungen zu anderen Menschen prägen wird28. Andere Beispiele für Individuen, die im Individuationsprozess von Bedeutung sind, wären Personen aus dem Freundeskreis oder Personen mit „Vorbildcharakter“ wie Lehrer sowie Lebens- und Sexualpartner. Die Bedeutung solcher Personen wird im Einzelnen aus der Analyse der Werke hervorgehen.
Bleibt noch auf ein grundlegendes Problem hinzuweisen: Reinhold spricht in seiner Definition von Individuation von „intendierter Individualität“, was darauf hinweist, dass der Prozess der Individuation auch ohne Erfolg, also das Erreichen von Individualität, vor sich gehen kann - schließlich kann niemand die Ergebnisse der Mehrheit seiner Taten im Voraus anschätzen. Sicherlich wird der Prozess im Leben eines Menschen in diesem Fall nicht für immer ausbleiben aber nicht jede Anstrengung, nicht jeder eingeschlagene Weg führt näher zum eigenen Ich - und dies wird auch an den vier hier besprochenen Werken zu sehen sein.
3 Die Auswahl der Werke
An dieser Stelle möchte ich mich nochmals mit dem Thema dieser Arbeit auseinandersetzen, diesmal, um zu klären, warum ich die vier Werke, die hier analysiert werden sollen, ausgewählt habe. Die Tatsache, dass ich nur Romane von Autorinnen in die Analyse aufgenommen habe, resultiert aus der einfachen Absicht, die Arbeit nicht um eine Ebene zu erweitern bzw. das Thema zu ändern. Wären hier auch Werke von Autoren eingeflossen, die mit weiblichen Figuren und deren Individuation arbeiten, wäre die Frage nach der Unterschiedlichen Behandlung des Themas „Individuation von Frauen“ seitens Männern und Frauen aufgekommen und somit womöglich auch wieder die Frage nach den geschlechtlichen Unterschieden - was nicht Thema dieser Arbeit ist. Außerdem meine ich persönlich, dass Autorinnen aufgrund ihrer Lebenserfahrung „authentischere“ (Lebens)Geschichten von Frauen erzählen - und hierbei geht es mir nicht darum, männlichen Autoren auf diesem Gebiet ihr Talent strittig zu machen.
Ich wählte die vier Werke La lógica del vampiro, Malena es un nombre de tango, Cuestión de azar und El corazón del Tártaro aus, weil sie mir in ihrer Thematik - es handelt sich bei allen um fiktive Autobiographien bzw. fiktive Biographien von Frauen - als am besten für die Bearbeitung der Themenstellung dieser Arbeit geeignet schienen1. Die Tatsache, dass es sich um fiktive (Auto)Biographien handelt, ist wichtig für die Bearbeitung des Themas Individua- tion, weil zum Schreiben einer Autobiographie gehört, das eigene Leben (kritisch) Revue passieren zu lassen, d.h. zu reflektieren. Dieser Bezug auf die eigene Erinnerung ist bei Jung mit dem Erleben der Archetypen verbunden: bei einer Erinnerung an den eigenen Vater beispielsweise werden bei jedem Menschen bestimmte Gefühle und Eindrücke hervorgerufen. Zusätzlich spielt bei derselben Erinnerung das kollektive Unbewusste eine Rolle, das zusätzliche Bilder z.B. des Vaters in unsere Erinnerung projiziert2.
Bei der Verwendung des Adjektivs „fiktiv“ für die (Auto)Biographien, machte ich mir aufgrund einer postmodernen Ansicht einige Gedanken, bei der davon ausgegangen wird, dass die Biographie eines Menschen, sobald er sie niederschreibt, eine fiktive Biographie wird. Man kann weder sein Leben noch das Leben anderer so nachdenken - und schon gar nicht niederschreiben -, dass es dem gelebten Leben entspricht:
„La recapitulación de una vida no es más que una imagen fantasmal, imaginaria de ésta, pues la persona que recuerda su pasado hace ya mucho tiempo que no es la misma que lo vivió. El pasado no puede ser evocado con relación al presente; por ello la autobiografía se constituye en la autointerpretación de ese pasado. En el proceso de autointerpretación, pasado y presente se confunden [...].”3
Insofern spielt es für die hier angestellte Analyse auch keine Rolle, ob es sich um eine Biographie oder Autobiographie handelt, denn das Leben, über das Berichtet wird, wird verändert wiedergegeben, egal ob es sich um den Bericht der Figur selbst oder eines auktorialen Erzählers handelt. Obwohl es sich um fiktive Figuren und Geschichten handelt, scheue ich davor zurück, die Romane als völlig fiktiv zu klassifizieren, weil die (Auto)Biographie einerseits einen Weg der Autorinnen darstellt, mit ihrer Randstellung fertig zu werden (vgl. Fußnote 1) und die Autorinnen zweitens selbst teilweise autobiographische Bezüge einräumen4.
Der äußere Anstoß für das (auto)biographische Schaffen von Frauen ist also, dass sie einerseits Mitglieder einen übergeordneten, allgemeinen Kultur sind, in der sie aber andererseits Mitglieder einer Minderheit ohne Stimme sind5. Diese äußeren Zustände und die persönliche psychische Konstitution der Autorinnen sind die gegenläufigen Komponenten „Außen und Innen“, die den Individuationsprozess auslösen. Das Produkt dieses Prozesses sind unter anderem die vier Romane, die hier zur Besprechung anstehen.
Was die Autorinnen angeht, hat jede von den hier vertretenen für sich einen Weg gefunden, mit dem Thema der weiblichen Individuation umzugehen. Die Wahl hätte genauso gut andere Autorinnen wie Montserrat Roig, Esther Tusquets oder andere treffen können; ich musste mich hier allerdings wegen des Umfangs der Arbeit auf vier Autorinnen beschränken. Bei der Frage, welches der Werke der einen oder anderen Autorin in die Analyse einbezogen werden sollte, spielten mehrere Überlegungen eine Rolle. Die Erscheinung der Romane sollte nicht zu lange in der Zeit zurück liegen und die Art der Herangehensweise sowie die Thematik, die die Autorinnen behandeln, sollten sich möglichst unterscheiden, um ein breites Spektrum von Möglichkeiten dieser Art von Literatur aufzuzeigen.
Im Rahmen einer Magisterarbeit kann nur exemplarisch aufgezeigt werden, was in einer wesentlich größeren Menge literarischer Texte von Frauen seit 1975 wahrzunehmen ist. Eine Untersuchung der Individuation von Frauen im gesamten Werk einer oder mehrerer
Autorinnen sowie z.B. die Untersuchung von Werken männlicher Autoren mit weiblichen
(Haupt)Figuren auf diese Thematik hin und vielleicht sogar ein Vergleich mit der Literatur von Frauen würde sich jedoch zweifelsohne lohnen, um die Präsenz und Bedeutsamkeit des Themas in der spanischen Gegenwartsliteratur aufzuzeigen.
3.1 Vitae
Adelaida Garc í a Morales 6 wurde 1945 in Badajoz geboren, wuchs aber mit ihren Eltern in Sevilla auf. Sie studierte in Madrid erst spanische Philologie und besuchte nach dem Abschluss die Escuela Oficial de Cinematograf í a, wo sie sich zur Drehbuchautorin ausbilden ließ. García Morales arbeitete als Mode-Model, Theater-Schauspielerin sowie Übersetzerin und gewann als Schriftstellerin 1981 mit El Sur den Premio S é samo und 1985 mit El silencio de las sirenas die Preise Herralde und Í caro.
Ihr Werk umfasst elf Romane, drei Bände mit Erzählungen, sowie einen Lyrikband. Ihr Debüt gab sie 1981 mit dem Roman Achipi é lago, dem 1985 der Doppelband El Sur seguido de Bene und El silencio de las sirenas, zwei ihrer erfolgreichsten Werke folgten. 1990 veröffentlicht sie den hier besprochenen Band La lógica del vampiro. Ihre beiden neusten Werke, Una historia perversa und El testamento de Regina wurden 2001 veröffentlicht.
Almudena Grandes 7 kam 1960 in Madrid zur Welt, wo sie später an der Universidad Complutense ihr Geschichts- und Geographiestudium absolvierte.
Grandes war vom Beginn ihrer Laufbahn an im Verlagswesen beschäftigt und brachte 1989 ihr Erstlingswerk Las edades de Lul ú auf den Markt, für den sie den Preis für erotische Literatur, La sonrisa vertical, erhielt. Es folgten zahlreiche Erzählungen sowie bis heute sechs weitere Romane - der neuste, Castillos de cartón, ist 2004 erschienen. Für den 2002 erschienen Roman Los aires dif í ciles erhielt sie im Jahr der Veröffentlichung den Premio Arcebispo San Clemente.
Josefina Molina 8 wurde 1936 in Córdoba geboren und studierte an der Madrider Universität Politikwissenschaft. 1969 schloss sie als erste Frau ihre Ausbildung an der Escuela Oficila de Cinematograf í a als Regisseurin ab. Sie begann ihre Karriere beim spanischen Fernsehen als Regisseurin und Produzentin, führte bei Theater und Film Regie - z.B. bei einem auf Miguel Delibes Cinco horas con Mario basierendem Theaterstück, das zehn Jahre auf spanischen Bühnen zu sehen war -, erhielt 1989 mit ihrem Film Esquilache den Ehrenpreis des Festival de Biarritz und wurde 1990 auf dem Festival Latino in New York für die beste Regie ausgezeichnet. Der 1997 erschienene Band Cuestión de azar ist ihr bislang einziger Roman.
Rosa Montero 9 wurde 1951 in Madrid geboren, wo sie auch begann, spanische Philologie zu studieren. 1969 begann sie eine Ausbildung an der Escuela de Peridismo. Während der Ausbildung dort sammelte sie bei verschiedenen Zeitungen Erfahrungen in der Redaktion. Ab 1977 schrieb sie Interviews für die Tageszeitung El Pa í s und veröffentlichte seit 1991 auch Kinder- und Jugendliteratur.
1979 kam ihr erster Roman Crónica del desamor auf den Markt. Montero erhielt etliche Preise, darunter den Premio Nacional de Periodismo (1980), den Premio Derechos Humanos (1989) und für den 1997 erschienenen Roman La hija del an í bal den Premio Primavera de Narrativa. 2001 veröffentlichte sie den hier besprochenen Roman El corazón del Tártaro, 2004 erschien ihr neuster Jugend-Roman El nido de los sue ñ os..
3.2 Überblick über den Inhalt der ausgewählten Werke
3.2.1 Adelaida García Morales: La lógica del Vampiro
Die Protagonistin Elvira bekommt ein Telegramm von Pablo, einem Freund ihres Bruders Diego, in dem er ihr mitteilt, ihr Bruder sei tot. In dem Moment, in dem sie von Amelia, der Besitzerin der Pension, in der Diego lebte, hört, dass diese nichts vom Tod ihres Bruders wisse, beginnt für Elvira eine Reise ins Ungewisse. Sie fährt nach Sevilla, wo sie in Diegos Zimmer absteigt und beschließt, sich auf die Suche nach ihrem Bruder oder seiner Leiche zu machen. In der Pension trifft Elvira auf Mara, die Geliebte Diegos, die Elvira mit ihren Aussagen über Diegos Tod genauso verwirrt wie Amelia: die beiden geben vor, von nichts zu wissen, was Elvira jedoch wenig glaubhaft erscheint. Elvira versucht, an Mara heran- zukommen, da diese ihr zu jenem Zeitpunkt als einzige erscheint, die ihr weiterhelfen kann.
So erfährt Elvira, dass Mara sich bereits vor einiger Zeit von Diego getrennt hat und dass möglicherweise ein Freund der beiden, Alfonso, Elvira weiterhelfen könne. Als Elvira das erste Mal auf Alfonso trifft, fühlt sie sich in seltsamer Weise von ihm bedroht und gleichzeitig angezogen und ist auch nach dem Treffen, in dem Alfonso versucht, Elvira zu beruhigen, noch verwirrt und aufgewühlt. In den folgenden Tagen trifft Elvira Alfonso noch öfter, da dieser sie zu seinem Landhaus fahren kann, wohin Diego sich noch vor der Nachricht seines Todes zurückgezogen hatte. Dort findet Elvira allerdings weder Diego noch dessen Leiche. Von ihren Treffen mit Alfonso kehrt Elvira immer verstimmt und völlig durcheinander zurück und sucht meist das Gespräch mit Mara, die ihr jedoch nach kurzer Zeit völlig leer und abweisend vorkommt. In den Gesprächen mit Mara und Alfonso, beginnt Elvira immer mehr am Inhalt von Pablos Telegramm zu zweifeln und beschließt, künftig nicht mehr auf leere Vermutungen zu reagieren. Zur Ablenkung beschließt Elvira, eine Einladung in Alfonsos Haus anzunehmen, wo sie den ganzen Freundeskreis Diegos kennen lernt: Teresa, Alfonsos Frau, die Elvira völlig apathisch und neben sich vorkommt, Sonia, eine junge Frau, die bei Alfonso Zuflucht fand und deren praktisch nicht vorhandenes musikalisches Talent Alfonso fördert sowie Félix, Sonias nervösen und aufbrausenden Freund. Mara gehört ebenfalls diesem Kreis an, der Elvira höchst suspekt vorkommt, weil die Personen praktisch nur verbindet, dass sie Alfonso kennen und dass sie alle Elvira schlichtweg leblos vorkommen. Pablo stößt zu diesem Treffen, wo er sichtlich nicht willkommen ist und führt später mit Elvira ein Gespräch unter vier Augen, in dem sie erfährt, Diego habe in Alfonsos Landhaus Selbstmord begangen. Aufgrund einiger Ungereimtheiten in Pablos Bericht schenk Elvira ihm aber keinen Glauben. Noch abweisender reagiert sie, als Pablo ihr seine Theorie unterbreitet, Alfonso sei eine Art Vampir, der Menschen an sich bindet, um ihnen jeglichen Antrieb auszusaugen und dass eben dieser Alfonso in den Tod Diegos verwickelt sei. Elvira beschließt, diese Theorie zu vergessen, kommt aber nicht davon los und in weiteren Treffen mit Alfonso und dem Freundeskreis beobachtet sie tatsächlich ein seltsames Einwirken Alfonsos auf die anderen und sie selbst. Über die Bekanntschaft zu Alfonso kommt Elvira jedoch besser mit Mara zurecht und die beiden kommen sich näher. Wegen Maras Distanziertheit entwickelt sich aber keine wirkliche Freundschaft. Schließlich ergibt sich eine weitere Möglichkeit, zum Landhaus zu fahren und Elvira findet mit Alfonso und Mara Diegos Leiche im ersten Stock. Tatsächlich weist alles auf Selbstmord hin und nachdem Elvira den ersten Schock überwunden hat, beginnt sie, Pablos Aussagen doch wieder zu überdenken. Alfonso verstrickt sich in widersprüchliche Aussagen zum möglichen Geschehen und Elvira fällt es nun wie Schuppen von den Augen: Alfonso war dafür verantwortlich, dass Diego seinen Beruf verlor, den er über alles im Leben liebte, was auch zu seinem Selbstmord geführt haben könnte. Er zerstörte auch die Beziehung Diegos zu Mara und entzog durch seine Ratschläge und „Hilfe“ den Menschen um sich jegliche Kraft, ohne dass diese es mitbekommen oder es sich eingestanden hätten. Als Elvira eines Abends nach der Beerdigung erst Mara und dann Alfonso zur Rede stellt, winden diese sich aus den Fragen und distanzieren sich von Elvira wie sie es vorher schon Pablo getan hatten. Es gelingt Elvira, sich aus dem Bannkreis Alfonsos zu entziehen und sie kehrt nach Madrid zurück, um diesen Kreis, dem sie jetzt auch einen verheerenden Einfluss auf sich selbst zuschreibt zu verlassen.
3.2.2 Almudena Grandes: Malena es un nombre de tango
Malena wird in eine gut situierte Familie geboren, bemerkt aber schon in ihrer Kindheit, dass sie so gar nicht in ihre Familie passt. Ihre Zwillingsschwester Reina ist ihr zwar eine gute Freundin, das Wesen der Zwillinge unterscheidet sich jedoch vollkommen. Der Vater der beiden behandelt die Töchter während der Kindheit gleich liebevoll, während die Mutter stets versucht, Malenas Wesen dem von Reina anzugleichen, weil diese in ihren Augen die bessere Tochter ist. Malena wünscht sich während ihrer gesamten Kindheit, ein Junge zu sein, weil sie meint, sie könne nie so gut wie ihre Schwester werden und als Junge wäre das Leben für sie leichter. Diese Einstellung verändert sich, als Malena realisiert, dass es in der Familie noch andere Personen gibt, die nicht dem Weltbild der Mutter entsprechen, denen sich Malena aber schnell zugehöriger fühlt, als ihrer Mutter oder ihrer Schwester. Ihr Großvater Pedro und ihre Tante Magda „retten“ Malenas Kindheit, indem sie ihr zeigen, dass sie etwas Besonderes ist. Die Sommerferien verbringt die Familie immer auf dem Landgut des Großvaters, wo sich Malena in ihrer Teenager-Zeit in Fernando verliebt, mit dem sie ihre erste Nacht verbringt und der die Liebe ihres Lebens bleiben wird. In diesem Sommer lüftet Malena ein Familiengeheimnis und findet heraus, dass der Großvater nach dem Krieg eine Affäre hatte, aus der auch Kinder hervorgingen. Diese „Erweiterung“ der Familie macht Malena klar, dass ihre Familie immer schon in diejenigen gespalten war, die sich immer anzupassen und zu schweigen wussten und in die mit dem „bösen Blut“ des Vorfahren Rodrigo, zu denen sie sich eindeutig zählt. Aus für sie unerfindlichen Gründen beendet Fernando die Beziehung zu Malena und sie braucht viel Zeit, um über diesen Verlust hinweg zu kommen. In ihrer Studienzeit verliert sie den Kontakt zu ihrer Schwester weitgehend und bewegt sich nun in Kreisen, die sich vom Umfeld ihrer Schwester völlig unterscheiden. Sie lässt sich auf zwielichtige Gestalten ein, nimmt Drogen und verhält sich auch ansonsten in jeder Weise gegen das Bild einer Frau, das ihre Mutter und Reina verkörpern. Sie lernt Santiago, einen gut aussehenden und gebildeten jungen Mann kennen, den sie schließlich heiratet und von dem sie auch ein Kind bekommt, was ihre „wilden Zeiten“ beendet. Zur gleichen Zeit ist auch Reina schwanger, was die beiden Schwestern wieder näher zueinander bringt. Allerdings ist Reina nicht aus einer Beziehung schwanger, sondern von Germán, einem schmierigen älteren Zeitgenossen, der sich bei Besuchen auch an Malena heranmacht. Die Unterschiede der Schwestern treten während und nach der Schwangerschaft klarer zu Tage und als sich die Eltern der Zwillinge trennen, wird klar, wer im Grunde die „bessere“ Tochter ist: Malena kümmert sich darum, dass ihre Mutter wieder Fuß fasst, während sich Reina aus allen Angelegenheiten heraushält. Sie hilft Malena zwar mit ihrem Kind, nutzt die Gelegenheit allerdings, um sich an Santiago heranzumachen, was schließlich dazu führt, dass die Ehe zwischen ihm und Malena zerbricht. Malena ist jedoch wütender über die Tatsache, dass Reina ihr den Mann ausgespannt hat, als darüber, dass die Beziehung beendet ist. Nun muss sich Malena um sich selbst kümmern und erinnert sich daran, dass ihr Großvater ihr eines Tages einen unschätzbar wertvollen Smaragd geschenkt hatte, von dem er gesagt hatte, er würde ihr eines Tages das Leben retten, sie dürfe ihn aber nur an ihren Onkel Tomás verkaufen. Genau das macht Malena und wird über Nacht zu einer reichen Frau. Sie nimmt sich eine Wohnung und beginnt ein neues Leben. Sie sieht bei einem Besuch ihres Sohnes, dass Reina ihren Platz im Leben Santiagos bereits völlig eingenommen hat und sich nun auch ihren Sohn erschmeicheln will. Wutentbrannt rafft sie die Dinge zusammen, die noch in der Wohnung sind und ihr etwas bedeuten, als sie ihr altes Tagebuch findet, das sie verloren glaubte. Reina hatte ihr das Tagebuch aber gestohlen und hämische Kommentare hineingeschrieben und so kommt Malena dahinter, dass Reina der Grund war, warum Fernando sie verlassen hatte: sie hatte ihn vergrault. Als Malena das erfährt, schließt sie nach einem Gewaltausbruch gegen ihre inzwischen wieder schwangere Schwester mit dieser ab, die immer die Gute zu sein vorgab, in deren Leben es aber mindestens genauso viele - allerdings verschwiegene - Skandale gegeben hatte, und konzentriert sich nur noch darauf, ihren Sohn zurückzubekommen. Malena bekommt eines Tages einen Anruf und als die Männerstimme am anderen Ende der Leitung verkündet „Ich habe dich gefunden...“, denkt Malena zuerst, es wäre Fernando. Wie sich herausstellt, ist es aber Rodrigo, ein Bekannter Santiagos, dem sie auf der Hochzeit ihrer Schwester mit Santiago kurz begegnet war. Sie besucht ihn und erfährt, dass der Grund seines Anrufs gewesen sei, dass Reina ein psychologisches Gutachten Malenas erstellen lassen wollte, um zu zeigen, dass sie nicht fähig sei, ihren Sohn aufzuziehen. Malena erzählt Rodrigo die ganze Geschichte um Reina, Fernando und sie selbst. Rodrigo, der Psychologe ist, erkennt selbst, dass eigentlich Reina diejenige mit den schwerwiegenden psychischen Problemen ist und erklärt sich bereit, ihr in der Sache mit ihrem Sohn zu helfen. Sie erkennt noch in der gleichen Nacht, dass sie ihr Bedürfnis nach wirklicher Nähe seit unterdrückt hatte und so lässt sie sich auf Rodrigo ein, nachdem sie ihre Schwester, Fernando und den „Fluch Rodrigos“, der ihre bisherigen Beziehungen überschattet hatte, überwunden hat.
3.2.3 Josefina Molina: Cuestión de azar
Weil es ihr seit längerem extrem schlecht geht, sucht die 24-jährige Dolores mit ihrer Mutter einen Arzt auf, und während der Arzt die Symptome abfragt wird bereits klar, dass die Mutter, Da María, Dolores bevormundet, als sei sie ein vierjähriges Kind. Dolores muss bis zum nächsten Tag auf die verheerende Diagnose warten. Als sie allein zum Arzt geht und erfährt, dass sie an Leukämie erkrankt ist, beschließt sie, die Krankheit vor ihren Eltern zu verheimlichen. In etlichen Rückblenden wird das Leben Dolores aufgerollt und dabei stellt sich heraus, dass sie in ihrer Kindheit unter der strengen und repressiven Erziehung ihrer Mutter, der praktischen Abwesenheit und dem Desinteresse ihres Vaters litt. Außerdem wurde sie zweimal sexuell missbraucht. Ihre Entwicklung verläuft verzögert und auch im weiteren Verlauf ihres Lebens erlebt sie Repression als etwas quasi Alltägliches. Sie wird auf eine von Nonnen geführte Mädchenschule geschickt, wo die Kinder mittels dogmatischer Glaubens- grundsätze zu gottesfürchtigen Frauen erzogen werden sollen. Hier wird Dolores dazu gezwungen, sich unterzuordnen und dass es keinen Zweck hat, Fragen zu stellen oder selbstständig zu denken. Sie lernt ihre beste und einzige Freundin Bernarda kennen, die ebenfalls von Mitschülerinnen traktiert wird und findet in ihr die einzige Person, die so denkt wie sie. Bernarda kommt allerdings aus einem wesentlich offeneren Elternhaus, was Dolores nur tiefer in die Krise stürzt, die sie mit ihren Eltern wegen deren Haltung durchlebt. Da María, Dolores Mutter, zeigt sich permanent überfordert und beschwert sich so lange bei ihrem Mann, Don Antonio, bis sie ihren Willen erzwingt und dieser mit der Familie in ein besseres Viertel umzieht. Dolores fängt in dieser schwierigen Zeit an, zu schreiben, um ihre Sorgen zu verwinden. Dadurch gelingt es ihr besser, mit ihrem Leben zurecht zu kommen. Als sie beschließt, das Schreiben zum Beruf zu machen, werden ihr von ihren Eltern und Redakteuren einiger Zeitungen, bei denen sie sich vorgestellt hat, nur Steine in den Weg gelegt. Bei einer Art Literatenzirkel lernt sie Pedro kennen, der unbedingt eine stabile Beziehung mit Dolores aufbauen will, mit dem sie sich aber nicht arrangieren kann, da ihr Herz an César, einem jungen Intellektuellen, den sie in Madrid kennen lernte, hängt und weil Pedro ihr viel zu gefühllos erscheint, um mit ihm eine Beziehung führen zu können.
[...]
1 cf. Campal Fernández, 1999, 273
2 cf. Rössler, 1992, 16
3 cf. Campal Fernández, 1999, 276
4 cf. Rössler, 1992, 16
5 Zum Thema der neuen Rechte der spanischen Frau vgl. zusammenfassend z.B. Rössler, 1992, 11 ff. Rössler weist auch darauf hin, dass das Jahr 1975 nicht als dogmatischer Wendepunkt in der spanischen Literatur gesehen werden sollte, weil es bereits in den letzten Jahren des (damals schon schwachen) Franco-Regimes Tendenzen zu feministischer Literatur gab, die sich allerdings nur durch das Ende des Regimes weiter entfalten konnten.
6 cf. Knights, 1999, 14 ff.
7 cf. Rössler, 1992, 11
1 cf. Reinhold, 1992, s.v. „Individuation“
2 cf. Hillmann, 19944, s.v. „Individuation
3 cf. Jung, 1964, 191
4 ibid.
5 cf. Mackenthun, 2000 (Internet-Artikel)
6 cf. Jung, 1964, 263
7 ibid.
8 cf. alle Mackenthun, 2000 (Internet-Artikel)
9 Martin Buber, 1965, zit. nach Strubel, 1981
10 cf. Strubel, 1981, 53
11 op.cit. 20
12 Cyprianus, o.J., zit. nach Strubel, 1981, 20
13 op.cit. 21
14 op.cit. 22
15 cf. Stierlin, 1989, 34
16 op.cit. 35
17 op.cit. 41
18 op.cit. 42
19 Hierbei ist zu beachten, dass sich die Bedeutung von Beziehungen zu Gruppen über die Jahrhunderte hinweg verändert hat. Im 20. Jahrhundert wird von einer individualisierten Gesellschaft ausgegangen, in der die Individuen ihre Gruppenzugehörigkeit und auch das Verlassen einer Gruppe pragmatisch und frei wählen. Cf. hierzu Beck, 1986, Kapitel IV, V und VII.
20 cf. Strubel, 1981, 89
21 C.G. Jung, o.J., zit. nach Strubel, 1981
22 op.cit. 50
23 Das Problem beim Thema Angleichung und Anpassung beschreibt Strubel (1981) ebenfalls: „Aus Angst, ihre Individualität zu verlieren, neigen die einen dazu, ihre Anpassung zu vernachlässigen; und aus Angst, den lebensnotwendigen Zusammenhalt mit anderen Menschen zu verlieren, neigen die anderen dazu, ihre Identität zu verleugnen.“
24 op.cit. 87 f.
25 cf. Kast, 1990, 118
26 ibid.
27 op.cit. 143
28 op.cit. 45
1 Meine Annahme dazu wurde z.B. von der Beobachtung Isolina Ballesteros bestätigt, dass „La escritura autobiográfica sigue siendo uno de los medios principales de expresión de los grupos oprimidos para resolver problemas de identidad cultural. En el caso de la mujer, el discurso autobiográfico no revela una identidad femenina preexistente, sino que provee las vías para la construcción del “yo” dentro de una realidad cultural y social determinada.” (2002, 30)
2 cf. Kast, 1990, 126 f.
3 cf. Ballesteros, 2002, 26 f.
4 So z.B. Almudena Grandes in einem 2000 veröffentlichen Interview: „Creo que toda ficción es autobiográfica del mismo modo que toda autobiografía es ficción” (cf. Añover, 2000, 808)
5 cf. Ballesteros, 2002, 32
6 cf. www.escritoras.com (02.01.05) s.v. „Adelaida García Morales“; hier ist auch die gesamte Liste der Werke zu finden.
7 cf. www.escritoras.com (02.01.05) s.v. „Almudena Grandes“; hier ist auch die gesamte Liste der Werke zu finden.
8 cf. Molina, 1997, Einband-Text
9 cf. www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/montero/autor_cronologia_2.htm und www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/montero/obra_bibliografia.htm (beide 02.01.05)
Details
- Titel
- Individuation von Frauen im spanischen Roman seit 1975
- Hochschule
- Universität Augsburg
- Veranstaltung
- Spanische Literaturwissenschaft
- Note
- 1,7
- Autor
- M.A. Joachim Flickinger (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2005
- Seiten
- 91
- Katalognummer
- V203768
- ISBN (eBook)
- 9783656304296
- ISBN (Buch)
- 9783656304494
- Dateigröße
- 637 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Indiviaduation Adelaida García Morales Almudena Grandes Josefina Molina Rosa Montero
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 36,99
- Preis (Book)
- US$ 47,99
- Arbeit zitieren
- M.A. Joachim Flickinger (Autor:in), 2005, Individuation von Frauen im spanischen Roman seit 1975, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/203768
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-