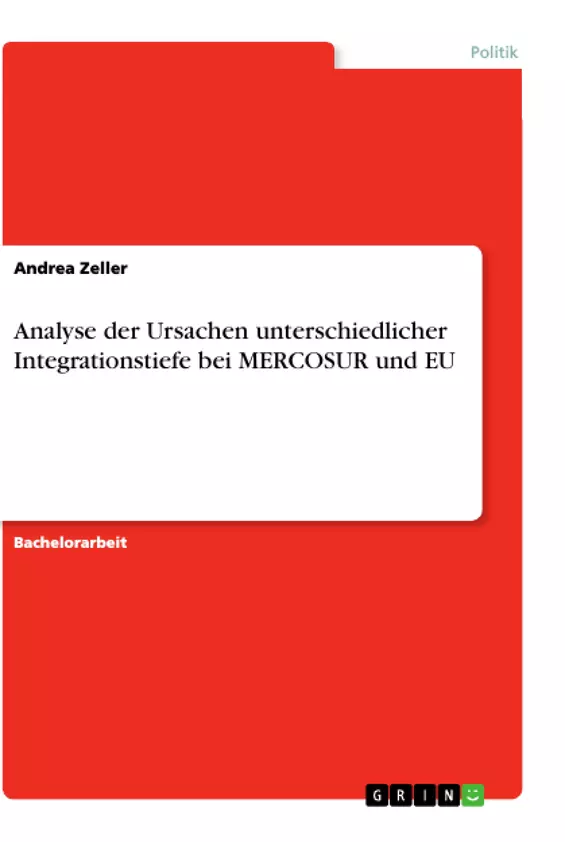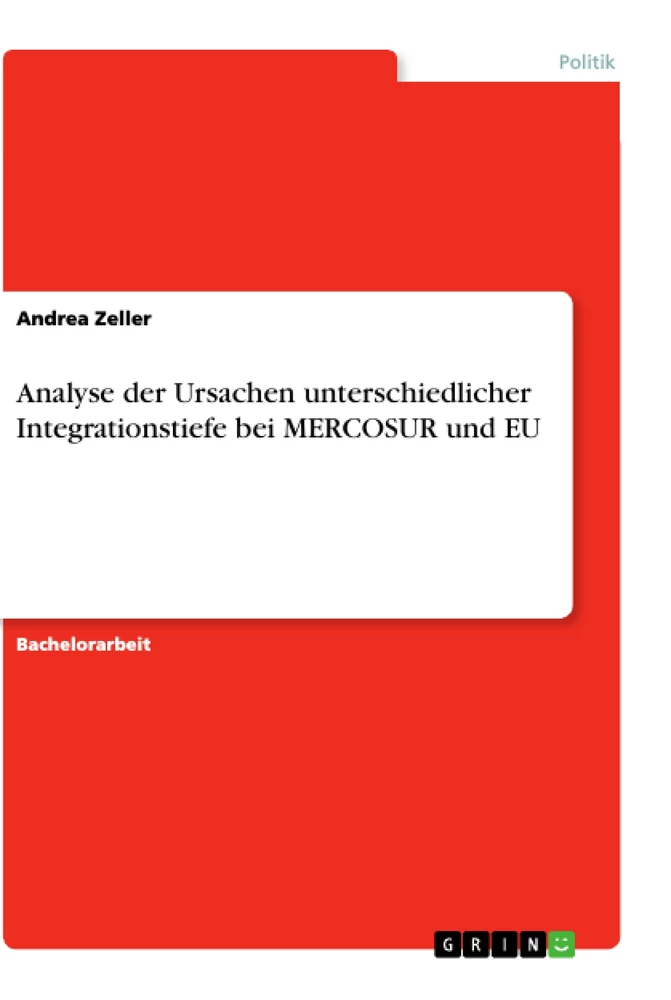
Analyse der Ursachen unterschiedlicher Integrationstiefe bei MERCOSUR und EU
Bachelorarbeit, 2009
80 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Regionale Integration
2.1 Begriffsbestimmung und integrationstheoretische Ansätze
2.1.1 lntegrationsformen
2.1.2 Europäisches Integrationsverständnis und Theorien der europäischen Integration
2.1.3 Lateinamerikanisches Integrationsverständnis
2.1.4 Weitere integrationstheoretische Ansätze
2.2 Anbahnung und Entwicklung regionaler Integration
2.2.1 Entstehung von Integration
2.2.2 Entwicklung von Integration
2.3 Analyse von Integration
3 Der Integrationsstatus des Mercosur und der EU
3.1 Die Integration der Mercosur-Staaten
3.1.1 Die Entwicklung des Mercosur
3.1.2 Der Integrationsstatus des Mercosur
3.2 Die europäische Integration
3.2.1 Von der EGKS zur EU
3.2.2 Analyse des Integrationsstatus der EU
3.3 Vergleich der Integrationstiefe
4 Mögliche Ursachen der unterschiedlichen Integrationstiefe
4.1 Ziele und institutionelle Struktur in den Gründungsverträgen
4.2 Nationale Einflussfaktoren
4.2.1 Soziopolitische und ökonomische Rahmenbedingungen
4.2.2 Innerstaatliche Akteure
4.3 Regionale Einflüsse
4.4 Internationales Umfeld
5 Fazit
Anlage I: Entstehung regionaler Integration
Anlage II: Entwicklung regionaler Integration
Anlage III: Die institutionelle Struktur des Mercosur
Anlage IV: Daten zur ökonomischen und soziopolitischen Entwicklung in EU und Mercosur
Anlage V: Bruttonationaleinkommen
Anlage VI: Innenumsätze nach Region
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Entstehung regionaler Integration
Abbildung 2: Entwicklung regionaler Integration
Abbildung 3: Die institutionelle Struktur des Mercosur
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Entwicklung der Bruttonationaleinkommen 1970 - 2007
Tabelle 2: Auslandsschulden der Mercosur-Staaten 1970 – 2007
Tabelle 3: Jährliche Inflation 1970 - 2007
Tabelle 4: Korruptionswahrnehmungsindex 2000 und 2008
Tabelle 5: Human Development Index 1980 – 2006
Tabelle 6: Bruttonationaleinkommen 1970 - 2007
Tabelle 7: Innenumsätze nach Region 1950 - 2006
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
Drei Regionalisierungswellen (vgl. Fawcett 2008, 19ff.; Telò 2007, 2ff.) haben im Laufe des 20. Jahrhunderts regionale Integration „zu einem neuen Bestandteil des internationalen Systems“ (Kösler/Zimmek 2008, 5) werden lassen. Vor allem die dritte Regionalisierungswelle, die mit dem Ende des Kalten Krieges begann und bis heute andauert, gilt als „Renaissance“ regionaler Integrationsbestrebungen. Die regionalen Arrangements dieser Welle werden häufig dem „Neuen Regionalismus[1] “ zugeordnet und früheren regionalen Integrationsbemühungen gegenübergestellt (vgl. Fawcett 2008, 22ff.; Bouzas 2005, 8ff.).
So vielfältig wie die regionalen Integrationsprojekte sind auch die zahl-reichen integrationstheoretischen Ansätze, die vor allem mit der dritten Re-gionalisierungswelle eine weitere Ausdifferenzierung erfuhren (vgl. Fawcett 2008, 22ff.). Viele Ansätze wurden dabei von der europäischen Integration inspiriert, die zeitgleich im Rahmen verschiedener Vertragsreformen und Erweiterungen an Dynamik gewann (vgl. Bieling/Lerch 2006, 9ff.). Heute gilt die Europäische Union (EU) als am weitesten entwickelte Form regionaler Integration und wird daher oft als Modell für andere Regionen betrachtet. Ob die EU ferner als Beurteilungsmaßstab regionaler Integration dienen kann, wird jedoch verschiedentlich in Frage gestellt (vgl. Murray 2008, 57ff.; Higgott 2007, 75ff.). Auch der Gemeinsame Markt des Südens (Mercado Común del Sur, Mercosur[2]) wurde von der Integration in Europa inspiriert. Er wurde 1991 während der dritten Regionalisierungswelle von Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay gegründet, ist heute jedoch anders integriert als die EU (vgl. Vasconcelos 2007, 166f.).
Nach der Analyse der jeweiligen Integrationstiefe steht die Frage nach den Ursachen der unterschiedlichen Verfasstheit des Mercosur und der EU im Zentrum der vorliegenden Arbeit. Der erreichte Integrationsstatus des Mercosur soll hierbei allerdings keiner Wertung im Sinne von „unfertig“ oder „verbesserungswürdig im Vergleich zur EU“ unterzogen werden. Ausgehend von verschiedenen theoretischen Ansätzen werden die Ziele, Rahmenbedingungen und die Entwicklung des Mercosur und der EU verglichen: Deuten bereits verschiedenartige Motive und Ziele auf eine unterschiedliche Integrationstiefe hin? Welche Rolle spielen das soziopolitische und ökonomische Umfeld oder nationale Souveränitätsvorstellungen? Was kann auf die internationale Umgebung zurückgeführt werden? Und wie groß ist der Einfluss der regionalen Ebene?
Die vorliegende Arbeit besteht aus fünf Kapiteln. Nach der Einleitung werden im zweiten Kapitel einige theoretische Grundlagen regionaler Integration vorgestellt: Der Skizzierung verschiedener Integrationsformen folgt eine Übersicht integrationstheoretischer Ansätze. Danach werden die Entstehung und Entwicklung regionaler Integration genauer untersucht. Abschließend werden verschiedene Indikatoren zur Analyse von Integration erörtert. Das dritte Kapitel befasst sich mit einer kurzen Beschreibung der Herausbildung von Mercosur und EU sowie mit der Bestimmung des jeweils aktuellen Integrationsstatus anhand der zuvor ermittelten Indikatoren. Im vierten Kapitel erfolgt eine nähere Überprüfung der möglichen Ursachen für die festgestellte unterschiedliche Integrationstiefe. Dazu werden nationale, internationale und regionale potentielle Einflussfaktoren wie etwa die Integrationsziele, die globale Umwelt sowie die Aktionen regionaler Instanzen des Mercosur und der EU analysiert. Im abschließenden fünften Kapitel werden die Erkenntnisse dieser Arbeit zusammengefasst und die Ursachen der unterschiedlichen Integrationstiefe näher eingegrenzt.
Die vorliegende Untersuchung konzentriert sich auf die Entwicklung von Integration (Integration als Prozess, vgl. Bieling/Lerch 2005, 13), das heißt auf die Ziele, Triebkräfte und Hemmnisse der ausgewählten regionalen Integrationsprojekte, um die Ursachen der unterschiedlichen Integrationstiefe zu erforschen. Aufgrund der Vielfalt integrationstheoretischer Perspektiven kann hier jedoch lediglich auf eine Auswahl relevanter Ansätze eingegangen werden. Der bisherige Integrationsverlauf des Mercosur und der EU wird im Rahmen der Statusermittlung kurz skizziert; der Charakter des integrierten Systems (Integration als Zustand) wird nur, soweit zur Bestimmung des Integrationsstatus erforderlich, mit einbezogen. Untersucht werden soll der Status der Integration 2008.
2 Regionale Integration
„Regionen sind ein wichtiges Strukturmerkmal der internationalen Beziehungen“ (Spindler 2005, 11; vgl. Carranza 2000, 7), doch trotz der zahl-reichen, mit regionaler Integration befassten theoretischen Ansätze existiert keine generell anwendbare Integrationstheorie (vgl. Wessels 2006, 428ff.). Keine Perspektive enthält alle Facetten regionaler Integration. Jeder Integrationsprozess verläuft nach eigenen Regeln und stellt ein beliebiges Zusammenspiel aus Motiven, Rahmenbedingungen, Zielsetzungen, Interessen und Möglichkeiten dar (vgl. Kühnhardt 2008, 270). Im Folgenden soll dargelegt werden, was unter regionaler Integration zu verstehen ist, welche theoretischen Ansätze existieren, wie sich Integration anbahnt, beziehungsweise entwickelt und wie die Integrationstiefe verglichen werden kann.
2.1 Begriffsbestimmung und integrationstheoretische Ansätze
Im Allgemeinen wird unter Integration „die Entstehung oder Herstellung einer Einheit oder Ganzheit aus einzelnen Elementen“ (Nohlen 1998, 277) verstanden.
„[Damit kann] politische Integration […] definiert werden als Prozess der Aufgabe nationaler Souveränität zugunsten einer übergeordneten politischen Einheit [und] ökonomische Integration als ein Prozess des Abbaus zwischenstaatlicher Transaktionshemmnisse innerhalb einer Staatengruppe. […] Für die entsprechenden übergeordneten Prozesse wird neben Integration häufig der Begriff ‚Regionalismus’ verwendet.“ (Husar 2007, 86).
Eine Staatengemeinschaft gilt als supranational, wenn sie
„verbindliche Beschlüsse [fassen kann], die die Mitgliedstaaten auch gegen deren Willen verpflichten können […]. Dies kann […] durch die Schaffung von unabhängigen Organen, in denen nicht alle oder kein Mitgliedstaat vertreten ist, oder durch Organe, in denen zwar alle Staaten vertreten sind, die aber mit Stimmenmehrheit Beschlüsse fassen [geschehen].“ (Fuders 2008, 143).
Bieling/Lerch unterscheiden ferner zwischen Integration als „Prozess“, wodurch der Vorgang einer Eingliederung bisher separater „politische[r], ökonomische[r] und/oder gesellschaftliche[r] Einheiten“ bezeichnet wird, und Integration als „Zustand“, womit das Ergebnis dieses Eingliederungsvorgangs gemeint ist, welches „den Zusammenhalt der Teileinheiten gewährleistet“ (vgl. Bieling/Lerch 2006, 13).
Zudem muss Integration von Kooperation abgegrenzt werden: Während die Integration mehrerer Staaten zur Errichtung einer übergeordneten „politischen Einheit“ führt, bezeichnet internationale Kooperation „zwischenstaatliche Zusammenarbeit“ ohne Bildung einer „neuen politischen Einheit“ (vgl. List 1999, 16). Regionale Integration hat zudem Rückwirkungen auf die politische, rechtliche und kulturelle Dimension der Mitgliedstaaten und es kommt zu Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Bereichen (vgl. Kösler/Zimmek 2008, 6).
2.1.1 lntegrationsformen
Es können verschiedene Formen, Dimensionen oder Stufen regionaler Integration unterschieden werden, wobei im Folgenden lediglich jene zwei Klassifizierungen näher beschrieben werden, die für den Fortgang der Untersuchung erforderlich sind.
Eine frühe, mittlerweile klassische Einteilung regionaler Integration in mehrere Stufen erfolgte in den 1960er Jahren durch Bela Balassa und bezieht sich auf Prozesse wirtschaftlicher Integration (vgl. Higgott 2007, 78). Die einzelnen Stufen bauen aufeinander auf, das gesamte Modell ist auf einen fortschreitenden Integrationsprozess in Richtung der letzten Stufe ausgerichtet. Die erste Stufe wirtschaftlicher Integration stellt eine Freihandelszone dar, in welcher die Zölle zwischen den Mitgliedstaaten abgebaut werden. Die zweite Stufe, eine Zollunion, baut auf der Freihandelszone auf und verfügt zusätzlich über einen einheitlichen Außenzoll. Ein Gemeinsamer Markt stellt die dritte Integrationsstufe dar. Dies ist eine Zollunion, in welcher sämtliche Beschränkungen und Hemmnisse aufgehoben werden, damit sich Güter, Arbeit, Kapital und Dienstleistungen frei über die Grenzen der teilnehmenden Länder hinweg bewegen können. Die vierte Stufe besteht aus einer Wirtschaftsunion. Dies bedeutet, dass zusätzlich zur Freizügigkeit des Gemeinsamen Marktes die nationalen Wirtschaftspolitiken harmonisiert werden. Eine Politische Union ist die höchste Stufe der Integration: Hier wird die Wirtschaftspolitik von einer supranationalen Ebene aus gesteuert (vgl. Malcher 2005, 63; vgl. De Lombaerde/Dorruci/Genna u.a. 2008, 150f.).
Schimmelfennig nimmt Bezug auf die politische Integration wenn er am Beispiel der EU drei Dimensionen von Integration unterscheidet: Die „sektorale Dimension“ bezieht sich auf die Anzahl der eingegliederten Politikfelder. Eine Erweiterung der sektoralen Integration würde die Aufnahme eines neuen Politikfeldes in die Gemeinschaftspolitik bedeuten, das heißt die Mitgliedstaaten geben diesen Bereich zugunsten einer gemeinschaftlichen Regulierung ab. Die „vertikale Dimension“ betrifft die „Kompetenzverteilung“: Werden innerhalb der integrierten Politikbereiche etwa die Abstimmungsmodalitäten von Einstimmigkeitsentscheiden auf Mehrheitsbeschlüsse geändert oder Kompetenzen der Mitgliedstaaten an ein supranationales Organ übertragen, kann von einer stärkeren vertikalen Integration oder einer Vertiefung der Integration gesprochen werden. Die „horizontale Dimension“ hat das Territorium zum Gegenstand: Bei einer horizontalen Erweiterung kann es sich um neue Mitgliedstaaten aber auch um Abkommen beziehungsweise Assoziationen mit neuen Ländern handeln (vgl. Schimmelfennig 2008, 291ff.).
2.1.2 Europäisches Integrationsverständnis und Theorien der europäischen Integration
Die europäische Integration wird aufgrund ihrer wechselhaften Entwicklung verschiedentlich als „moving target“ (Bieling/Lerch 2006, 9) oder „Baustelle“ (List 1999, 18) bezeichnet. Ihre dynamische Entstehungsgeschichte hinterließ Spuren, sowohl im europäischen Integrationsverständnis als auch bei den Theorien der europäischen Integration.
Die Vision einer Einheit Europas kann bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgt werden (vgl. Elvert 2006, 23ff.). Nach dem Zweiten Weltkrieg erhoffte man sich in Europa Frieden, Sicherheit und ökonomischen Wohlstand (Weidenfeld 2007, 15f.). Während des Kalten Krieges zwischen den Westmächten und dem Ostblock stand die beginnende (west)europäische Integration zudem für eine Verknüpfung von „Demokratie, Marktwirtschaft und sozialstaatliche[r] Gerechtigkeit“ (Bodemer 2002, 99).
Die „reale“ (west)europäische Integration begann im wirtschaftlichen Sektor (vgl. Weidenfeld 2007, 17ff.). Spätestens seit dem Vertrag von Maastricht bedeutet „gelebte“ Integration im europäischen Kontext jedoch mehr als „nur“ wirtschaftliche Integration, sie beinhaltet zudem eine politische, rechtliche und soziale Dimension (vgl. Nickel 2007, 151f.).
Viele Integrationstheorien wurden von der europäischen Integration inspiriert (vgl. Bieling/Lerch 2006, 12), und auch ihre Schwerpunkte haben sich über die Jahre verändert.[3] Im Folgenden wird die phasenweise Entwicklung wichtiger Integrationstheorien kurz nachgezeichnet:
Die „erste Phase der politisch-normativen Theoriebildung“ setzte etwa mit der Beendigung des Zweiten Weltkriegs ein. Sie wurde einerseits durch den Föderalismus, andererseits durch den Funktionalismus bestimmt. Mit der Gründung eines föderalen europäischen Bundesstaates wollte der Föderalismus Staatsgrenzen überwinden und eine friedliche Koexistenz der europäischen Völker sichern (vgl. Bieling/Lerch 2006, 25). David Mitrany als Vertreter des Funktionalismus stand dagegen regionaler Integration skeptisch gegenüber und setzte zur Friedenssicherung auf „ein Netzwerk transnationaler Organisationen auf funktioneller Basis“, das staatliche Macht beschränken sollte (vgl. Diez/Wiener 2004, 7).
Die zweite Phase beherrschte der Neo-Funktionalismus als „dominante[s] Paradigma“ (Bieling/Lerch 2006, 25): Ernst B. Haas orientierte sich an der europäischen Integration als er klären wollte, weshalb Staaten zugunsten einer sich formierenden „politischen Gemeinschaft“ Souveränität abgeben. Basierend auf einem „pluralistische[n] Gesellschaftsbild“, einem „technisch-funktionalistische[n] Staatsverständnis“ und der Annahme rationalen Akteurhandelns sah er die Ursachen für diesen Prozess in der Logik des „spill-over“, also des „Überschwappens“ einmal begonnener Integrationsprozesse auf weitere, angrenzende Politikbereiche, sowie im Wirken von Eliten, supranationalen Institutionen und den Regierungen teilnehmender Staaten. Die involvierten Akteure müssten ständig weitere Bereiche der Hoheit der Gemeinschaft unterstellen, um den reibungslosen Ablauf der einmal begonnenen Integration abzusichern (Faber 2005, 41ff.).
Es folgte eine Phase der „dreifachen Infragestellung des Neo-Funktionalismus“ (Bieling/Lerch 2006, 26). Der Intergouvernementalismus von Stanley Hoffmann galt als klare Kritik am Neo-Funktionalismus. Inspiriert von der realistischen Schule sowie von der Politik von Charles de Gaulle maß er Machterwägungen und nationalen Interessen in regionalen Integrationsprozessen erhebliche Bedeutung bei. Er unterschied politisch sensible Bereiche wie Außen- und Sicherheitspolitik (high politics) von weniger politisierten Bereichen (low politics) und gestand mögliche Integrationsfortschritte nur letzteren Politikfeldern zu (Faber 2005, 88ff.). Auch seitens der marxistischen Theorien wurde der Neo-Funktionalismus in Frage gestellt. Diese sahen „Integrationsschritte […] auf internationaler Ebene […] als politische Reaktionen auf endemische Probleme kapitalistischer Entwicklung […]“ (Beckmann 2006, 121). Angesichts der Schwierigkeiten des europäischen Integrationsprozesses in den 1970er Jahren zweifelte Haas schließlich 1975 selbst den Neo-Funktionalismus an (Higgott 2007, 78).
Nach Jahren des Stillstands der theoretischen Debatte stand die vierte Phase ab dem Ende der 1980er Jahre im Zeichen der „Wiederaufnahme der integrationstheoretischen Diskussion“; dabei wurde oft an die früheren Ansätze angeknüpft (vgl. Bieling/Lerch 2006, 27). Der liberale Intergouver-nementalismus von Moravcsik sieht wie der klassische Intergouvernementalismus dann eine Entwicklung des Integrationsprozesses vor, wenn die Interessen der wichtigsten Mitgliedstaaten übereinstimmen und zusammen Regeln verabschiedet werden, die allen vorteilhaft erscheinen. Die Interessen der beteiligten Staaten entstehen hier jedoch in einem „innergesellschaftlichen Präferenzbildungsprozess“ (vgl. Steinhilber 2006, 169f.). Auch der Supranationalismus von Stone Sweet und Sandholtz weist Parallelen zum Neofunktionalismus auf. Hier wird das Voranschreiten der Integration allerdings aus der gemeinsamen Entwicklung dreier unabhängiger Variablen erklärt: Supranationale Organisationen gelten als Motor der Herausbildung gemeinsamer Regelungen, welche ihrerseits die Entstehung einer transnationalen Gesellschaft begünstigen. Diese wiederum befürwortet stärkere supranationale Organisationen und Regelungen, weil sie davon Nutzen zieht (vgl. Nölke 2006, 149ff.). Der Neo-Gramscianismus hat dagegen historisch-materialistische Wurzeln. Als Basis der europäischen Integrationsdynamik gelten für Gill „zivilgesellschaftliche Kräfte“; die Haupttriebkraft stellen der „Kampf um Herrschaft“ unterschiedlicher „sozialer Klassen“ und die „gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse“ dar (vgl. Bohle 2006, 204).
In der nun folgenden Phase der „Kombination aus Perspektivenwechsel, Perspektivenirritation und Perspektivenerweiterung“ seit den 1990er Jahren (vgl. Bieling/Lerch 2006, 28) befasste sich die theoretische Debatte zur europäischen Integration mehr mit der aktuellen Verfassung der EU als mit der Suche nach den Ursachen und Triebkräften der fortschreitenden Integration wie in den vorhergehenden Phasen (vgl. Faber 2005, 25; Nölke 2006, 165f.). Mehr und mehr wurden die „institutionelle Form und die politischen Prozesse in der EG/EU“ analysiert. Der „Perspektivenwechsel“ manifestierte sich etwa im Mehrebenenansatz oder in der Policy-Analyse. Ferner wurde das „rationalistische Paradigma“ zunehmend von konstruktivistischen Ansätzen hinterfragt, was als „Perspektivenirritation“ interpretiert werden kann. Die „Perspektivenerweiterung“ zeigte sich letztlich in der zunehmenden interdisziplinären Öffnung der integrationstheoretischen Debatte (vgl. Bieling/Lerch 2006, 28ff.).
Generell bleibt festzuhalten, dass eine erhebliche Ausdifferenzierung theoretischer Ansätze stattgefunden hat (vgl. Wessels 2006, 427ff.) und sich kein Ansatz allein zur Erklärung des komplexen europäischen Integrationsgeschehens durchsetzte.
2.1.3 Lateinamerikanisches Integrationsverständnis
Die lateinamerikanischen Integrationsbemühungen und das dortige Verständnis von Integration unterlagen ebenfalls wechselhaften Entwicklungen. Ausgehend vom bolivarischen[4] Traum einer „allumfassenden politischen Einheit Lateinamerikas“ im 19. Jahrhundert leiteten etwa ab dem Ende des Zweiten Weltkrieges unter anderem wirtschaftliche Überlegungen die lateinamerikanischen Integrationsbestrebungen (vgl. Husar 2007, 86). Mit Hilfe regionaler Integration und der Anwendung des von der Comisión Económica para América Latina y el Caribe[5] (CEPAL) vorgeschlagenen Konzeptes der „Importsubstituierenden Industrialisierung“ (ISI)[6] auf regionaler Ebene sollte die wirtschaftliche Entwicklung Lateinamerikas gefördert werden. Diese Art der Integration gilt oft als „alter Regionalismus“ (vgl. Carranza 2000, 42). Die Schuldenkrise der 1980er Jahre beendete die Phase der ISI-Strategie, regionale Integration stand nun auch bei der CEPAL im Zeichen des „offenen Regionalismus“[7], der sich an den Strukturreformen des „Washington Consensus“[8] orientierte: Dieser zielte auf eine „verstärkte Eingliederung in die Weltwirtschaft“ statt auf einen Schutz vor ihr wie bisher; Industrialisierung wurde nicht mehr angestrebt. Die Rolle des Staates sollte begrenzt werden, auch „zwischenstaatliche Institutionen“ regionaler Integrationsprojekte wurden kritisch gesehen. Seit den neuerlichen Finanzkrisen Ende der 1990er Jahre und dem „Linksruck“ auf dem amerikanischen Subkontinent findet jedoch nicht nur bei der CEPAL eine immer stärkere Abkehr von den Empfehlungen des Washington Consensus statt. Das Konzept des „offenen Regionalismus“ verliert an Strahlkraft, während das Ansehen einer „verstärkten Binnenorientierung“ wieder steigt (vgl. Husar 2007, 85ff.; Malcher 2005, 67ff.).
Zur Erklärung lateinamerikanischer Integrationsbestrebungen wurden keine eigenen theoretischen Ansätze entwickelt, jedoch können die oben genannten Theorien der europäischen Integration teilweise angewendet werden. Carranza greift zudem in seiner Analyse der Integration in Lateinamerika unter anderem auf den (Neo)Realismus, die Dependenztheorie und den Konstruktivismus zurück (Carranza 2000, 16ff.): In der anarchischen Welt des (Neo)Realismus spielt die Sicherung der staatlichen Souveränität durch Machteinsatz die Hauptrolle. Die Theorie der hegemonialen Stabilität als Variante des Neorealismus besagt zudem, dass internationale Regime nur entstehen, wenn ein Hegemon die Umsetzung der vereinbarten Regeln sichert (Keohane 1989, 77ff.). Die Dependenztheorie hat lateinamerikanische Wurzeln und nennt Abhängigkeit von den Ökonomien der Zentren des Weltmarkts als Ursache für die Unterentwicklung Lateinamerikas (Carranza 2000, 19f.). In konstruktivistischen Ansätzen wird dagegen die Wechselbeziehung zwischen „Strukturen und Akteuren“ hervorgehoben (vgl. Steinhilber 2006, 173). Dabei wird unter anderem die Rolle eines regionalen Bewusstseins und regionaler Identität in Integrationsprozessen untersucht (vgl. Carranza 2000, 24ff.). Auch hier bleibt festzuhalten, dass kein theoretischer Ansatz allein den Ablauf regionaler Integration zu erklären vermag.
2.1.4 Weitere integrationstheoretische Ansätze
Es gibt viele ökonomische Ansätze, die sich mit regionaler Integration befassen. Zu den bekanntesten zählen etwa die Zollunionstheorie nach Viner, die handelsschaffende von handelsumlenkenden Effekten unterscheidet (vgl. Korth 08, 196f.) oder die Theorie des optimalen Währungsraumes, welche die Einführung einer gemeinsamen Währung unter anderem von der Auswirkung externer Schocks auf die teilnehmenden Staaten abhängig macht (vgl. Inotai/Petkova 2008, 119ff.). Viele ökonomische Analysen regionaler Integrationsprojekte in der Tradition der Zollunionstheorie konzentrieren sich jedoch vornehmlich auf Handelsauswirkungen und vernachlässigen die politische Dimension (vgl. Carranza 2000, 73), daher wird im Folgenden nicht weiter auf sie eingegangen.
Neoklassische Modelle wirtschaftlichen Wachstums schließen auf mögliche Angleichungseffekte bei den Mitgliedern regionaler Integration: weniger entwickelte Ökonomien scheinen schneller zu wachsen als die höher ent-wickelten, was zu einer Annäherung des wirtschaftlichen Niveaus führen kann (vgl. Rapacki 2008, 93ff.). Im Rahmen der politischen Ökonomie des neuen Regionalismus greift Padoan in seiner Analyse regionaler Integration auch auf die ökonomische Theorie des Klubs von Buchanan und Olson zu-rück: Diese geht von rational handelnden Akteuren aus, die eigene Vorteile durch einen freiwilligen Zusammenschluss mit anderen zu verwirklichen suchen. Eine Gruppe kann dabei so lange wachsen, wie sich die Nettonutzensituation der einzelnen Teilnehmer verbessert (vgl. Padoan 2007, 41ff.).
Ferner existiert eine Reihe von Ansätzen, die sich aus mehreren Theorien zusammensetzen: Mattli kombiniert beispielsweise in seiner Erklärung regionaler Integration politikwissenschaftliche mit ökonomischen Theorien. Er weist einerseits auf die Bedeutung wirtschaftlicher Einflüsse hin und betont andererseits die Relevanz institutioneller Faktoren (Mattli 1999, 41ff.).
2.2 Anbahnung und Entwicklung regionaler Integration
Die oben genannten theoretischen Ansätze enthalten Annahmen zur Entstehung und/oder Entwicklung regionaler Integration. Ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, soll im Folgenden aus einigen der Hypothesen ein Analyserahmen zur Untersuchung regionaler Integration konstruiert werden. Hierbei werden zwei Phasen unterschieden: die Entstehung von Integration und die Entwicklung bestehender Integrationsabkommen. Soweit möglich werden die einzelnen Aspekte der nationalen, regionalen und internationalen Ebene zugeordnet. Der Analyserahmen dient als Basis zur Gliederung der potentiellen Ursachen unterschiedlicher Integrationstiefe bei Mercosur und EU.
2.2.1 Entstehung von Integration
Die Phase der Entstehung regionaler Integration soll im Folgenden mit der Unterzeichnung eines regionalen Integrationsabkommens enden. Als Motive und Ziele derartiger Vorhaben kommen aus Sicht der teilnehmenden Staaten in Frage: der Wunsch nach regionaler Sicherheit und dauerhaftem Frieden (vgl. Große Hüttmann/Fischer 2006, 51f.; Wolf 2006, 74), eine Stabilisierung der Demokratie in der Region (vgl. Duina 2006, 32f.) oder eine größere Verhandlungsmacht auf globaler Ebene (vgl. Fawcett 2008, 26). Zudem versprechen sich die nationalen Regierungen eine Vergrößerung ihrer Handlungsspielräume sowie die Verwirklichung „wirtschaftliche[r] Vorteile“ (vgl. Bieling 2006, 102), etwa durch größere Absatzmärkte, Effizienzsteigerungen der heimischen Produktion oder eine gesteigerte Attraktivität für Investoren (vgl. Ravenhill 2005, 124ff.). Weniger entwickelte Staaten erhoffen sich eine Angleichung des wirtschaftlichen Niveaus (vgl. Rapacki 2008, 93ff.), kleinere Länder möchten den regionalen Führer in die Gemeinschaft eingebunden wissen (vgl. Telò 2007, 4). Dominieren im eigenen Land die Integrationsbefürworter, kann die Regierung versucht sein, mit Hilfe regionaler Integration ihre Wiederwahl zu sichern (Steinhilber 2007, 177ff.). Weitere Ziele und Motive können den bislang genannten Integrationstheorien entnommen werden.
Damit regionale Integration entstehen kann, bedarf es begünstigender Faktoren und der Erfüllung gewisser Bedingungen, die größtenteils nachfolgend kurz dargestellt werden. Die Skizze eines möglichen Ablaufs befindet sich im Anhang (vgl. Anlage I):
1) Entwicklungen der internationalen Umgebung können die Gesellschaften und Regierungen eines Staates beeinflussen. Eine gemeinsam wahrgenommene externe Bedrohung politischer, wirtschaftlicher oder sonstiger Art kann daher die Entstehung regionaler Integration begünstigen (vgl. Faber 2005, 101). Ebenso ist dies der Fall wenn die künftigen regionalen Partner denselben internationalen Regimen angehören (vgl. Padoan 2007, 42f.) oder ein wohlwollender, integrationsfördernder Hegemon vorhanden ist (vgl. Keohane 1989, 77ff.).
2) Auch regionale Faktoren begünstigen die Entstehung von Integrationsabkommen. Dazu zählen die Ähnlichkeit politischer Systeme und ideeller Strukturen einer Region (vgl. Kühnhardt 2008, 264ff.), grenzüberschreitende politische, wirtschaftliche und sonstige Verflechtungen (vgl. Nölke 2006, 153) sowie eine geringe Anzahl teilnehmender Staaten (vgl. Axelrod/Keohane 1986, 234ff.).
3) Damit sich regionale Integration herausbilden kann, müssen auch gewisse Bedingungen auf nationaler Ebene erfüllt werden: In den einzelnen Staaten muss der mögliche Nutzen des gemeinsamen Abkommens ersichtlich sein (Motive und Ziele s.o.). Daneben sind in den potentiellen Mitgliedsländern mächtige gesellschaftliche Befürworter der Integration erforderlich (vgl. Bieling 2006, 107; Carranza 2000, 20ff.), zudem muss das Vorhaben im Interesse der Regierung stehen (vgl. Faber 2005, 101). Das Integrationsbedürfnis einer Regierung hängt laut Mattli auch von der aktuellen wirtschaftlichen Situation im Staate ab: In „wirtschaftlich guten Zeiten“ sei die Integrationsbereitschaft eher niedrig, in Zeiten wirtschaftlicher Krisen ist sie dagegen stärker ausgeprägt (vgl. Mattli 1999, 50f.). Ferner muss die Regierung zur Abgabe von Souveränität an die regionale Ebene bereit sein (vgl. Kegel/Amal 2008, 211). Sind die Regierenden des Weiteren in der Lage ihre Präferenzen im Zeitablauf zu ändern (vgl. Padoan 2007, 38) oder gibt es einen Staat, der die regionale Führung übernimmt (vgl. Mattli 1999, 42), begünstigt dies das mögliche Zustandekommen regionaler Integration.
4) Schließlich müssen Verhandlungen zu einem regionalen Integrationsabkommen zustande kommen und erfolgreich abgeschlossen werden (Herausbildung der regionalen Ebene). Hierfür sollten die Präferenzen und Ziele der Verhandlungspartner übereinstimmen oder zumindest ähnlich sein (vgl. Axelrod/Keohane 1986, 228), auch hinsichtlich der Bereitschaft zur Abgabe von Souveränität. B egünstigend wirken Abhängigkeitsverhältnisse, das heißt, wenn Verhandlungspartner auf den Abschluss eines regionalen Abkommens angewiesen sind (vgl. Steinhilber 2006, 181f.). Zuletzt muss eine Einigung der Verhandlungspartner erfolgen, um die regionale Integration offiziell zu besiegeln.
2.2.2 Entwicklung von Integration
Die Phase der Integrationsentwicklung soll im weiteren Verlauf mit der Unterzeichnung eines regionalen Integrationsabkommens beginnen; wie und ob die Integration voranschreitet ist dabei offen: Entwicklung beinhaltet hier sowohl eine sektorale, vertikale als auch horizontale Erweiterung, eine Stagnation oder eine Rücknahme von Integration (vgl. Anlage II). Eine wichtige Rolle bei der Entwicklung spielen unter anderem die oben genannten begünstigenden Faktoren und die Bedingungen regionaler Integration. Bei sämtlichen intergouvernementalen Verhandlungen zur Integration gelten dieselben Voraussetzungen wie bei den Erstverhandlungen eines Integrationsabkommens (vgl. Kap. 2.2.1). Vor allem wenn die Bedingungen signifikanten Veränderungen unterliegen, kann der Integrationsprozess stagnieren oder Rückschritte erleiden. Generell gilt:
„On the one hand it is important to understand regional integration as a process of contingent historical circumstances, specific combinations of challenge and response and local conclusions and consequences. On the other hand, regional integration is linked with global trends in politics and economics. It is an indigenous response to exogenous challenges as much as it is a local scheme that might echo distant experiences of others.” (Kühnhardt 2008, 261).
Die wichtigsten Akteure der Integrationsentwicklung werden abhängig vom gewählten integrationstheoretischen Ansatz der nationalen oder regionalen, seltener der internationalen Ebene zugeschrieben. Nachfolgend werden einige der Triebkräfte der Entwicklung von Integration kurz dargestellt:
Viele theoretische Ansätze sehen die wesentlichen Ursachen einer Erweiterung von Integration auf der nationalen Ebene: Im Intergouvernementalismus gilt die Regierung eines Nationalstaats als essentielle Basiseinheit. Sie überträgt Kompetenzen vornehmlich im Bereich der low politics an supranationale Organe, und zwar nur dann, wenn dies im nationalen Interesse liegt. Das nationale Interesse wiederum wird geprägt von binnenpolitischen und internationalen Rahmenbedingungen, wobei das Streben nach einem internationalen Gleichgewicht der Mächte eine wichtige Rolle spielt (vgl. Bieling 2006, 92ff.). Auch der Liberale Intergouvernementalismus sieht die Befriedigung des nationalen Interesses als Motor integrativer Bestrebungen seitens der Regierung. Hier wird der Staat jedoch als Produkt „gesellschaftlicher Machtverhältnisse“ gesehen. Bei der Bildung des nationalen Interesses spielen daher unter anderem die wirtschaftlichen Interessen einflussreicher sozialer Akteure eine wichtige Rolle. In den intergouvernementalen Verhandlungen müssen die Präferenzen der Verhandlungspartner übereinstimmen damit ein Ergebnis erzielt wird. Sind einzelne Staaten von der weiteren Integrationsentwicklung abhängig oder werden taktische Mittel wie die Androhung eines Verhandlungsausschlusses oder Paketlösungen eingesetzt, kann dies die Chancen integrativer Fortschritte erhöhen (vgl. Steinhilber 2006, 177ff.). Wirtschaftliche Interessen spielen in der Marxistischen Politischen Ökonomie eine Schlüsselrolle: Die Machthaber werden gedrängt, die politischen Rahmenbedingungen für die Ausdehnung der Wirtschaft zur Verfügung zu stellen, was eine Forcierung regionaler Integration bedeutet. Zusätzlich können ökonomische Krisen die weitere Integration begünstigen (vgl. Beckmann 2006, 121ff.). Der Neogramscianismus sieht in zivilgesellschaftlichen Kräften ebenfalls einen wichtigen Einflussfaktor: Im „Kampf um Herrschaft“ setzen sich die stärksten Kräfte durch. Profitieren diese von regionaler Integration, wird sie vorangetrieben (vgl. Bohle 2006, 204ff.). Die ökonomische Theorie des Klubs macht Integrationsfortschritte dagegen von den individuellen Kosten und Erträgen der Mitgliedstaaten abhängig. Kosten entstehen etwa durch das Management regionaler Integration, die gemeinsame Entscheidungsfindung oder die Wahrung des politischen Gleichgewichts. Erlöse ergeben sich aus Sicherheitsaspekten, niedrigen Transaktionskosten zwischen den Mitgliedsländern oder einer gemeinsamen Währung. Weitere Integration ist lohnend, solange der Nettonutzen der Mitglieder positiv ist. Der Anreiz zum Beitritt zu einem regionalen Integrationsabkommen ergibt sich ebenfalls aus dem Vergleich der Kosten und Erträge einer Mitgliedschaft. Mit der Aufnahme neuer Mitglieder steigen jedoch auch die Kosten der anderen Teilnehmerländer, da sich die Führungsprobleme mit zunehmender Mitgliedszahl vergrößern (vgl. Padoan 2007, 41ff.).
Transnationale Interdependenzen und vorwiegend wirtschaftliche Austauschprozesse stellen im Neofunktionalismus (vgl. Wolf 2006, 71), im Supranationalismus (vgl. Stone Sweet/Sandholtz 1998, 11ff.) wie auch in der Marxistischen Politischen Ökonomie (vgl. Beckmann 2006, 125) einen wichtigen Einflussfaktor der Entwicklung regionaler Integration dar. Der Supranationalismus macht zudem die Integrationsgeschwindigkeit vom Aktivitätsgrad nichtstaatlicher Akteure abhängig (vgl. Stone Sweet/Sandholtz 1998, 14).
Der Neofunktionalismus sieht auf der regionalen Ebene gar die stärksten Triebkräfte einer Integrationsentwicklung: Aufgrund transnationaler Verflechtungen wird zunächst die gemeinschaftliche Regelung technischer Aspekte erforderlich. Einmal gegründet, entwickelt eine supranationale Instanz jedoch ihre eigene Dynamik, welche einen spill-over in benachbarte Bereiche zur Folge hat. Der so ausgelöste zunehmende Transfer politischer Entscheidungskompetenz auf Gemeinschaftsorgane führt zu einer stetigen vertikalen wie territorialen Vergrößerung des gemeinschaftlichen Politikbereichs (vgl. Wolf 2006, 70ff.). Auch der Supranationalismus weist der regionalen Ebene eine zentrale Rolle bei der Integrationsentwicklung zu. Die Ausweitung supranationaler Kompetenz geschieht jedoch nicht quasi „automatisch“; sie wird von der transnationalen Gesellschaft aufgrund spürbar positiver Effekte des Wirkens supranationaler Organisationen gefordert. Zudem kann die Ausdehnung und Stabilisierung der Gemeinschaftsbereiche auch durch die Rechtssprechung supranationaler Instanzen erfolgen (vgl. Stone Sweet/Sandholtz 1998, 14ff.).
Die Theorie hegemonialer Stabilität hebt die internationale Ebene als wichtige Einflussgröße regionaler Integration hervor. Eine hegemoniale Macht kann ihre Ressourcen gezielt zugunsten internationaler Regime, die aus ihrer Sicht förderungswürdig sind, einsetzen. Je nach Kooperationsbereitschaft der Gegenseite kann dies durch die Androhung von Zwang oder die Bereitstellung von Unterstützungsleistungen erfolgen (vgl. Keohane 1989, 78).
Der Mehrebenenansatz sieht speziell die EU als eigenes politisches System. Integration entsteht in „vier Phasen: (1) policy initiation, (2) decision-making, (3) implementation und (4) adjudication“ (Knodt/Große Hüttmann 2006, 230), die von je unterschiedlichen Akteuren verschiedener Ebenen dominiert werden. Generell versuchen Regierungen, gesellschaftliche, wirtschaftliche und supranationale Akteure ihren Einfluss geltend zu machen (vgl. Knodt/Große Hüttmann 2006, 225ff).
Die Ursachen für Stagnation oder gar Rücknahme von Integration werden, sofern thematisiert, vorwiegend der nationalen Ebene zugeschrieben. Der späte Neofunktionalismus und der Supranationalismus identifizieren „Nationalismen“ (vgl. Wolf 2006, 79) beziehungsweise die Interessen der einzelnen Regierungen (vgl. Nölke 2006, 153) als Grund stagnierender Integration. Auch im Intergouvernementalismus und seiner liberalen Variante ist die nationale Ebene in der Lage, einer drohenden „Souveränitätsbeschneidung“ entgegenzuwirken, wenn diese nicht dem staatlichen Interesse entspricht (vgl. Bieling 2006, 103; vgl. Steinhilber 2006, 177ff.). Als zusätzliche Hindernisse einer erfolgreichen Integration nennt Kühnhardt zudem mangelnden politischen Umsetzungswillen, unzureichende personelle oder sonstige Kapazitäten sowie fehlenden binnenländischen Antrieb und die Abwesenheit bestärkender Partner in den anderen Mitgliedsländern (vgl. Kühnhardt 2008, 264). Ökonomische Krisen sind gemäß der Marxistischen Politischen Ökonomie ebenfalls in der Lage, Integration zu behindern (vgl. Beckmann 2006, 128).
Schließlich kann regionale Integration gemäß der Theorie der hegemonialen Stabilität auch zum Erliegen kommen, wenn auf der internationalen Ebene die Leistungsfähigkeit der unterstützenden hegemonialen Macht sinkt (vgl. Keohane 1989, 78f.).
2.3 Analyse von Integration
Basierend auf den Integrationsformen und möglichen Integrationsentwick-lungen soll nun festgelegt werden, was unter „Integrationstiefe“ zu verstehen ist, um diese im weiteren Verlauf beim Mercosur und der EU zu bestimmen. Eine erste Klassifizierung kann zunächst mit Hilfe der Stufen wirtschaftlicher Integration nach Balassa (vgl. Kap. 2.1.1) vorgenommen werden. Hierbei gilt: je höher die realisierte Integrationsstufe, desto tiefer die Integration. Zur genaueren Untersuchung des Integrationsstatus kann im nächsten Schritt die vertikale Dimension von Integration nach Schimmelfennig (vgl. Kap. 2.1.1) herangezogen werden. Je mehr Kompetenzen die Mitgliedstaaten an die supranationale Ebene übertragen haben und je häufiger Mehrheitsbeschlüsse zum Einsatz kommen, desto tiefer ist der Grad der Integration. Mols spezifiziert dies durch seine Beschreibung verschiedener „Abstufungen erreichter Integration“. Diese sind (aufsteigend):
„Konsultationen ohne Entscheidungsbefugnis, intergouvernementale Entscheidungen nach dem Einstimmigkeitsprinzip, intergouvernementale Entscheidungen nach einer gewichteten Qualifizierungsformel (alle minus x), Mehrheitsentscheidungen, die für alle Beteiligten bindend sind, supranationale, von den Kompetenzüberwachungen der Nationalstaaten völlig losgelöste Entscheidungsorgane mit eigener Kompetenz, zusätzlich: Einführung einer suprastaatlichen Gerichtsbarkeit, die die nationale Rechtssprechung ganz oder teilweise bindet.“ (Mols 1996, 28).[9]
Mit Hilfe einer Analyse der Zuständigkeiten und Kompetenzen gemein-schaftlicher Organe sowie gängiger Abstimmungsmodi soll eine Zuordnung zu den von Mols genannten Abstufungen vorgenommen werden. Mit jeder weiteren erreichten Stufe gilt der Integrationsgrad als tiefer.
Auch die eingegliederten Politikfelder (sektorale Dimension) lassen Rückschlüsse auf die Integrationstiefe zu: Je mehr unterschiedliche Politikfelder einbezogen werden, desto weiter ist die Integration vorangeschritten.
Kegel und Amal ziehen ferner aus dem Vergleich regionaler Gesetzgebung mit dem Völkerrecht Rückschlüsse auf die Tiefe der Integration: Die Integration der Mitgliedsländer gilt als umso tiefer, je spezifischer ihre gesetzlichen Grundlagen im Vergleich zum Völkerrecht geregelt sind (vgl. Kegel/Amal 2008, 211). Im Folgenden wird angenommen, dass eine supranationale rechtssprechende Instanz vor allem benötigt wird, um komplexe Sachverhalte eines Integrationsabkommens im Konfliktfall weiter zu spezifizieren. Ihr Wirken trägt damit wiederum zur Steigerung der Komplexität des Gemeinschaftsrechts bei. Daher soll aus dem Vorhandensein einer derartigen Instanz auf ein komplexes, im Vergleich zum Völkerrecht sehr spezifisches, gemeinsames Recht geschlossen werden.
[...]
[1] In den internationalen Beziehungen versteht man unter Regionalismus „die politischen Aktivitäten zum Zusammenschluss mehrerer Staaten einer (Welt-)Region […].“ (Schubert/Klein 2006, 251). Es existieren jedoch auch andere Definitionen. Eine kurze Einführung zum Neuen Regionalismus bietet Telò 2007. Ausführliche Informationen zum Neuen Regionalismus aus eher ökonomischer Sicht vgl. Spindler 2005. Zum Neuen Regionalismus in Südamerika siehe Carranza 2000, Kap. 1-3.
[2] Die offizielle Abkürzung lautet „MERCOSUR“ (vgl. CMC 2002, Art. 1), in der Literatur wird jedoch meist die Abkürzung „Mercosur“ verwendet. Dies wird im Folgenden übernommen.
[3] Welche Theorien und Ansätze erwähnt werden, variiert je Autor. Der folgende Überblick orientiert sich an: Bieling, Hans-Jürgen/Lerch, Marika (Hrsg.) (2006): Theorien der europäischen Integration. 2. Aufl., Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
[4] Simón Bolívar organisierte 1826 den „Congreso de Panamá“. Damit beabsichtigte er die Bildung einer lateinamerikanischen Föderation, welche die Unabhängigkeit von Spanien sichern sollte (vgl. Carranza 2000, 41; Husar 2007, 86).
[5] Die CEPAL ist die Wirtschaftskommission der VN für Lateinamerika und die Karibik, nähere Informationen finden sich unter http://www.eclac.cl/, (Zugriff 22.06.09).
[6] Die Importsubstituierende Industrialisierung (ISI) sollte die Entwicklung der nationalen/regionalen Industrie mit Hilfe des Staates unter anderem im Rahmen einer protektionistischen Handelspolitik fördern (vgl. Malcher 2005, 67ff.).
[7] „Offener Regionalismus“ wird oft in Verbindung mit „Neuem Regionalismus“ genannt (vgl. Spindler 2005, 17).
[8] Nähere Informationen zum Washington Consensus finden sich im BMZ-Diskurs 003 des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung von 2004.
[9] Stone Sweet und Sandholtz schlagen mit ihrem Kontinuum zwischen den beiden Polen der intergouvernementalen und supranationalen Politik einen ähnlichen Weg ein (vgl. Stone Sweet/Sandholtz 1998, 8). Die Abstufungen von Mols sind hier jedoch besser zur Bestimmung der Integrationstiefe geeignet.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird die EU oft als Modell für regionale Integration betrachtet?
Die Europäische Union gilt als die am weitesten entwickelte Form regionaler Integration und dient daher häufig als Beurteilungsmaßstab für andere Regionen.
Was ist der MERCOSUR?
Der MERCOSUR (Gemeinsamer Markt des Südens) wurde 1991 von Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay gegründet und ist ein bedeutendes Integrationsprojekt in Lateinamerika.
Welche Ursachen gibt es für die unterschiedliche Integrationstiefe von EU und MERCOSUR?
Unterschiede liegen in den Motiven, den soziopolitischen und ökonomischen Rahmenbedingungen sowie in nationalen Souveränitätsvorstellungen der Mitgliedstaaten.
Was unterscheidet Supranationalität von bloßer Kooperation?
Supranationale Organisationen können verbindliche Beschlüsse fassen, die Mitgliedstaaten auch gegen deren Willen verpflichten, während Kooperation lediglich zwischenstaatliche Zusammenarbeit ohne neue politische Einheit bedeutet.
Welche Rolle spielt das internationale Umfeld für die Integration?
Die globale Umwelt und internationale Einflüsse können regionale Integrationsprozesse entweder fördern oder durch externe Abhängigkeiten hemmen.
Details
- Titel
- Analyse der Ursachen unterschiedlicher Integrationstiefe bei MERCOSUR und EU
- Hochschule
- FernUniversität Hagen (Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften)
- Note
- 1,3
- Autor
- Andrea Zeller (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2009
- Seiten
- 80
- Katalognummer
- V203893
- ISBN (eBook)
- 9783656319825
- ISBN (Buch)
- 9783656321040
- Dateigröße
- 706 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- EU MERCOSUR Integration Regionalisierung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 34,99
- Preis (Book)
- US$ 45,99
- Arbeit zitieren
- Andrea Zeller (Autor:in), 2009, Analyse der Ursachen unterschiedlicher Integrationstiefe bei MERCOSUR und EU, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/203893
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-