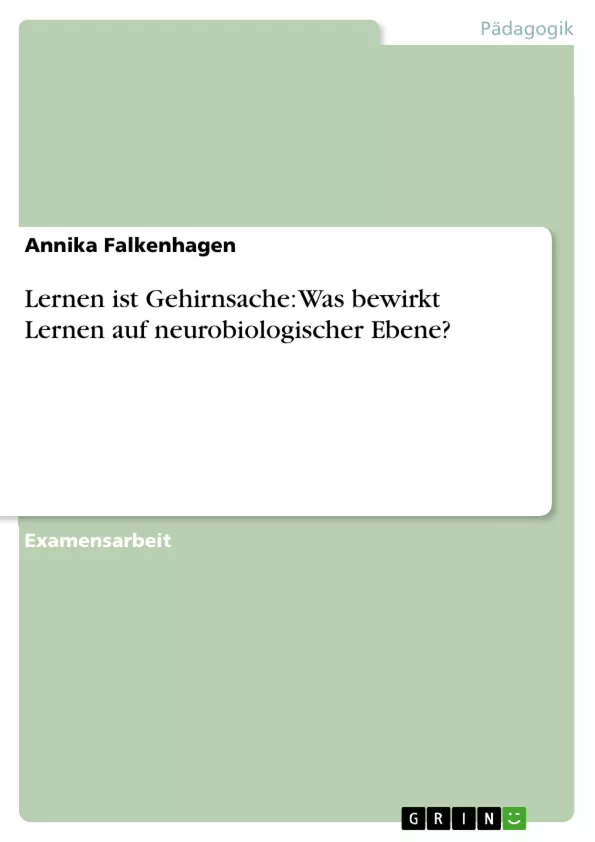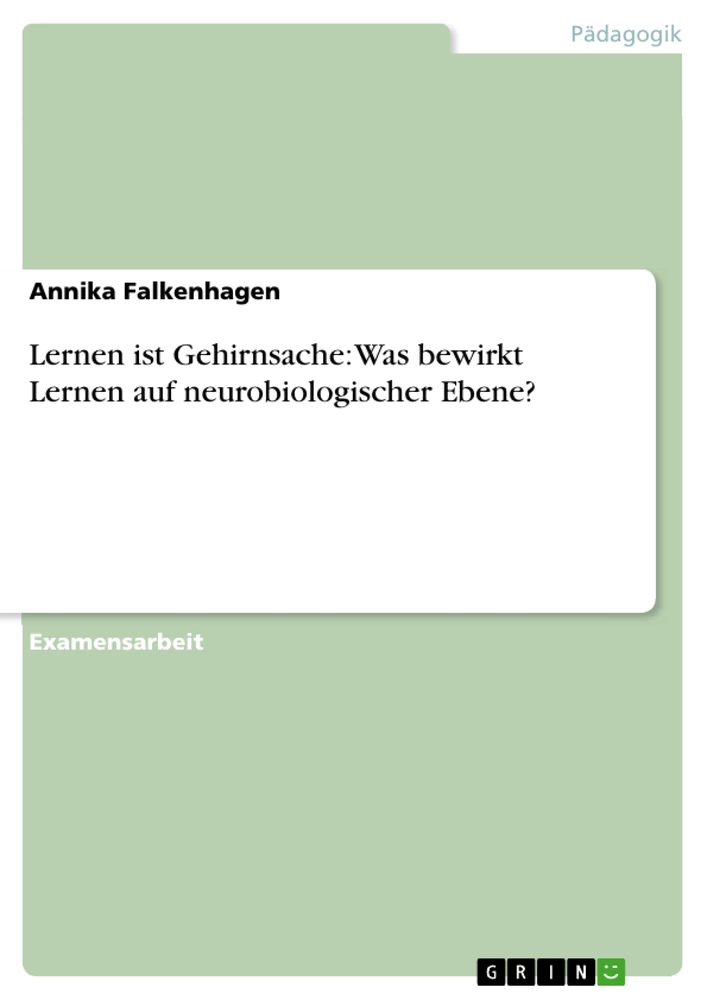
Lernen ist Gehirnsache: Was bewirkt Lernen auf neurobiologischer Ebene?
Examensarbeit, 2011
49 Seiten, Note: 2,0
Leseprobe
Inhalt
1. Einführung Lernen
2. Anatomische und physiologische Grundlagen
2.1. Das Zentralnervensystem
2.2. Zelluläre Grundlagen des Gehirns
2.3. Informationsweiterleitung
3. Was ist Lernen?
3.1. Definition
3.2. Neuronale Repräsentationen
3.3. Die Plastizität des Gehirns oder: Lernen auf zellulärer Ebene
3.3.1. Veränderungen an Neuronen und deren Synapsen
3.3.2. Veränderungen der kortikalen Karte
3.4. Gedächtnis
4. Am Lernen beteiligte Hirnstrukturen
5. Wie oder wodurch Lernen beeinflusst wird
5.1. Aufmerksamkeit 27
5.2. Emotionen
5.3. Motivation
6. Didaktische Rückschlüsse
7. Zwischenfazit
8. Die basale Form des Lernens durch Nachahmung
9. Quellen- und Materialbasis
9.1. Nicht- elektronische Medien
9.2. Internetquellen
9.3. pdf-Dateien
Häufig gestellte Fragen
Was passiert beim Lernen auf zellulärer Ebene?
Lernen führt zu Veränderungen an den Neuronen und deren Synapsen, was als neuronale Plastizität bezeichnet wird.
Welche Faktoren beeinflussen den Lernprozess?
Aufmerksamkeit, Emotionen und Motivation spielen eine entscheidende Rolle für den Lernerfolg.
Was ist das Zentralnervensystem (ZNS)?
Es ist die anatomische Basis für Informationsverarbeitung und Lernen im menschlichen Körper.
Was versteht man unter Lernen durch Nachahmung?
Es ist eine basale Form des Lernens, die stark von der Interaktion mit Bezugspersonen und Vorbildern abhängt.
Welche didaktischen Rückschlüsse lassen sich aus der Neurobiologie ziehen?
Die Arbeit zeigt auf, wie Erkenntnisse über die Hirnfunktionen genutzt werden können, um Lehrmethoden effektiver zu gestalten.
Details
- Titel
- Lernen ist Gehirnsache: Was bewirkt Lernen auf neurobiologischer Ebene?
- Hochschule
- Universität zu Köln
- Note
- 2,0
- Autor
- Annika Falkenhagen (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 49
- Katalognummer
- V204536
- ISBN (eBook)
- 9783656327219
- ISBN (Buch)
- 9783656328285
- Dateigröße
- 814 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Lernen Gehirn Spiegelneurone Nachahmung;
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 27,99
- Arbeit zitieren
- Annika Falkenhagen (Autor:in), 2011, Lernen ist Gehirnsache: Was bewirkt Lernen auf neurobiologischer Ebene?, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/204536
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-