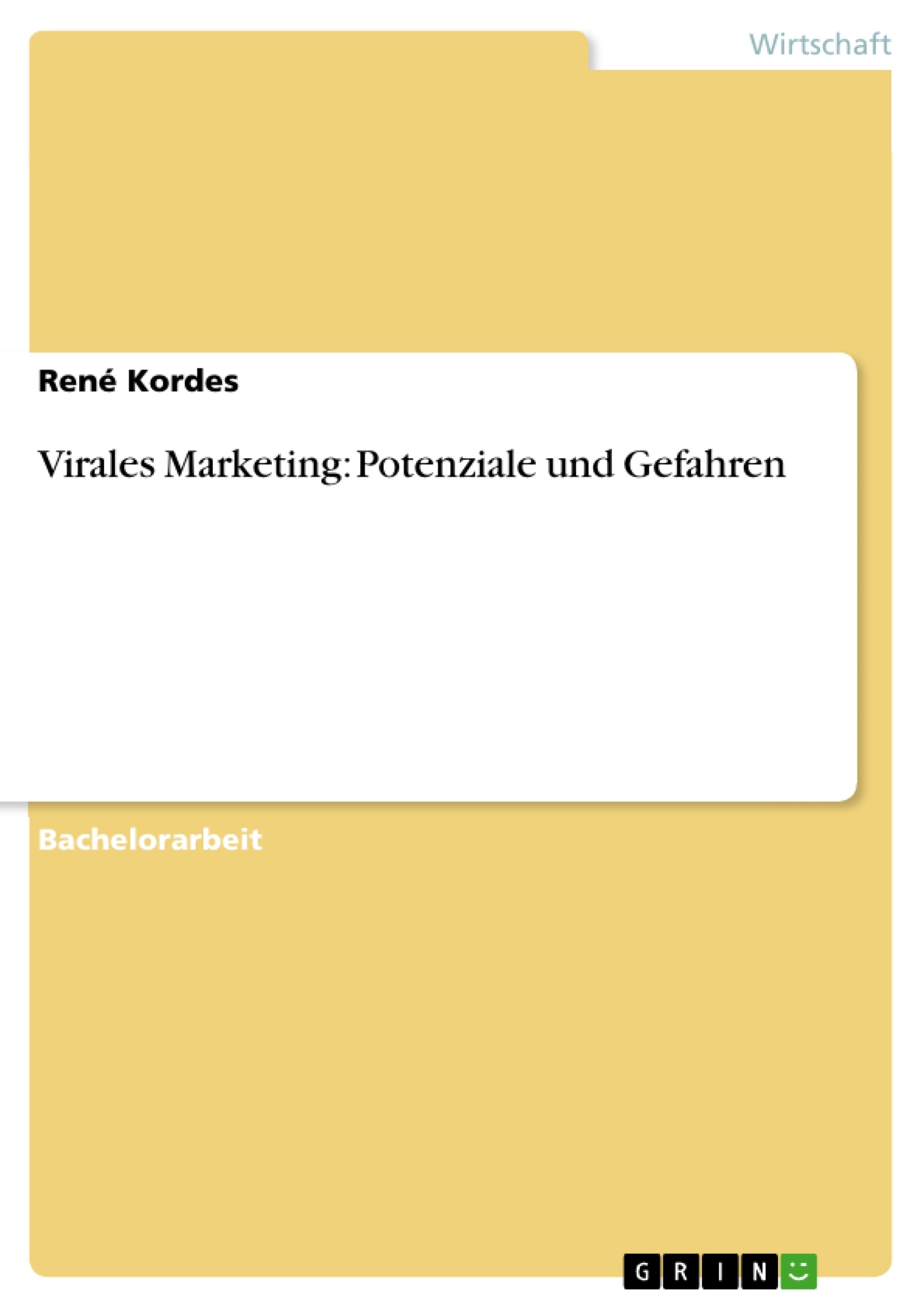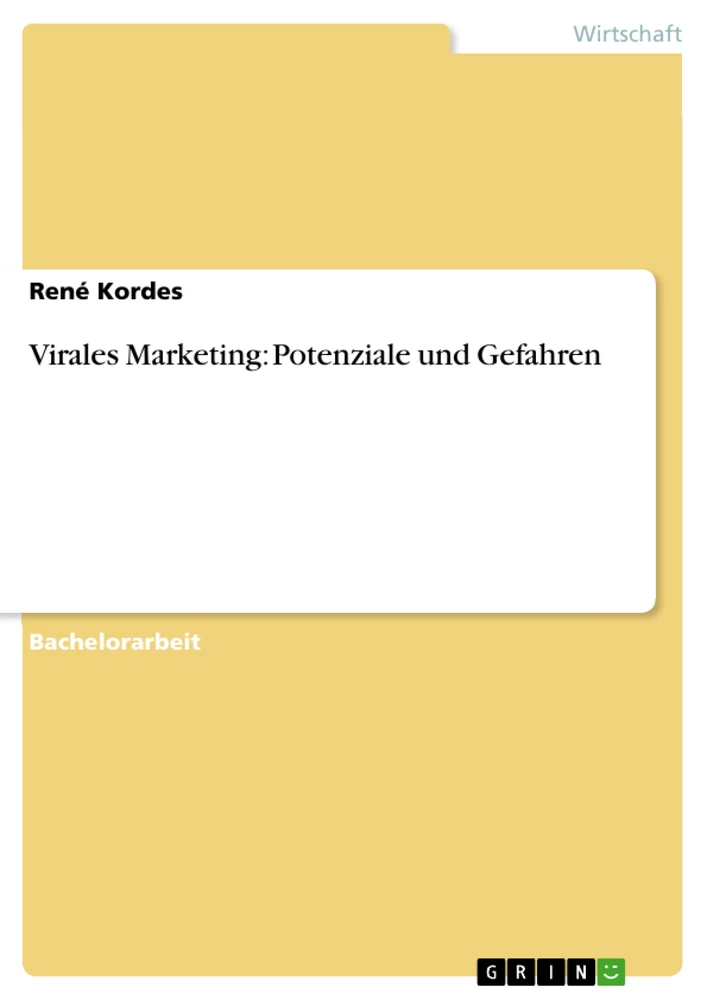
Virales Marketing: Potenziale und Gefahren
Bachelorarbeit, 2012
57 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einführung
1.1 Problemstellung
1.2 Ziel der Arbeit
1.3 Aufbau der Arbeit
2. Grundlagen des viralen Marketings
2. 1 Was ist virales Marketing?
2.1.1 Entstehung des Begriffs
2.1.2 Definition
2.2 Stand der Forschung
2.3 Abgrenzungen von viralem Marketing gegenüber Mundpropaganda
2.4 Ausprägungsformen
2.4.1 Hochintegrative Ansätze
2.4.2 Geringintegrative Ansätze
2.5 Virale Werbung vs. klassische Werbung
2.6 Konzeption und Umsetzung einer viralen Kampagne
2.6.1 Konzeption
2.6.2 Seeding
2.6.3 Erfolgsmessung
3. Entwicklung von Kriterien zur Beurteilung von viralen Kampagnen
3.1 Erfolgspotenziale und Gefahren des viralen Marketings
3.1.1 Erfolgspotenziale
3.1.2 Gefahren
3.2 Kriterien für erfolgreiches virales Marketing
3.2.1 Wahl der ersten Träger
3.2.2 Die Botschaft muss einen viralen Charakter aufweisen
3.2.3 Das Kampagnengut muss einen Nutzen bieten
3.2.4 Technische Aspekte berücksichtigen
3.2.5 Kampagnengut kostenlos bereitstellen
3.2.6 Zusammenfassung
4. Virales Marketing am Beispiel Heineken
4.1 Heinkens „Walk-in-Fridge“-Kampagne
4.1.1 Kurze Darstellung des Unternehmens
4.1.2 Aufbau und Ablauf der Kampagne
4.2 Fallanalyse anhand der aufgestellten Erfolgskriterien
4.2.1 Originaler „Walk-in-Fridge“
4.2.2 „Walk-in-Fridge“-Spoof
4.2.3 „Walk-in-Fridge“-Tournee
4.2.4 „Walking Fridge“
4.2.5 Kampagnenabschluss
4.3 Zusammenfassung
5. Fazit
Literaturverzeichnis
Bücher und Zeitschriftenartikel
Internetquellen
Häufig gestellte Fragen
Was ist virales Marketing?
Virales Marketing ist eine Werbeform, die soziale Netzwerke und Medien nutzt, um eine Botschaft wie ein Virus schnell von Mensch zu Mensch zu verbreiten.
Wie grenzt sich virales Marketing von klassischer Mundpropaganda ab?
Die Arbeit erläutert im Grundlagenkapitel die spezifischen Unterschiede, wobei virales Marketing oft gezielter durch „Seeding“ und digitale Kanäle gesteuert wird.
Was sind die wichtigsten Erfolgskriterien für eine virale Kampagne?
Dazu gehören die Wahl der ersten Träger (Influencer), ein hoher Nutzwert des Inhalts, technisches reibungsloses Teilen und die kostenlose Bereitstellung des Kampagnenguts.
Welches Praxisbeispiel wird in der Arbeit analysiert?
Die Bachelorarbeit nutzt die berühmte „Walk-in-Fridge“-Kampagne von Heineken, um die theoretischen Erfolgskriterien in der Praxis zu prüfen.
Welche Gefahren birgt virales Marketing?
Die Arbeit widmet ein eigenes Unterkapitel den Potenzialen und Gefahren, zu denen unter anderem der Kontrollverlust über die Botschaft oder negative Eigendynamiken gehören können.
Details
- Titel
- Virales Marketing: Potenziale und Gefahren
- Hochschule
- Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (Institut für Ökonomische Bildung)
- Note
- 1,7
- Autor
- René Kordes (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2012
- Seiten
- 57
- Katalognummer
- V204722
- ISBN (eBook)
- 9783656323150
- ISBN (Buch)
- 9783656328186
- Dateigröße
- 837 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Virales Marketing Viral Marketing Potenzial Chancen Risiken Gefahren Heineken Word of Mouth
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 27,99
- Arbeit zitieren
- René Kordes (Autor:in), 2012, Virales Marketing: Potenziale und Gefahren, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/204722
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-