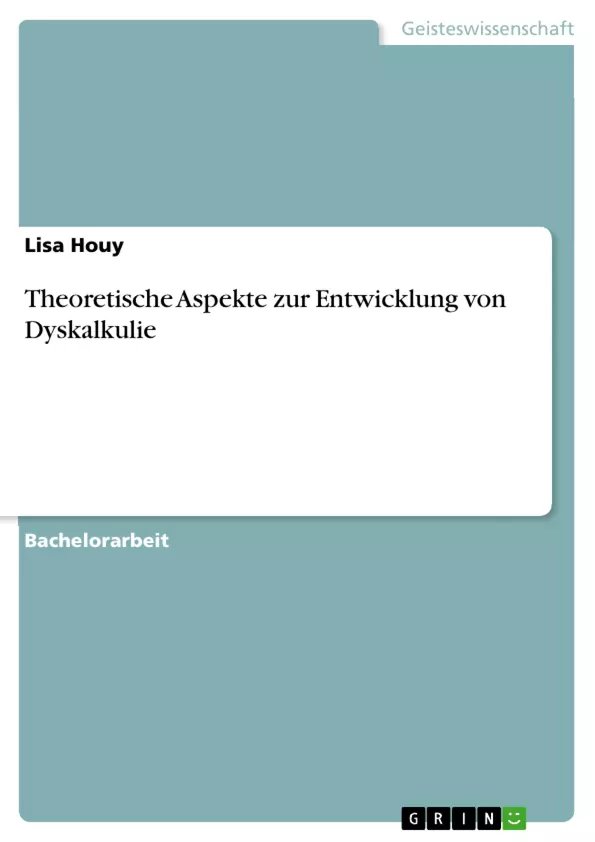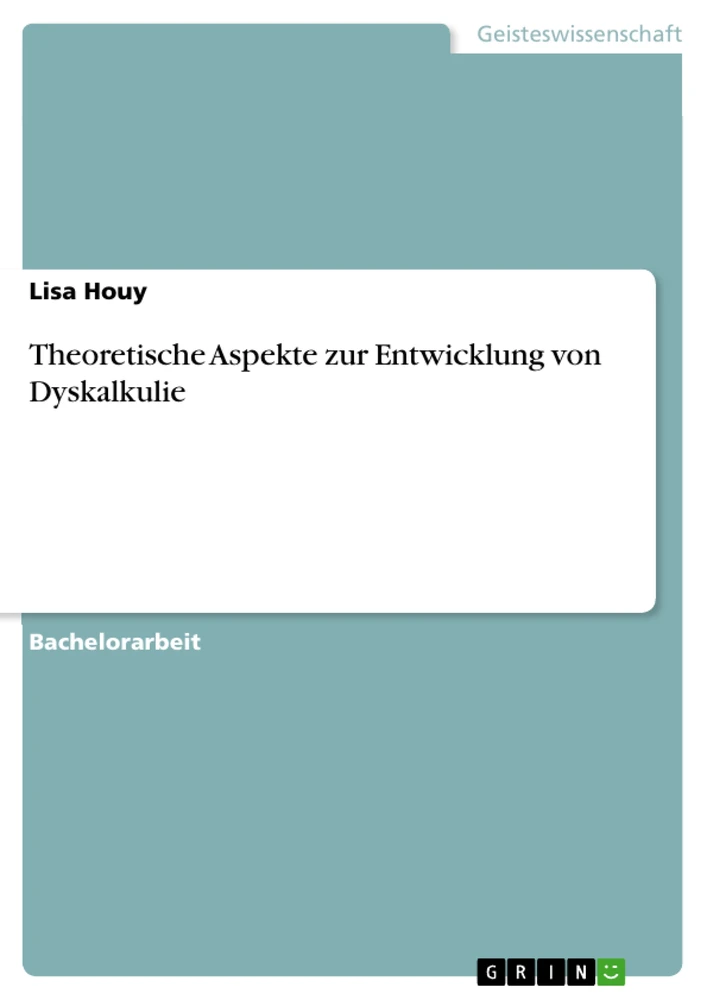
Theoretische Aspekte zur Entwicklung von Dyskalkulie
Bachelorarbeit, 2012
49 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Voraussetzungen mathematischen Denkens
- 2.1 Nicht-kognitive Bedingungen des mathematischen Denkens
- 2.2 Kognitive Anforderungen
- 2.2.1 Gedächtnisleistung
- 2.2.2 Visuelle Wahrnehmung
- 2.2.3 Bedeutung der Sprache
- 2.3 Neurokognitive Sichtweise
- 2.3.1 Numerische Kognition
- 2.3.2 Zahlenverarbeitung
- 2.3.3 Rechenfertigkeiten
- 3 Entwicklung mathematischen Denkens
- 3.1 Wichtige Faktoren der Entwicklung mathematischer Kompetenzen
- 3.2 Entwicklungsmodelle
- 3.2.1 Vier-Stufen-Entwicklungsmodell der Zahlenverarbeitung
- 3.2.2 Entwicklungsmodell früher mathematischer Kompetenzen
- 3.2.3 Modell der mathematischen Kompetenzentwicklung
- 3.3 Mögliche Störungen in der Entwicklung der Rechenleistung
- 4 Störungen und Defizite mathematischen Denkens
- 4.1 Nicht-kognitive Defizite
- 4.2 Kognitive Defizite
- 4.2.1 Defizite in der Gedächtnisleistung
- 4.2.2 Defizite in der visuellen Wahrnehmung
- 4.2.3 Defizite im Sprachverständnis und deren Auswirkungen
- 4.3 Neurokognitive Defizite
- 5 Erklärungsansätze
- 5.1 Dispositionen in der Umwelt der Person
- 5.2 Dispositionen in der Person
- 6 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die theoretischen Aspekte der Entwicklung von Dyskalkulie. Ziel ist es, die basalen Kompetenzen mathematischen Denkens zu beleuchten, mögliche Schwierigkeiten in diesen Fertigkeiten zu identifizieren und die Ursachen einer Beeinträchtigung im Rechnen zu ergründen. Die Arbeit stützt sich auf neurowissenschaftliche Erkenntnisse und entwickelt ein Verständnis für die Entstehung von Dyskalkulie.
- Basale Kompetenzen mathematischen Denkens
- Entwicklung mathematischer Kompetenzen
- Mögliche Störungen in der Entwicklung der Rechenleistung (Dyskalkulie)
- Kognitive und neurokognitive Defizite bei Dyskalkulie
- Erklärungsansätze für Dyskalkulie
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung betont die Bedeutung mathematischer Grundkenntnisse im Alltag und führt in das Thema Dyskalkulie ein. Sie differenziert zwischen erworbener und entwicklungsbedingter Rechenstörung und hebt die Notwendigkeit intensiverer Forschung zur Früherkennung und Förderung hervor. Die Arbeit formuliert zentrale Forschungsfragen, die im weiteren Verlauf beantwortet werden sollen: Auf welchen basalen Kompetenzen baut mathematisches Denken auf? Welche Schwierigkeiten können in diesen fundamentalen Rechenfertigkeiten vorliegen? Worin liegen die Ursachen einer Beeinträchtigung im Rechnen?
2 Voraussetzungen mathematischen Denkens: Dieses Kapitel beschreibt die kognitiven und neurokognitiven Voraussetzungen für mathematisches Denken. Es werden nicht-kognitive Bedingungen, kognitive Anforderungen (Gedächtnisleistung, visuelle Wahrnehmung, Sprache) und die neurokognitive Sichtweise (numerische Kognition, Zahlenverarbeitung, Rechenfertigkeiten) detailliert untersucht. Der Fokus liegt auf den neuesten Forschungsergebnissen aus der Hirnforschung, um ein umfassendes Bild der Grundlagen mathematischen Denkens zu erstellen und die Interdependenzen zwischen den verschiedenen Aspekten aufzuzeigen. Die Ausführungen dienen als Basis für das Verständnis der späteren Kapitel, die sich mit Störungen und Defiziten auseinandersetzen.
3 Entwicklung mathematischen Denkens: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entwicklung mathematischer Kompetenzen. Es werden wichtige Faktoren und verschiedene Entwicklungsmodelle (z.B. das Vier-Stufen-Modell der Zahlenverarbeitung, Modelle früher mathematischer Kompetenzen) vorgestellt und detailliert erläutert. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Darstellung möglicher Störungen in der Entwicklung der Rechenleistung, die als Grundlage für das Verständnis von Dyskalkulie dienen. Der Übergang von den normalen Entwicklungsphasen zu möglichen Störungen wird prägnant dargestellt, um die nachfolgende Diskussion von Defiziten zu kontextualisieren.
4 Störungen und Defizite mathematischen Denkens: Aufbauend auf den vorherigen Kapiteln, analysiert dieses Kapitel die Defizite bei Dyskalkulie aus kognitiver und neurokognitiver Perspektive. Es werden nicht-kognitive, kognitive (Gedächtnisleistung, visuelle Wahrnehmung, Sprachverständnis) und neurokognitive Defizite im Detail beschrieben und mit den entsprechenden Kompetenzen ohne Beeinträchtigung verglichen. Das Kapitel beleuchtet die Vielfalt möglicher Störungen und deren Auswirkungen auf das mathematische Denken. Die Ausführungen verdeutlichen die Komplexität der Problematik und die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtungsweise.
5 Erklärungsansätze: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Erklärungsansätze für Dyskalkulie, indem es zwischen Faktoren innerhalb und außerhalb der betroffenen Person unterscheidet. Die aktuellen Forschungstendenzen werden aufgegriffen, wobei neurologische Ursachen besonders ausführlich erläutert werden. Das Kapitel bietet einen Überblick über die vielschichtigen Ursachen von Dyskalkulie und integriert die Erkenntnisse der vorhergehenden Kapitel in ein umfassenderes Verständnis der Problematik.
Schlüsselwörter
Dyskalkulie, Rechenschwäche, mathematisches Denken, kognitive Entwicklung, neurokognitive Entwicklung, Zahlenverarbeitung, Rechenfertigkeiten, Gedächtnisleistung, visuelle Wahrnehmung, Sprachverständnis, Entwicklungsmodelle, Defizite, Erklärungsansätze.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Entwicklung von Dyskalkulie
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die theoretischen Aspekte der Entwicklung von Dyskalkulie. Sie beleuchtet die basalen Kompetenzen mathematischen Denkens, identifiziert mögliche Schwierigkeiten in diesen Fertigkeiten und ergründet die Ursachen einer Beeinträchtigung im Rechnen. Die Arbeit stützt sich auf neurowissenschaftliche Erkenntnisse und entwickelt ein Verständnis für die Entstehung von Dyskalkulie.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: basale Kompetenzen mathematischen Denkens, Entwicklung mathematischer Kompetenzen, mögliche Störungen in der Entwicklung der Rechenleistung (Dyskalkulie), kognitive und neurokognitive Defizite bei Dyskalkulie und Erklärungsansätze für Dyskalkulie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Voraussetzungen mathematischen Denkens, Entwicklung mathematischen Denkens, Störungen und Defizite mathematischen Denkens, Erklärungsansätze und Zusammenfassung. Jedes Kapitel wird durch eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte begleitet.
Welche Voraussetzungen für mathematisches Denken werden betrachtet?
Kapitel 2 beschreibt die kognitiven und neurokognitiven Voraussetzungen für mathematisches Denken. Es werden nicht-kognitive Bedingungen, kognitive Anforderungen (Gedächtnisleistung, visuelle Wahrnehmung, Sprache) und die neurokognitive Sichtweise (numerische Kognition, Zahlenverarbeitung, Rechenfertigkeiten) detailliert untersucht.
Wie wird die Entwicklung mathematischen Denkens dargestellt?
Kapitel 3 befasst sich mit der Entwicklung mathematischer Kompetenzen. Es werden wichtige Faktoren und verschiedene Entwicklungsmodelle (z.B. das Vier-Stufen-Modell der Zahlenverarbeitung) vorgestellt. Ein Schwerpunkt liegt auf der Darstellung möglicher Störungen in der Entwicklung der Rechenleistung.
Welche Störungen und Defizite bei Dyskalkulie werden analysiert?
Kapitel 4 analysiert Defizite bei Dyskalkulie aus kognitiver und neurokognitiver Perspektive. Es werden nicht-kognitive, kognitive (Gedächtnisleistung, visuelle Wahrnehmung, Sprachverständnis) und neurokognitive Defizite beschrieben und mit den entsprechenden Kompetenzen ohne Beeinträchtigung verglichen.
Welche Erklärungsansätze für Dyskalkulie werden vorgestellt?
Kapitel 5 präsentiert verschiedene Erklärungsansätze für Dyskalkulie, indem es zwischen Faktoren innerhalb und außerhalb der betroffenen Person unterscheidet. Neurologische Ursachen werden besonders ausführlich erläutert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Dyskalkulie, Rechenschwäche, mathematisches Denken, kognitive Entwicklung, neurokognitive Entwicklung, Zahlenverarbeitung, Rechenfertigkeiten, Gedächtnisleistung, visuelle Wahrnehmung, Sprachverständnis, Entwicklungsmodelle, Defizite, Erklärungsansätze.
Welche Forschungsfragen werden in der Arbeit beantwortet?
Die Arbeit beantwortet folgende zentrale Forschungsfragen: Auf welchen basalen Kompetenzen baut mathematisches Denken auf? Welche Schwierigkeiten können in diesen fundamentalen Rechenfertigkeiten vorliegen? Worin liegen die Ursachen einer Beeinträchtigung im Rechnen?
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die basalen Kompetenzen mathematischen Denkens zu beleuchten, mögliche Schwierigkeiten in diesen Fertigkeiten zu identifizieren und die Ursachen einer Beeinträchtigung im Rechnen zu ergründen.
Details
- Titel
- Theoretische Aspekte zur Entwicklung von Dyskalkulie
- Hochschule
- Universität Koblenz-Landau (Institut für Mathematik)
- Note
- 1,0
- Autor
- Lisa Houy (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2012
- Seiten
- 49
- Katalognummer
- V205083
- ISBN (eBook)
- 9783656315186
- ISBN (Buch)
- 9783656316824
- Dateigröße
- 2034 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Schlagworte
- Rechenschwäche Rechenstörung Ursachen Dyskalkulie
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 28,99
- Arbeit zitieren
- Lisa Houy (Autor:in), 2012, Theoretische Aspekte zur Entwicklung von Dyskalkulie, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/205083
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-