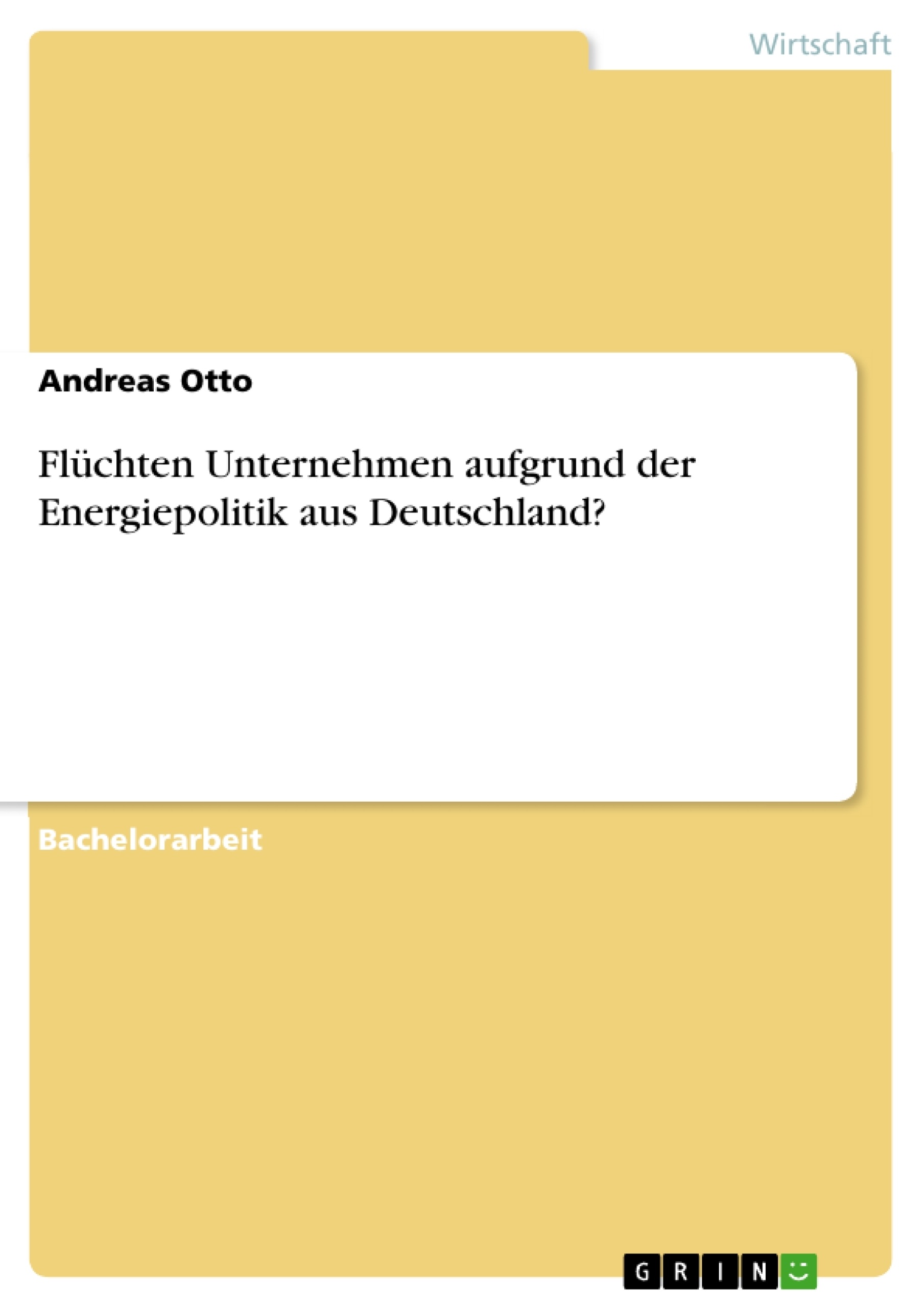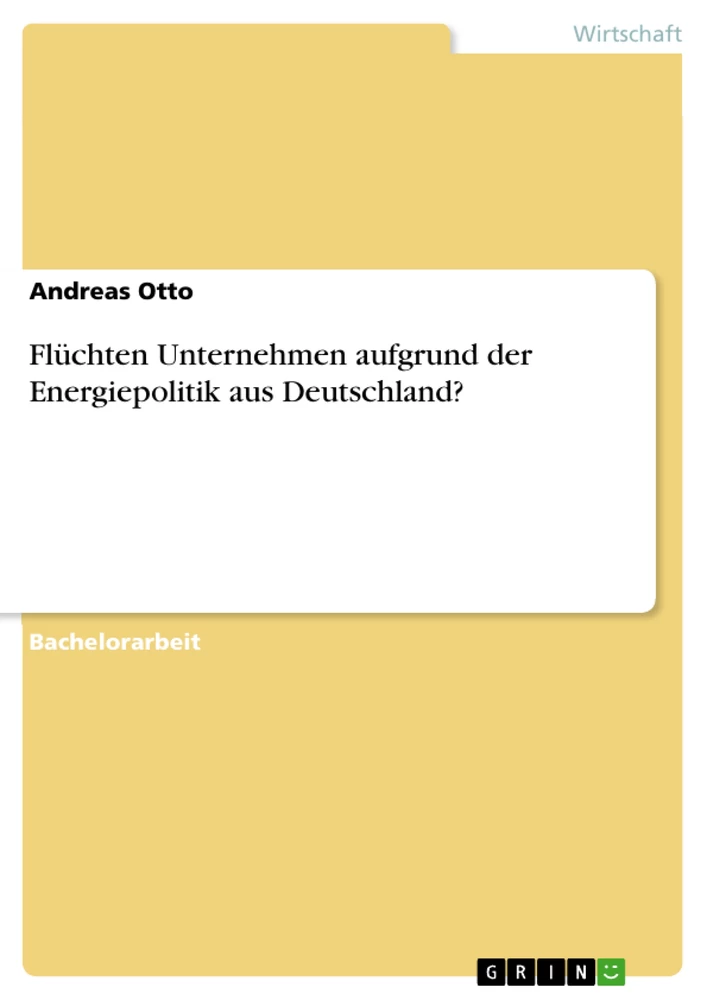
Flüchten Unternehmen aufgrund der Energiepolitik aus Deutschland?
Bachelorarbeit, 2012
41 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Energiepolitik der Bundesregierung
2.1 Einbindung in die europäische Energiepolitik
2.2 Energiekonzept der Bundesregierung
2.3 Die Handlungsfelder im Einzelnen
3 Energiemarkt in Deutschland
3.1 Besonderheiten beiderPreisbildung
3.2 Einfluss des EEG auf die Energiepreise
3.3 Energiepreise im europäischen Vergleich
3.4 Prognostizierte EntwicklungderEnergiekosten
4 Energiekosten der Industrie in Deutschland
4.1 Anteil der Energiekosten an den Gesamtkosten
4.2 Einsparungspotentiale beidenEnergiekosten
5 Indikatorenfür eine AbwanderungvonUnternehmen
5.1 Daten deramtlichenStatistik
5.2 Beurteilung des WirtschaftsstandortsDeutschland
6 Fazit
Anhang
Literaturverzeichnis
Details
- Titel
- Flüchten Unternehmen aufgrund der Energiepolitik aus Deutschland?
- Hochschule
- Humboldt-Universität zu Berlin (Universität)
- Veranstaltung
- Bachelorabschluss
- Note
- 1,3
- Autor
- Andreas Otto (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2012
- Seiten
- 41
- Katalognummer
- V205314
- ISBN (eBook)
- 9783656330318
- ISBN (Buch)
- 9783656331445
- Dateigröße
- 1319 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Energiepolitik Kostenrechnung Unternehmensstrategie Wirtschaftspolitik
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 30,99
- Arbeit zitieren
- Andreas Otto (Autor:in), 2012, Flüchten Unternehmen aufgrund der Energiepolitik aus Deutschland?, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/205314
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-