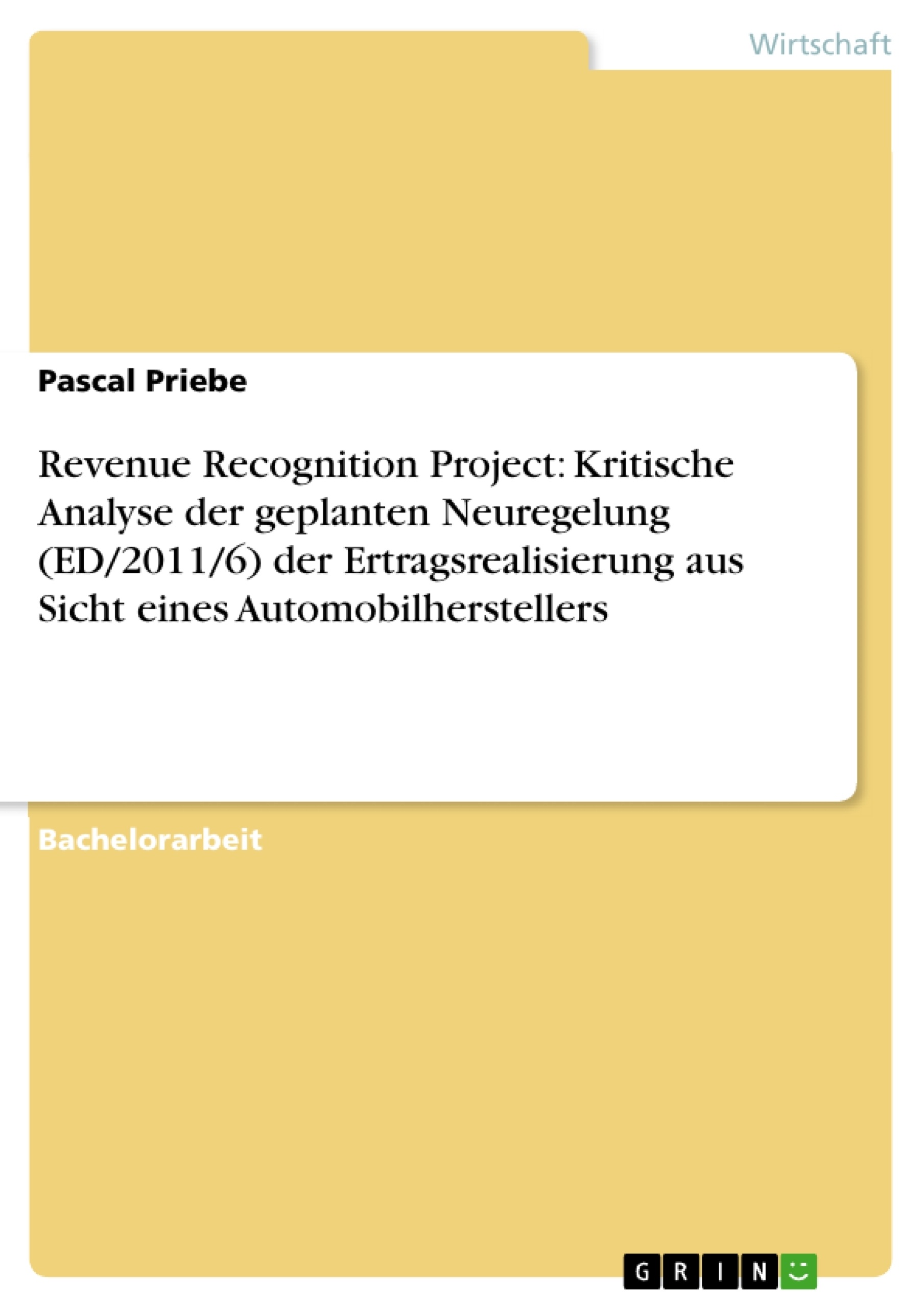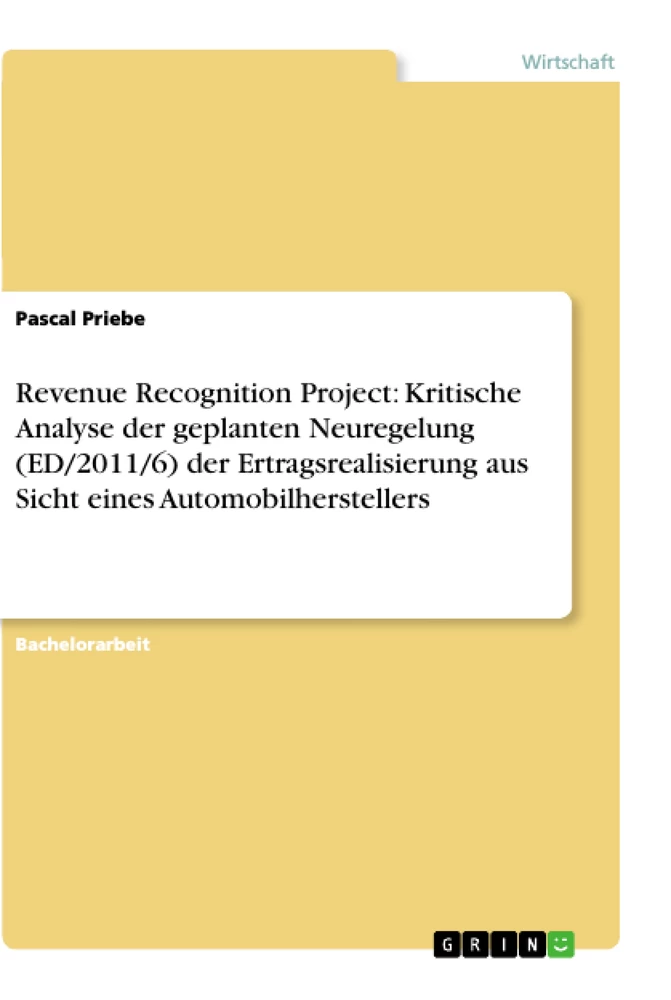
Revenue Recognition Project: Kritische Analyse der geplanten Neuregelung (ED/2011/6) der Ertragsrealisierung aus Sicht eines Automobilherstellers
Bachelorarbeit, 2012
59 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung der Arbeit
- 2 Bisherige Regelungen der Umsatzrealisation nach IAS 18
- 2.1 Anwendungsbereich und Abgrenzung
- 2.2 Erlöserfassung aus dem Verkauf von Gütern / Fahrzeugen
- 2.3 Erlöserfassung bei Dienstleistungen
- 2.4 Behandlung von Mehrkomponentengeschäften
- 3 Geplante Regelung zur Umsatzrealisation nach dem Standardentwurf ED/2011/6
- 3.1 Grundkonzeption des neuen Modells
- 3.2 Identifizierung des Vertrags mit dem Kunden
- 3.3 Identifizierung der separaten Leistungsverpflichtungen
- 3.4 Bestimmung des Transaktionspreises
- 3.4.1 Berücksichtigung von variablen Bestandteilen des Transaktionspreises
- 3.4.2 Berücksichtigung des Zeitwerts des Geldes
- 3.5 Aufteilung des Transaktionspreises auf separate Leistungsverpflichtungen
- 3.6 Erfüllung der Leistungsverpflichtung
- 3.6.1 Zeitraumbezogene oder zeitpunktbezogene Leistungserfüllung
- 3.6.2 Bestimmung des Leistungsfortschritts
- 4 Kritische Würdigung der wesentlichen Änderungen eines Automobilherstellers
- 4.1 Vergleich der bisherigen und geplanten Regelung
- 4.1.1 Garantien und Gewährleistungen bei Mehrkomponentenverträgen
- 4.1.2 Lizenzentgelte
- 4.1.3 Behandlung von Sale-and-Buy-Back Verträgen
- 4.1.4 Erweiterte Anhangangaben
- 4.2 Kritische Würdigung der wesentlichen Änderungen
- 5 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit analysiert kritisch die geplanten Änderungen des Standardentwurfs „Revenue from Contracts with Customers“ (ED/2011/6) aus der Perspektive eines Automobilherstellers. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen der neuen Regelungen auf die Umsatzrealisation und beleuchtet die Herausforderungen, die sich daraus für die Bilanzierungspraxis ergeben.
- Vergleich der bisherigen und geplanten Regelungen zur Umsatzrealisation nach IAS 18 und ED/2011/6
- Analyse der Auswirkungen der neuen Regelungen auf die Bilanzierung von Mehrkomponentengeschäften im Automobilsektor
- Bewertung der Behandlung von Garantien, Gewährleistungen und Sale-and-Buy-Back-Verträgen unter den neuen Vorschriften
- Diskussion der Herausforderungen bei der Umsetzung der neuen Regelungen in der Praxis
- Kritische Würdigung der vorgeschlagenen Änderungen aus Sicht eines Automobilherstellers
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Problemstellung ein und beschreibt die Zielsetzung der Arbeit. Sie hebt die Diskrepanzen zwischen bestehenden IAS- und US-GAAP-Regelungen hervor, insbesondere im Kontext der Umsatzrealisierung bei Mehrkomponentengeschäften im Automobilsektor. Die Arbeit fokussiert sich auf die kritische Analyse des Standardentwurfs ED/2011/6 und dessen Auswirkungen auf die Bilanzierungspraxis von Automobilherstellern. Die Bedeutung einer konsistenten und branchenübergreifenden Ertragsvereinnahmungsmodell wird betont.
2 Bisherige Regelungen der Umsatzrealisation nach IAS 18: Dieses Kapitel beschreibt die bestehenden Regelungen zur Umsatzrealisation nach IAS 18, einschließlich des Anwendungsbereichs, der Erlöserfassung bei Waren- und Dienstleistungsverkäufen sowie der Behandlung von Mehrkomponentengeschäften. Es werden die Schwächen und Unsicherheiten des bestehenden Systems im Hinblick auf die Bilanzierung komplexer Transaktionen im Automobilsektor aufgezeigt, wodurch der Bedarf an einer Reform deutlich wird. Der Fokus liegt auf der unzureichenden Regelung von After-Sales-Leistungen, was zu unterschiedlichen Bilanzierungsmethoden und damit zu Inkonsistenzen führt.
3 Geplante Regelung zur Umsatzrealisation nach dem Standardentwurf ED/2011/6: Das Kapitel erläutert die Grundkonzeption des neuen Modells im ED/2011/6, das auf die im Kundenvertrag enthaltenen Rechte und Pflichten basiert. Die einzelnen Schritte der Umsatzrealisierung – Identifizierung des Vertrags, der separaten Leistungsverpflichtungen, Bestimmung des Transaktionspreises und dessen Aufteilung, sowie die Erfüllung der Leistungsverpflichtungen – werden detailliert beschrieben. Der Schwerpunkt liegt auf der komplexen Zuordnung von Erlösen zu einzelnen Leistungsverpflichtungen und der Behandlung variabler Bestandteile des Transaktionspreises.
4 Kritische Würdigung der wesentlichen Änderungen eines Automobilherstellers: Dieses Kapitel vergleicht die bisherigen und geplanten Regelungen und analysiert die Auswirkungen der Änderungen auf die Bilanzierungspraxis eines Automobilherstellers. Besonderes Augenmerk wird auf die Behandlung von Garantien, Gewährleistungen, Lizenzentgelten und Sale-and-Buy-Back-Verträgen gelegt. Die Kapitel diskutiert die Herausforderungen bei der Umsetzung der neuen Regelungen und bewertet die Vor- und Nachteile des neuen Modells für den Automobilsektor. Es wird eine kritische Würdigung der wesentlichen Änderungen aus Sicht eines Automobilherstellers gegeben.
Schlüsselwörter
IAS 18, ED/2011/6, Umsatzrealisation, Mehrkomponentengeschäfte, Automobilhersteller, Garantien, Gewährleistungen, Lizenzentgelte, Sale-and-Buy-Back-Verträge, Bilanzierung, IFRS, US-GAAP.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Analyse der geplanten Änderungen der Umsatzrealisation nach ED/2011/6 für Automobilhersteller
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Diese Bachelorarbeit analysiert kritisch die geplanten Änderungen des Standardentwurfs „Revenue from Contracts with Customers“ (ED/2011/6) aus der Perspektive eines Automobilherstellers. Sie untersucht die Auswirkungen der neuen Regelungen auf die Umsatzrealisation und die Herausforderungen für die Bilanzierungspraxis.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit vergleicht die bisherigen und geplanten Regelungen zur Umsatzrealisation nach IAS 18 und ED/2011/6. Sie analysiert die Auswirkungen der neuen Regelungen auf die Bilanzierung von Mehrkomponentengeschäften im Automobilsektor, bewertet die Behandlung von Garantien, Gewährleistungen und Sale-and-Buy-Back-Verträgen und diskutiert die Herausforderungen bei der praktischen Umsetzung. Ein Schwerpunkt liegt auf der kritischen Würdigung der vorgeschlagenen Änderungen aus Sicht eines Automobilherstellers.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung mit Problemstellung und Zielsetzung, ein Kapitel zu den bisherigen Regelungen nach IAS 18, ein Kapitel zu den geplanten Regelungen nach ED/2011/6, ein Kapitel mit kritischer Würdigung der Änderungen für Automobilhersteller und abschließend eine Zusammenfassung.
Wie werden die bisherigen Regelungen nach IAS 18 dargestellt?
Kapitel 2 beschreibt die bestehenden Regelungen zur Umsatzrealisation nach IAS 18, inklusive Anwendungsbereich, Erlöserfassung bei Waren- und Dienstleistungen sowie die Behandlung von Mehrkomponentengeschäften. Es werden Schwächen und Unsicherheiten des Systems im Automobilsektor aufgezeigt, insbesondere die unzureichende Regelung von After-Sales-Leistungen.
Was sind die Kernpunkte des Standardentwurfs ED/2011/6?
Kapitel 3 erläutert die Grundkonzeption des neuen Modells in ED/2011/6, das auf den Rechten und Pflichten im Kundenvertrag basiert. Es beschreibt detailliert die Schritte der Umsatzrealisierung: Identifizierung des Vertrags, der separaten Leistungsverpflichtungen, Bestimmung und Aufteilung des Transaktionspreises sowie die Erfüllung der Leistungsverpflichtungen. Schwerpunkt ist die Zuordnung von Erlösen zu einzelnen Leistungsverpflichtungen und die Behandlung variabler Preisbestandteile.
Wie werden die Auswirkungen auf Automobilhersteller bewertet?
Kapitel 4 vergleicht die alten und neuen Regelungen und analysiert deren Auswirkungen auf die Bilanzierungspraxis von Automobilherstellern. Es befasst sich speziell mit Garantien, Gewährleistungen, Lizenzentgelten und Sale-and-Buy-Back-Verträgen. Die Herausforderungen bei der Umsetzung und die Vor- und Nachteile des neuen Modells für den Automobilsektor werden diskutiert. Eine kritische Würdigung aus der Perspektive des Automobilherstellers wird gegeben.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind IAS 18, ED/2011/6, Umsatzrealisation, Mehrkomponentengeschäfte, Automobilhersteller, Garantien, Gewährleistungen, Lizenzentgelte, Sale-and-Buy-Back-Verträge, Bilanzierung, IFRS, US-GAAP.
Wo finde ich weitere Informationen?
Die vollständige Bachelorarbeit enthält eine detaillierte Analyse der beschriebenen Themen. (Hinweis: Hier könnte ein Link zur vollständigen Arbeit eingefügt werden, falls verfügbar.)
Details
- Titel
- Revenue Recognition Project: Kritische Analyse der geplanten Neuregelung (ED/2011/6) der Ertragsrealisierung aus Sicht eines Automobilherstellers
- Hochschule
- Hochschule Bremen (Wirtschaftswissenschaften)
- Note
- 1,7
- Autor
- Pascal Priebe (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2012
- Seiten
- 59
- Katalognummer
- V205913
- ISBN (eBook)
- 9783656354574
- ISBN (Buch)
- 9783656355076
- Dateigröße
- 976 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- kritische analyse änderungen standardentwurfs revenue contracts customers ed/2011/6 sicht automobilherstellers
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 15,99
- Preis (Book)
- US$ 25,99
- Arbeit zitieren
- Pascal Priebe (Autor:in), 2012, Revenue Recognition Project: Kritische Analyse der geplanten Neuregelung (ED/2011/6) der Ertragsrealisierung aus Sicht eines Automobilherstellers, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/205913
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-