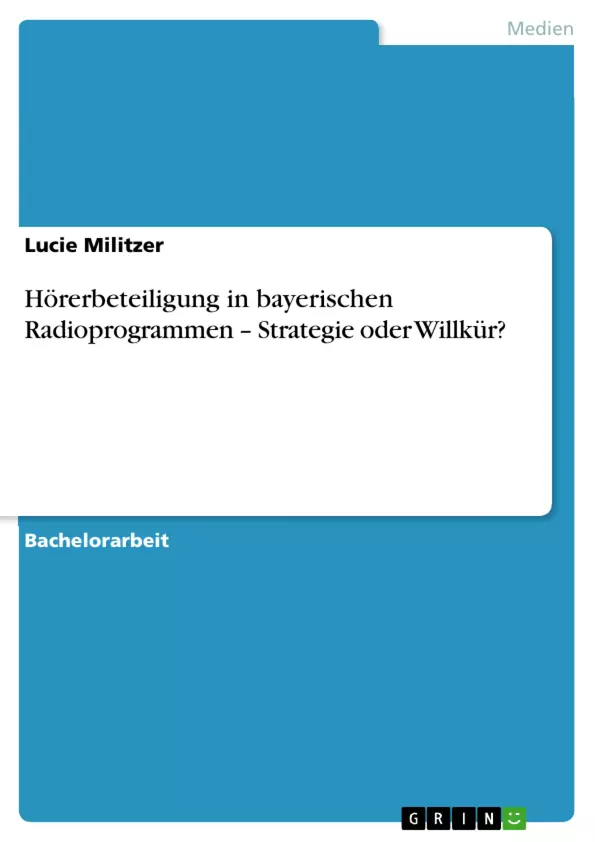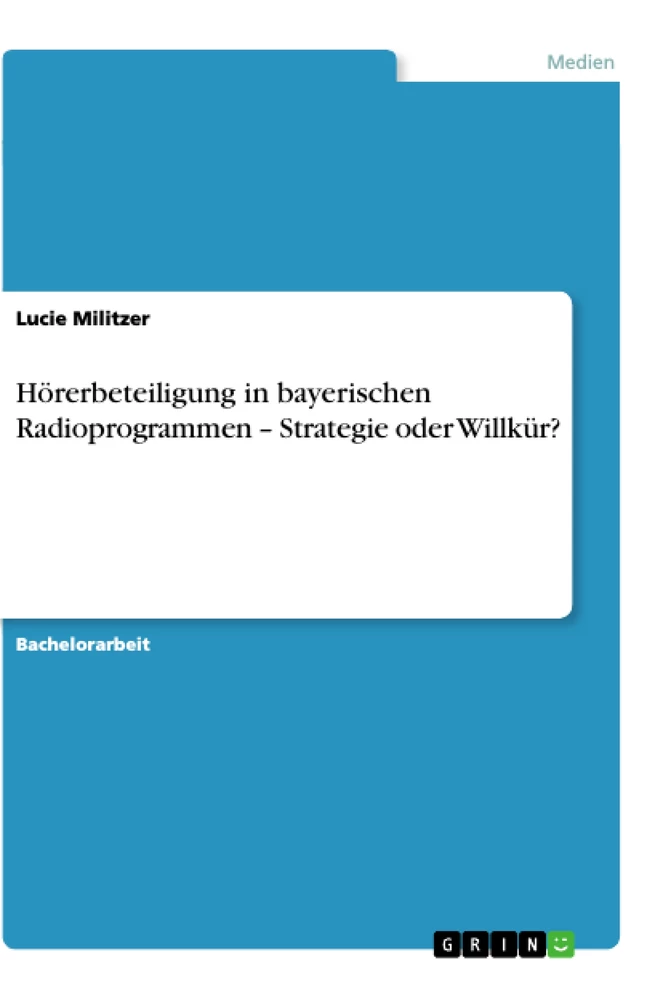
Hörerbeteiligung in bayerischen Radioprogrammen – Strategie oder Willkür?
Bachelorarbeit, 2012
118 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Anlagenverzeichnis
1 Einführung
2 Theoretische Grundlagen
2.1 Geschichte der Hörerbeteiligung
2.2 Arten der Hörerbeteiligung
2.2.1 Technische Unterscheidung
2.2.1.1 Telefongespräche
2.2.1.2 Straßenbefragungen
2.2.1.3 Beteiligung via Internet und Post
2.2.2 Thematische Unterscheidung
2.2.2.1 (Gewinn-)Spiele und Quizsendungen
2.2.2.2 Wunschsendungen und Grüße
2.2.2.3 Meinungsäußerungen und Diskussionen
2.2.2.4 Beratungen
2.2.2.5 Hörer als Werbeträger
2.2.3 Sonstige Beteiligungsformen
2.3 ZielederHörerbeteiligung
2.4 Themenauswahl für Hörerbeteiligung
2.5 Risiken der Hörerbeteiligung
2.6 Ausgewählte Beispiele von Hörerbeteiligungssendungen
2.6.1 Hallo Ü-Wagen
2.6.2 Domian
2.7 Überblick über Forschungsergebnisse zur Hörerbeteiligung in bayerischen Programmen
2.7.1 BLM-Studie 1989
2.7.2 BLM-Studie 1990
2.8 Forschungsfrage und Untersuchungsinhalt
3 Methoden der Analyse
3.1 Analyse von fünf bayerischen Radiosendern im Raum Bamberg
3.1.1 Antenne Bayern
3.1.2 Bayern 1
3.1.3 Bayern 3
3.1.4 Radio Bamberg
3.1.5 Radio Galaxy Bamberg/Coburg
3.2 Inhaltsanalyse der verschiedenen Radioprogramme
3.2.1 Stichprobe
3.2.2 Codierung
3.2.3 Sonstige Analyseregeln
3.2.4 Pretest
3.3 Qualitative Experteninterviews
3.3.1 Vorgefertigter Gesprächsleitfaden
3.3.2 Interview-Regeln
4 Auswertung und Erkenntnisse
4.1 Hörerbeteiligung bei Antenne Bayern
4.2 Hörerbeteiligung bei Bayern 1
4.2.1 Ergebnisse der Inhaltsanalyse
4.2.2 Ergebnisse des Experteninterviews
4.3 Hörerbeteiligung bei Bayern 3
4.3.1 Ergebnisse der Inhaltsanalyse
4.3.2 Ergebnisse des Experteninterviews
4.4 Hörerbeteiligung bei Radio Bamberg
4.4.1 Ergebnisse der Inhaltsanalyse
4.4.2 Ergebnisse des Experteninterviews
4.5 Hörerbeteiligung bei Radio Galaxy Bamberg/Coburg
4.5.1 Ergebnisse der Inhaltsanalyse
4.5.2 Ergebnisse der Experteninterviews
4.5.2.1 Mantelprogramm
4.5.2.2 Lokalstudio Bamberg
5 Ergebnisund Fazit
5.1 Hörerbeteiligung - Strategie oder Willkür?
5.2 Ausblick
Literaturverzeichnis
Anlagen
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Häufigkeit der Hörerbeteiligung im Tagesverlauf, Antenne Bayern
Abbildung 2: Verteilung der direkten und indirekten Hörerbeteiligung, Antenne Bayern
Abbildung 3: Häufigkeitsverteilung der Beteiligungstechniken, Antenne Bayern
Abbildung 4: Häufigkeit der Hörerbeteiligung im Tagesverlauf, Bayern 1
Abbildung 5: Verteilung der direkten und indirekten Hörerbeteiligung, Bayern 1
Abbildung 6: Häufigkeitsverteilung der Beteiligungstechniken, Bayern 1
Abbildung 7: Häufigkeit der Hörerbeteiligung im Tagesverlauf, Bayern 3
Abbildung 8: Verteilung der direkten und indirekten Hörerbeteiligung, Bayern 3
Abbildung 9: Häufigkeitsverteilung der Beteiligungstechniken, Bayern 3
Abbildung 10: Häufigkeit der Hörerbeteiligung im Tagesverlauf, Radio Bamberg
Abbildung 11: Verteilung der direkten und indirekten Hörerbeteiligung, Radio Bamberg
Abbildung 12: Häufigkeitsverteilung der Beteiligungstechniken, Radio Bamberg
Abbildung 13: Häufigkeit der Hörerbeteiligung im Tagesverlauf, Radio Galaxy Bamberg/Coburg
Abbildung 14: Verteilung der direkten und indirekten Hörerbeteiligung, Radio Galaxy Bamberg/Coburg
Abbildung 15: Häufigkeitsverteilung der Beteiligungstechniken, Radio Galaxy Bamberg/Coburg
Abbildung 16: Ziele von Hörerbeteiligung, Häufigkeitsverteilung dergenannten Antworten
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Hörerbeteiligung in bayerischen landesweiten Programmen 1989
Tabelle 2: Absolute und prozentuale Hörerbeteiligung in den analysierten bayerischen Programmen
Anlagenverzeichnis
Anlage 1: Codesheets zurAuswertung von Antenne Bayern
Anlage 2: Codesheets zurAuswertung von Bayern 1
Anlage 3: Codesheets zur Auswertung von Bayern 3
Anlage 4: Codesheets zur Auswertung von Radio Bamberg
Anlage 5: Codesheets zur Auswertung von Radio Galaxy Bamberg/Coburg
Anlage 6: Transkription des Interviews mit Bernd Diestel (stellvertretender Redaktionsleiter, Bayern 1)
Anlage 7: Transkription des Interviews mit Ulli Wenger (Chef vom Dienst, Bayern 3)
Anlage 8: Transkription des Interviews mit Marcus Appel (Leitender Redakteur, Radio Bamberg)
Anlage 9: Transkription des Interviews mit Detlef Kapfinger (On Air Director, Radio Galaxy Bayern)
Anlage 10: Schriftliches Interview mit Florian Wein (Moderator "U - die interaktive Nachmittagsshow", Radio Galaxy Bayern)
Anlage 11: Transkription des Interviews mit Max Lotter (Programmleiter, Radio Galaxy Bamberg/Coburg)
1 Einführung
„Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler“ - ein Sprichwort, das für den Angler und den Fisch ebenso gilt wie für Radiomacher und Hörer. Radio machen die Programmverantwortlichen nicht nur für Werbekunden - auch, wenn diese gerade bei Privatsendern ein großer finanzieller Stellenwert für die Sender sind - oder sich selbst, sondern eigentlich hauptsächlich für ihre (potentiellen) Hörer, ihre Zielgruppe. Das ist der Fisch, den man sich als Radiomacher angeln möchte und von dem der Erfolg des Radiosenders abhängt. Das Programm - der Köder - sollte bestmöglich auf die Wünsche der Zielgruppe abgestimmt sein und ihren Bedürfnissen entsprechen. Liegt es nicht eigentlich auf der Hand, die Hörer direkt am Programm zu beteiligen? In der Natur kann sich der Fisch dem Angler gegenüber nicht darüber äußern, welcher Köder ihm am besten schmeckt - die Hörer können sich dagegen schon bei den Programmverantwortlichen bemerkbar machen. Und wenn sie sich schon melden und ihre Wünsche anbringen können, warum sollten sie dann nicht gleich das Programm - oder zumindest einen Teil davon - mitbestimmen und sich daran beteiligen? Diese Vision hatte Bertolt BRECHT schon im Jahr 1932:
„Der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsappa- rat zu verwandeln. Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikati- onsapparat des öffentlichen Lebens, ein ungeheures Kanalsystem, das heißt, er wäre es, wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu emp- fangen, also den Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn in Beziehung zu setzen.“
Inwiefern trifft BRECHTs Vorstellung von damals - die Hörer „auf die Antenne“ zu nehmen und als einen Bestandteil des Programms anzusehen - auf die Radio-Realität von heute zu? Welche Rolle spielt Hörerbeteiligung für die Radiomacher und ihre Programme? In welcher Form und welchem Ausmaß werden Hörer an Radioprogrammen beteiligt und warum entscheiden sich Programmverantwortliche dafür, Hörer einzubinden? Welche Ziele werden mit Hörerbeteiligung verfolgt? Diese Fragen werden in der vorliegenden Arbeit für fünf bayerische Radiosender beantwortet. Dafür werden jeweils 24 Stunden der Programme als Stichprobe analysiert. Die Untersuchung erfolgt in einem ersten Schritt mit einer Inhaltsanalyse der Programme und in einem zweiten Schritt mit Interviews mit Programmverantwortlichen dieser Sender. Zuvor wird unter anderem auf die Geschichte der Hörerbeteiligung in Deutschland, auf die verschiede- nen Arten der Hörerbeteiligung, ihren Sinn und ihre Risiken eingegangen. Außerdem werden zwei aufgrund ihrer Bekanntheit herausragende Beispiele für Hörerbeteiligungssendungen aufgeführt und bisherige Forschungsergebnisse zur Hörerbeteiligung in bayerischen Radioprogrammen dargestellt.
Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt auf der Sicht der Programmverantwortlichen. Es werden nicht die Sicht der Hörer zu Hörerbeteiligung oder die Motivation, die Hörer überhaupt haben, sich zu beteiligen, untersucht. Vielmehr steht der Stellenwert der Hörerbeteiligung für die Programmverantwortlichen im Mittelpunkt und ob, wenn Hörer im Programm beteiligt werden, diese Form von Wortbeiträgen zur Philosophie und Strategie des Senders gehört oder rein willkürlich, zufällig platziert wird.
2 Theoretische Grundlagen
ln den folgenden Kapiteln wird sich dem Begriff Hörerbeteiligung theoretisch angenähert. Dabei wird auf die Rundfunkgeschichte ab 1945, besonders auf die Entwicklungen im West-Sektor Deutschlands, eingegangen, da sich die zu analysierenden Sender in Bayern und damit im ehemals von amerikanischen Siegermächten besetzten Gebiet befinden.
2.1 Geschichte der Hörerbeteiligung
Die Rollenverteilung von Sendeanstalt und Hörer waren zu Beginn des Rundfunks seit der ersten Sendestunde im Oktober 1923 laut TROESSER klar geregelt: die Hörer zahlten und wurden im Gegenzug von Sendungen unterhalten und gebildet. Die Hörer waren geradezu ohnmächtig gegenüber der Macht des Rundfunks und versuchten vergeblich Vorschläge, ihre Interessen bezüglich des Rundfunks zu berücksichtigen, durchzusetzen. TROESSER nennt das Beispiel des „Arbeiter Radio Clubs“ von 1924, einer Vereinigung, die - ohne Erfolg - „einen eigenen Arbeitersender forderte, die Herabsetzung der Gebühren und Mitbestimmung bei den Programmen“.[2]
„Tatsächlich war der Rundfunk anfangs nicht mehr als die lediglich auf das Akus- tische reduzierte (Fern-)Vermittlung von Musikaufführungen, Rezitationen, Thea- tervorführungen und ähnlichen Ereignissen, die eben den Vorteil hatte, dass sie dem Zuhörer die Anwesenheit am Ort des Geschehens ersparte. ‘[3]
Dennoch werden Hörer in den Hörfunk-Anfangsjahren, wenn auch selten, ins Programm eingebunden: so beschreibt ORIANS eine Aktion eines WERAG[4] -Sportreporters, der 13.000 Zuschriften erhielt, nachdem er seine Hörer dazu aufgefordert hat, ihre Meinungen zu einer Fußballübertragung zu äußern. Vom gleichen Reporter ist laut ORIANS auch die erste Beteiligung von Hörern über Telefon bekannt.[5]
Mit der Machtübertragung an die Nationalsozialisten 1933 wurde Hörerbeteiligung in Radioprogrammen so gut wie unmöglich. Laut TROESSER wurden die Hörer zu „einer manipulierbaren Masse gemacht, jede Form aktiver oder kritischer Mitbeteiligung wurde undenkbarer als je zuvor“[6]. Wenn es doch Beteiligungsformen gab, dann dienten sie laut ORIANS „vor allem der Effektivitätskontrolle“. Er führt beispielsweise eine Sendung mit dem Namen „Volk sendet für Volk“ an, die trotz ihres Titels nicht demokratisieren, sondern die Wirkung des Hörfunks auf die Hörer ausspionieren sollte.[7]
Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde der Hörfunk in Deutschland neu geordnet. Ab 1949 wurde auf die Wünsche der Hörer durch spezielle Zielgruppenprogramme eingegangen; HALEFELDT nennt hier z.B. Sendungen für Schüler, Landwirte oder Frauen zu unterschiedlichen Tageszeiten.[8] Erste Beteiligungsformate entwickelten sich; eine Vorreiterrolle hatten Wunschsendungen für Hörer, die es laut der ARD/ZDFARBEITSGRUPPE MARKETING seit 1949 gibt.[9] Auch Quizsendungen fanden zu dieser Zeit langsam ihren Weg in die Programme der Radiosender.[10] Allerdings wurde seitens der Programmmacher bezweifelt, ob die Beteiligung des Hörers Programme tatsächlich bereichert.[11]
Einen Aufschwung erlebten Beteiligungsformate Ende der 60er Jahre bzw. in den 70er Jahren. Im Zuge der Studentenproteste in Deutschland kam auch Bewegung in die Programme der Radiosender: Die Studenten lehnten sich gegen den öffentlichrechtlichen Rundfunk auf, der aus ihrer Sicht ein „Herrschaftsinstrument mit manipulativem Charakter“[12] war. Die Hörer als Gebührenzahler sollten am Programm beteiligt werden.[13] Das wurde in den 70er Jahren beispielsweise von Freien Radios verwirklicht, an deren Programm „sich jeder beteiligen kann“.[14] Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk reagierte und führte vermehrt Sendungen mit Hörerbeteiligung, die über Wunsch- und Quizsendungen hinausging, ein.[15] Ein Beispiel ist Hallo Ü-Wagen, eine Sendung, die im Kapitel 2.6.1 ausführlich vorgestellt wird. Laut ORIANS haben sich die Möglichkeiten zur Hörerbeteiligung seit den 70er Jahren „permanent vermehrt“.[16]
„Low-power Stationen zum Mitmachen für (fast) jedermann sind in unmittelbare Nähe gerückt und schlagartig werden neue Beteiligungsformen des bislang pas- siven Radiohörers möglich.“[17]
Mit der Einführung des dualen Rundfunksystems und der Lizenzierung privater Radiosender standen die Programmmacher unter einem neuen Konkurrenzdruck. Es bedurfte einer genauen Programmplanung, die auf Ergebnissen der Marktforschung aufgebaut wurde.[18] Anscheinend spielte dabei auch die Hörerbeteiligung eine Rolle, denn laut BUCHER/KLINGLER/SCHRÖTER wurden u.a. Programmstrukturanalysen im bayerischen Hörfunk durchgeführt, in denen auch auf Partizipationsmöglichkeiten eingegangen wurde.[19]
2.2 Arten der Hörerbeteiligung
In der vorliegenden Arbeit wird als Hörerbeteiligung stets die direkte oder indirekte Beteiligung von „Externen“ am Programm verstanden, sofern es sich dabei eindeutig um Hörer und nicht um Interviewpartner handelt, die die Position eines Experten einnehmen. Beteiligung ist in diesem Fall gleichzusetzen mit Interaktivität, d.h. dass Hörer nicht nur passiv zuhören, sondern selbst mitmachen können. Dabei lassen sich grundsätzlich die verschiedenen technischen Formen der Beteiligung und thematische Beteiligungsformen unterscheiden.
2.2.1 Technische Unterscheidung
2.2.1.1 Telefongespräche
Telefongespräche mit Hörern machen laut BÖHME-DÜRR/GRAF die Hörer „sehr authentisch erlebbar“ und werden deshalb als eigenständige Form der Moderation angesehen.[20] Sie sind für den Sender kostengünstig, schnell zu realisieren und thematisch flexibel.[21] Gemäß ORIANS ist das Telefongespräch mit Hörern „die häufigste und hörfunkgemäßeste Form der Beteiligung“[22], die besonders in Magazinprogrammen von Service-Wellen „strukturell verankert“ ist.[23] Werden Telefonate mit Hörern nach bestimmten Regeln durchgeführt, können sie laut LYNEN ebenso wertvoll sein wie informative Beiträge oder Nachrichten.[24]
2.2.1.2 Straßenbefragungen
Straßenbefragungen können prinzipiell mit Meinungsäußerungen (vgl. Kapitel 2.2.2.3) von Hörern in Sendungen verglichen werden. Hier äußern sich Hörer spontan und kurz „zu Themen, die beim Publikum allgemein auf Interesse stoßen dürften“[25]. Die Hörer werden dazu aber nicht per Telefon direkt ins Studio gestellt, sondern die O-Töne werden von Redakteuren außerhalb des Studios - auf der Straße - eingeholt. Laut HAAS/FRIGGE/ZIMMER ist diese technische Form der Hörerbeteiligung „bei kontroversen oder unterhaltenden Themen am ergiebigsten“[26], da beliebige Passanten befragt werden können. In der Redaktion werden die verschiedenen Antworten aneinandergeschnitten und ergeben ohne weitere Zwischenmoderationen einen gesamten O-Ton, den der Moderator nach einer Anmoderation sendet. Dabei sollte er darauf hinweisen, dass diese Meinungen nicht repräsentativ sind.[27]
Straßenbefragungen sind besonders geeignet, um zu unterhalten und werden laut ARNOLD von den Programmmachern zur Auflockerung eingesetzt und um Atmosphäre zu transportieren; nicht aber um Information zu vermitteln.[28]
Häufig wird statt Straßenbefragung auch der Begriff Straßenumfrage verwendet. Davon distanziert sich ARNOLD, da diese Form der Hörerbeteiligung keine demoskopi- sche Untersuchung darstellt, die in der Wissenschaft als „Umfrage“ bezeichnet wird.[29]
2.2.1.3 Beteiligung via Internet und Post
Hörer können nicht nur direkt mit eigenen Aussagen und Gesprächen über Telefon oder Straßenbefragungen am Programm beteiligt werden, sondern auch indirekt. So wurde beispielsweise bei einer Inhaltsanalyse der BLM bei der Codierung zwischen direkter und indirekter Hörerbeteiligung unterschieden und die indirekte Beteiligung als „das Zitieren von Hörern, z.B. bei Musikwünschen oder Grüßen“ definiert.[30] In den folgenden Kapiteln wird detailliert auf einige postalische Beteiligungsformen eingegangen; eine weitere, ähnliche Form stellt die Beteiligung über das Internet dar. Gemäß einer Studie von HRUBESCH sind gängige Formen der Online-Beteiligung z.B. E-Mail und Internet Relay Chat.[31] Die meisten Radiosender Deutschlands sind auch in dem sozialen Netzwerk Facebook vertreten und sammeln dort ihre Hörer als „Fans“.[32] Kommentare und Reaktionen von Hörern auf der Facebook-Seite des jeweiligen Senders können in Form von indirekter Beteiligung über Moderationen ins Programm eingebunden werden.
2.2.2 Thematische Unterscheidung
2.2.2.1 (Gewinn-)Spiele und Quizsendungen
Interaktion gilt laut der ARD/ZDF-ARBEITSGRUPPE MARKETING als unterhaltend, gerade wenn es sich um Quizsendungen oder andere interaktive Mitspielmöglichkeiten für Hörer handelt. „Mitspielen“ steht dabei nicht nur für Rate- oder Gewinnspiele. Die Palette reicht von Spielen und Glückwünschen bis hin zur Musikwahl durch das Publikum (vgl. Kapitel 2.2.2.2).[33] Diese Möglichkeiten zur Hörerbeteiligung werden laut ORIANS von fast ausnahmslos allen Radiosendern genutzt - auch wenn es sich lediglich um „mehr oder weniger einfallsreiche Ratespielchen“ handelt.[34] Auch NEUMANNBRAUN ordnet on-air-Quizaufgaben, bei denen der Hörer als Ratepartner fungiert, dem Unterhaltungssektor zu.[35] Populär wurden Gewinnspiele im Radio ab den späten 80er Jahren.[36]
2.2.2.2 Wunschsendungen und Grüße
KIESSLINGS Definition erweitert das Spektrum der Mitspielmöglichkeiten um Tauschaktionen und Grüße von Hörern, die an vorangegangene Wünsche gekoppelt sind.37 Er führt beispielhaft die Sendung „Wunschkonzert“ auf, in der das Vorgehen on-air recht simpel ist:
„Ein Hörer oder eine Hörerin wünscht sich auf schriftlichem Weg (z.B. für ein Fa- milienmitglied) ein Musikstück, der Moderator verliest in der Sendung diese Liedwidmung ggf. mit einer Grußbotschaft und spielt dann das gewünschte Lied.
Als Variationsmöglichkeit werden [...] auch telefonische Hörergespräche in die Sendung eingefügt. ‘[38]
Diese Form der Hörerbeteiligung nennen auch BUCHER/KLINGLER/SCHRÖTER, nach deren Ausführungen die Grüße anfänglich per Post kamen und vom Moderator in der Sendung verlesen wurden; im Laufe der Jahre meldeten sich die Hörer auch telefonisch.[39]
2.2.2.3 Meinungsäußerungen und Diskussionen
Neben ihrer Funktion als Gratulanten und Mitspieler nehmen die Hörer bei der Beteiligung am Programm in einigen Radiosendungen die Position der Fragenden oder Diskutierenden ein.[40] Sie „können aktuelle Themen diskutieren; miteinander, mit dem Moderator oder mit einem Studiogast“.[41] Nicht selten ist dieser Studiogast ein Prominenter, Politiker oder Fachmann auf einem bestimmten Themengebiet. In der Funktion als Diskussionspartner befinden sich die Hörer in einem wesentlich „ernsteren Dialograhmen“ und können auch über seriösere Themen sprechen als die Antwort auf eine bunte Quizfrage.[42]
Meinungsäußerungen der Hörer in einer Sendung haben keinesfalls den Anspruch auf Repräsentativität. Darauf weisen besonders HAAS/FRIGGE/ZIMMER hin, die diese Art der Hörerbeteiligung als gute Möglichkeit sehen, um Trends aufzuzeigen und vielseitig zu sein.[43] Dass bei dieser Art, die Hörer kurzzeitig in eine bestehende Diskussionsrunde einzubinden, aber auch die Gefahr besteht, dass sich die Diskussion verschlechtert, gibt ARNOLD zu bedenken. Entweder kommt einer der beiden Parteien (Hörer oder Studiogast) zu kurz oder ein interessanter Verlauf der Diskussion wird durch die Einblendung der Hörer unterbrochen.[44] Diese Situation wird vereinfacht, wenn statt des Dreier-Gesprächs zwischen Studiogast, Hörer und Moderator ein Zweier-Gespräch ohne Studiogast geführt wird. Hier werden Hörer vom Moderator aufgefordert, sich zu einem bestimmten Thema zu äußern.[45] Dabei handelt es sich um Reaktionen und Meinungen der Hörer, die in diesem Fall nicht in einer ausführlichen Diskussion erörtert werden. Diese Form der Beteiligung wird auch als „Call-In“ oder „Phone-In“ bezeichnet.
Eine besondere Art der Hörerbeteiligung im Sinne von Diskussionen mit Hörern bietet die Form des Talkradios. Diese Programmform ist laut MEYER darauf ausgerichtet, eine „Kommunikationspipeline für jeden Hörer“ zu sein und den Hörern eine Plattform zu bieten, um zu Wort zu kommen und „‘denen da oben' mal seine Meinung“ zu sagen.[46] Die Einbindung des Hörers via Telefon macht den Hauptbestandteil des Programms aus.[47] In der vorliegenden Arbeit spielt diese spezielle Programmform allerdings keine Rolle, da es sich bei Talkradio um ein eigenständiges Radioformat handelt und sich die vorliegende Analyse aufAC- bzw. CHR-Formate bezieht, deren Hauptbestandteil die Musik ist (vgl. Kapitel 3.1).[48] Eine Ausnahme bilden - sofern vorhanden - einzelne Sendungen der analysierten Sender im Talkradio-Format.
2.2.2.4 Beratungen
Programme mit Hörerbeteiligung können neben der Diskussion auch die Beratung von Hörern zum Ziel haben; die Umsetzung ist ähnlich. Die Hörer bekommen von den Moderatoren die Möglichkeit, sich von kompetenten Gesprächspartnern beraten zu lassen, „die sie andernfalls nicht erreichen können“.[49] Diese Experten können Fachleute verschiedener Themenbereiche sein - zum Beispiel Ärzte, die die Hörer medizinisch beraten oder Investment-Berater, die on-air ihre Hilfe anbieten.[50] In manchen Fällen kommen diese Beratungssendungen einer „Telefonseelsorge im Radio“[51] gleich oder bedeuten einen „‘Seelen-Striptease‘ am Telefonhörer“[52], denn es bedarf auf Seiten der Hörer großer Offenheit und Mutes, ihre Probleme in der Öffentlichkeit zu artikulieren.
Eine der langjährigen Talkradio-Sendungen in Deutschland ist Domian beim nordrheinwestfälischen Sender ILive. Diese Sendung wird ausführlich im Kapitel 2.6.2 vorgestellt.
2.2.2.5 Hörer als Werbeträger
Hörer können als so genannte Testimonials (Identifikationsfiguren eines Senders) ins Programm einbezogen werden. Diese Form der Beteiligung ist allerdings inszeniert und nicht aus redaktionellen Überlegungen heraus entstanden, sondern dient dazu, anderen Hörern zu vermitteln, dass Gleichgesinnte den Sender bereits für sich entdeckt haben. RACKWITZ sieht diese Form der Hörerbeteiligung als „Voraussetzung für eine enge Bindung zwischen Sender und Hörer“.[53] Die beteiligten Hörer dienen in diesem Fall als Werbeträger des Senders in produzierten Elementen wie Jingles.[54]
Zu dieser Form der Hörerbeteiligung zählen auch Gespräche mit Hörern und Straßenbefragungen, die ausschließlich bzw. zum größten Teil Lob für den Sender beinhalten.
2.2.3 Sonstige Beteiligungsformen
Hörer haben darüber hinaus die Möglichkeit, sich mit Themenvorschlägen an die Sender zu wenden, die dann ggf. von den Redaktionen aufgegriffen werden. Ein Beispiel aus den 70er Jahren ist die Sendung Hallo Ü-Wagen (vgl. Kapitel 2.6.1), in der Hörer Themen vorgeschlagen und dann selbst diskutiert haben.[55] ARNOLD hält dieses Konzept für die effektivste Form der Hörerbeteiligung, „wenn sich das Medium der für ihn [den Hörer] wichtigen Themen annimmt“[56].
Einen noch höheren Beteiligungsgrad haben Beiträge, die direkt von Hörern produziert werden. Der Einsatz dieser Beiträge ist laut ORIANS allerdings meist ein „Qualitäts- sprung“[57]. Für diese Form der Hörerbeteiligung zeichnen sich besonders „Bürgermedien“ aus, die laut VON LA ROCHE/BUCHHOLZ zu den nicht-kommerziellen sendern zählen, unter die auch „Uni-Radios und Lern-Radios“ sowie offene Kanäle fallen.[58]
Damit Hörer nicht nur mit dem Sender, sondern auch untereinander kommunizieren können, wurden früher Radioclubs - heute Online-Communities - eingerichtet. Als Beispiel für einen Radioclub führen BRÜNJES/WENGER den „SDR 3-Club“ auf, bei dem Hörer ähnlich wie in einem Kundenclub von Unternehmen organisiert wurden und ein Automodell zu einem vergünstigten Preis kaufen konnten.[59] Ein aktuelles Beispiel für Online-Communities von Radiosendern ist die „MDR JUMP Community“, die einem sozialen Netzwerk entspricht. Die Hörer können sich online anmelden, untereinander in Kontakt treten und sich via Chat (oder Telefon und E-Mail) einmal pro Woche am Programm von MDR Jump beteiligen.[60]
2.3 Ziele der Hörerbeteiligung
„Eigentlich gibt es keine vernünftigen Gründe dafür. Denn nach den herkömmli- chen Kriterien von Rundfunk ist es so, daß Publikum meistens nicht besonders intelligent ist oder besonders kluge Sachen zu sagen hätte.“[61]
Wie die Radiojournalistin Carmen Thomas in den Hörfunkgesprächen 1987 festgestellt hat, birgt Hörerbeteiligung für die Programmmacher Risiken (vgl. Kapitel 2.5): in Sendungen geschaltete Hörer können zum Beispiel medial unerfahren sein und sich dadurch blamieren oder gegenüber dem Moderator ausfallend und unfreundlich werden.[62] Warum sollten Programmacher diese Risiken auf sich nehmen? Was macht Hörerbeteiligung in ihren Augen interessant und notwendig?
Sehr oft wird Hörerbeteiligung mit Hörerbindung gleichgesetzt. Für KIESSLING wird die Beteiligung durch eine persönliche Beziehung zum Hörer realisiert, die sich dann in Hörerbindung „ummünzen“ lässt.[63]
„Das Interesse der Sender liegt aufder Hand. Es geht ums Geschäft, um die Stärkung der Hörerbindung in kommerzieller Absicht.“[64]
KIESSLING führt außerdem aus, dass Hörer durch Beteiligungsformate besonders in emotionaler Hinsicht an einen Sender gebunden werden, da die Beteiligung „auf der Ebene unbewußter Motivstrukturen und Triebregungen“ beim Hörer ansetzt. Es sei laut KIESSLING eine „gesicherte Erkenntnis“, dass Sender mit Hörerbeteiligung eine gefestigte Hörerbindung aufweisen.[65] Auch MEYER führt den Einsatz von Hörerbeteiligung auf das strategische Ziel der Programmmacher zurück, die Hörerbindung zu verstärken.[66] Denn wer an ein Programm gebunden ist, wechselt den Sender nicht so schnell, bleibt seinem Lieblingssender gegenüber loyal und verzeiht den Programmachern auch Fehler.[67] NEUMANN-BRAUN stützt sich auf die allgemeine Meinung von Programmverantwortlichen, wonach generell Hörergespräche und im Besonderen LiveTelefoninterviews mit Hörern die Hörerbindung stärken.[68] Und ORIANS zeigt, dass auch die Hörer selbst der Meinung sind, dass Sender ihr Publikum durch Beteiligung am Programm binden wollen. Sie verbinden mit Hörerbindung „die Stabilisierung der Einschaltquoten mit Blick auf die Werbeeinnahmen“.[69]
Als weiterer Grund, warum Hörerbeteiligung in Radioprogrammen integriert werden sollte, wird häufig das Schaffen von Publikumsnähe genannt. BUCHER/KLINGLER/SCHRÖTER sehen die Beteiligung der Hörer unter anderem als „eine besondere Form der Pflege von Publikumsbeziehungen“[70]. Beziehen die Sender Hörer direkt ins Programm ein, nehmen sie laut KIESSLING einen Stellvertreter der gesamten Hörerschaft auf Sendung, „mit dem sich das Publikum identifizieren soll“. Die Sender erzeugen dadurch die Illusion, dass sie für ihre Hörer da sind und sich ihrer Probleme annehmen.[71] Gleichzeitig bauen die Sender mit Hörerbeteiligung laut NEUMANN-BRAUN auf Nähe sowohl im thematischen als auch kommunikativen Bereich. Sie wollen durch den Anteil der Hörer im Programm zeigen, dass sie gewillt sind, Distanzen zu ihrer Hörerschaft abzubauen.[72] Ziel für die Programmmacher ist auch, darzustellen, dass ihr Sender keine Einbahnstraße ist - es gibt nicht nur den Weg vom Sender zum Hörer, sondern auch den umgekehrten.[73] Die Sender demonstrieren laut MEYER außerdem, dass sie sich in ihrem Sendegebiet auskennen.[74] Durch den hörbaren Kontakt zu den Hörern entsteht nach Meinung von BÖHME-DÜRR/GRAF eine gewisse Authentizität.[75] Sie wirkt sich positiv auf die Glaubwürdigkeit aus.
ORIANS stellt fest, dass in den Augen der Hörer die Aussagen von Gleichgesinnten - also anderen Hörern - besonders glaubwürdig sind.[76] NEUMANN-BRAUN führt das auf die Hörerbeteiligung im Sinne der „publizistischen Meinungsäußerung“ zurück. Aus Sicht der Programmmacher stehe das für Transparenz und wirke sich positiv auf die Glaubwürdigkeit aus.[77]
Hörerbeteiligung heißt auch Unterhaltung. Interaktive Elemente in Hörfunksendungen bringen laut der ARD/ZDF-ARBEITSGRUPPE MARKETING immer Originalität, Unerwartetes und Spontanes.[78] BUCHER/KLINGLER/SCHRÖTER ordnen vor allem Spiele und Wettbewerbe dem Unterhaltungsbereich im Hörfunk zu.[79] Das liegt laut MEYER an originellen Statements der Hörer.[80] ORIANS führt aus, dass sich die Hörer des Unterhaltungswerts ihrer Aussagen bewusst sind und die Funktion der Unterhaltung bei der Hörerbeteiligung als Hauptziel der Sender sehen.[81]
In früheren Jahren der Radiogeschichte (vgl. Kapitel 2.1) spielte auch der demokratische Gedanke der Hörerbeteiligung eine entscheidende Rolle: da der Hörfunk beispielsweise in Zeiten der nationalsozialistischen Diktatur als Herrschaftsinstrument missbraucht wurde, wollten die Programmverantwortlichen zeigen, dass Radio nicht manipuliert, sondern transparent ist und eine freie Meinungsäußerung - auch seitens der Hörer - ermöglicht. ORIANS beschreibt die Hörerbeteiligung in diesem Zusam- menhang als „Synonym für Demokratie im Prozeß der Information und Meinungsäußerung“.[82] Die von ihm befragten Hörer vermuten Demokratie und Meinungsvielfalt als Intention für Hörerbeteiligung seitens der Sender. Hörerbeteiligung sei ein Anzeichen dafür, dass es keine Zensur gebe.[83]
Weitere, vermutete, weniger oft genannte Ziele, die Programmmacher mit Hörerbeteiligung verfolgen, sind z.B. die Varianz bzw. Vielfältigkeit im Programm, die durch den Einsatz von Hörerbeteiligung entsteht. BRÜNJES/WENGER beschreiben in diesem Zusammenhang, wie über ein Thema, das ein Radiosender von verschiedenen Seiten beleuchtet, beispielsweise auch durch Elemente mit Hörerbeteiligung, variiert berichtet werden kann.[84] Darüber hinaus werden Popularitätsgewinne[85] und Promotion als Motivation seitens der Sender vermutet. MEYER gibt als Beispiel an, dass Hörer auf Sendung genommen werden, um Lob oder Fragen zum Programm zu äußern.[86] Einige Befragte aus ORIANS' Studie vermuten sogar Arbeitsersparnis für Redakteure hinter dem Einsatz von Hörerbeteiligung.[87]
2.4 Themenauswahl für Hörerbeteiligung
Schon die Titel mancher Beteiligungsformate oder -formen lassen auf ihre Inhalte schließen: in Wunschsendungen äußern Hörer ihre Musikwünsche, in Rate- und Quizformaten beantworten Hörer eine Frage und bei Gewinnspielen freuen sich die Hörer on-air über einen Gewinn oder erzählen z.B. bei einem Geldgewinn, was sie mit dem Geld vorhaben. Über die Themen in Beteiligungsformaten, in denen Hörer als Gesprächspartner eingebunden werden, gibt es verschiedene Befunde. LYNEN rät, dass Moderatoren in diesem Fall mit Hörern über deren Hobbys oder Anekdoten aus deren Leben reden sollten.88 NEUMANN-BRAUN hat die Erfahrung gemacht, dass besonders Themen aus dem Bereich „human-interest“ platziert werden: er stellt fest, dass in Hörergesprächen in Wunschsendungen „tendenziell weder komplizierte noch ernste Themen dargeboten“ werden und stattdessen auf die Gebiete Romantik/Liebe, Religion, Geld, Kinder, Gesundheit und Tiere zurückgegriffen wird.89 Beratungssendungen wie Domian (vgl. Kapitel 2.6.2) beweisen aber, dass auch über ernsthafte Themen mit Hörern gesprochen werden kann. ORIANS verweist auf Sendungen mit Hörerbeteiligung, die intime und vertrauliche Themen wie Sexualität behandeln.[90] In einer Inhaltsanalyse der BLM (1990, vgl. Kapitel 2.7.2), wurden neben Musikwünschen und Gewinnspielen außerdem die Themenfelder Massenkultur, Wirtschaft und Handel, Konsum und Verbraucherfragen, Klatsch, menschliche Begebenheiten, Freizeit/Reisen, Gesundheit, Küche und Garten auf Sendeplätzen mit Hörerbeteiligung verzeichnet.[91]
2.5 Risiken der Hörerbeteiligung
Wenn ein Moderator eine Sendung moderiert, in der Hörer beteiligt werden, hat er es meist mit medial unerfahrenen Personen zu tun. Das ist ein Risikofaktor für die Programmverantwortlichen, denn das Verhalten der Hörer in einer für sie unbekannten Situation - sei es live auf Sendung oder bei einer Aufzeichnung außerhalb des LiveBetriebs - kann vorab nur schwer eingeschätzt werden; ebenso wie deren Auswirkungen auf das Programm. Was, wenn ein Hörer plötzlich von einem netten Plauderton in ein aggressives Verhalten verfällt oder beleidigend wird? Laut KIESSLING wäre in diesem Fall das von den Programmverantwortlichen angestrebte homogene Programm gestört, da in diesem Fall die Gute-Laune-Stimmung der Sender vom Hörer sabotiert würde.[92] Aber auch in Gesprächen mit durchweg freundlichen Hörern liegen Gefahren für die Programmverantwortlichen. LYNEN beschreibt das Gespräch mit dem Hörer als „schwierigste Disziplin überhaupt“:
„Denn hier- im 1:1-Gespräch mit einem echten Menschen wird plötzlich offen- bar, wie authentisch man als Moderator tatsächlich ist. Viele Gespräche mit Hö- rern kommen nicht in Fahrt, haben peinliche Längen, klingen nach aufgeplusterter Befragung durch einen ,Mikro-Besprecher‘, kommen statisch rü- ber und haben keine gescheite Dramaturgie.“[93]
Die Programmverantwortlichen sind andererseits in der Verantwortung, den am Programm beteiligten Hörer nicht öffentlich bloßzustellen. Laut ARNOLD sind die Moderatoren und Redakteure Profis, die dafür sorgen müssen, dass die Hörer nicht zum „Gespött ihrer Umwelt“ und der Lächerlichkeit preisgegeben werden.[94] ORIANS hebt hervor, wie wichtig die Kompetenz der Programmverantwortlichen bei der Beteiligung von Hörern ist: sie müssen „zwischen den gesetzten Grenzen manövrieren“ damit die Hörer „nicht zum Manipulationsobjekt oder gar zum .Watschenmann' werden“.[95] NEUMANN-BRAUN kritisiert in diesem Zusammenhang, dass Hörer „von den Moderatoren geradezu .abgefertigt' bzw. zu unterhaltenden Zwecken .vernutzt'“ werden.[96]
Weitere Punkte, die beim Einsatz von Hörerbeteiligung beachtet werden müssen, sind z.B. inhaltliche Kriterien für die jeweiligen Sendeplätze. VON LA ROCHE/BUCHHOLZ verweisen auf die Gefahr, dass Fragen von Hörern zu speziell oder Meinungen zu abstrus sein können. Außerdem geben sie zu bedenken, dass dialektale Einfärbungen in der Aussprache der Hörer zwar von Nutzen aber auch unverständlich sein können.[97] In Live-Sendungen oder auch außerhalb des Studios - beispielsweise in der Redaktion, wo Höreranrufe angenommen werden - gibt es laut ARNOLD Risiken, auf die sich Programmverantwortliche einstellen müssen. Beispielsweise ist es möglich, dass derselbe Hörer immer wieder anruft, um sich am Programm zu beteiligen.[98]
Die genannten Punkte sind Gründe dafür, dass sich Programmverantwortliche für Sendungen mit Hörerbeteiligung absichern und Hörergespräche vorab aufzeichnen, um sie zeitversetzt zu senden. Dabei wählen Redakteure nach einem Vorgespräch einen Hörer aus, der genau auf das gewünschte Hörer-Profil des Senders passt.[99] Eines der Hauptkriterien für die Auswahl ist, dass sich der Klang des Hörers in das Gesamtbild des Senders und die angepeilte Zielgruppe einfügt.[100]
„Ein Redakteur/Producer kann bei der Auswahl der Gesprächspartner großes
Unheil anrichten. [...] Denn Anrufer prägen das Image eines Senders mit.“[101]
2.6 Ausgewählte Beispiele von Hörerbeteiligungssendungen
Im Folgenden wird auf zwei Beteiligungsformate des WDR eingegangen, die große Bekanntheit erzielt haben - Hallo Ü-Wagen aufgrund seiner Vorreiterrolle als Beteiligungssendung in den 70er Jahren, Domian aufgrund der zusätzlichen Ausstrahlung im WDR-Fernsehen.
2.6.1 Hallo Ü-Wagen
Die WDR-Sendung Hallo Ü-Wagen wurde zwischen 1974 und 2010 regelmäßig ausgestrahlt; seit ihrer Absetzung werden von WDR 5 von Zeit zu Zeit Spezialausgaben zu aktuellen Themen gesendet. Es handelte sich bei Hallo Ü-Wagen ursprünglich um eine Mitmach-Sendung für Bürger auf der Straße, denn anders als bei Hörerbeteiligungen z.B. über Telefongespräche wurden die Hörer der Sendung live dazu eingeladen, direkt an den Übertragungswagen zu kommen und sich im direkten Gespräch vor Ort an der Live-Sendung zu beteiligen. Carmen THOMAS, langjährige Moderatorin von Hallo Ü- Wagen, beschreibt das Prinzip der Sendung so:
„Ein kleiner Ü-Wagen stand an einem eher beliebigen Ort, häufig innerhalb Kölns, an einer Drogerie, einem Schwimmbad, einem Platz. Ein Musikmoderator beschrieb schnitzeljagdartig den Standort und forderte die Hörer-innen auf, den Ü-Wagen zu suchen und ein Erkennungszeichen mitzubringen, z.B. eine Bratpfanne oder eine Spieluhr. Mit diesem Erkennungszeichen erwarben sich die Be- sucher-innen das Recht, ihren Opa oder ihre Tante zu grüßen und sich einen Musiktitel zu wünschen. “[102]
Im Laufe der Zeit wurden die Grüße weitestgehend aus der Sendung gestrichen und stattdessen von den Hörern vorgeschlagene Themen mit den Bürgern vor Ort diskutiert.[103]
2.6.2 Domian
Die Sendung Domian ist eine Talkradio-Sendung, die montags bis freitags zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr nachts beim WDR-Sender ILive ausgestrahlt wird.[104] Domian ist aus der Vorgängersendung Riff entstanden, die zwischen 1991 und 1995 nachmittags an Werktagen ausgestrahlt wurde. Ursprünglich informierten laut KRAUSE Experten und Reporter über vorbereitete Themen; im Laufe der Zeit kamen immer häufiger Hörer zu Wort. Schließlich wurde aus dem willkürlichen Einsatz von Hörerbeteiligung bei Riff eine Strategie: ab 1993 wurde die Freitagsausgabe der Sendung nicht mehr thematisch von der Redaktion vorbereitet, sondern Moderator Jürgen Domian kam während der gesamten Sendung ausschließlich mit Hörern ins Gespräch.[105] Seit 1995 wird die Sendung auch im WDR-Fernsehen übertragen.[106]
Einmal pro Woche ist ein spezifisches Thema vorgegeben, über das Jürgen Domian mit seinen Hörern spricht. Die Themenbereiche reichen von „Glücklich sein“ (26.01.2012), „Waffen“ (15.12.2011) und „Ich schäme mich für meinen Partner“ (08.12.2011) über „Meine große Sehnsucht“ (06.10.2011), „Das habe ich für Geld getan“ (16.06.2011) und „Mein Hobby wurde mir zum Verhängnis“ (26.05.2011) bis hin zu „Beste Freunde“ (19.05.2011), „Mein Leben ist in Gefahr“ (12.05.2011) und „Schmarotzer“ (07.04.2011).[107] „Ich frage die Leute alles. Und die Leute können mich alles fragen"[108] wird Jürgen Domian von 1LIVE zitiert.
Den Erfolg der Sendung bei den Hörern hat laut KRAUSE eine Abteilung des WDR im Jahr 1996 erforscht. Ihr zufolge war die Sendung Domian damals einem Fünftel der 1000 Befragten in Nordrhein-Westfalen bekannt.[109]
2002 wurde Jürgen Domian für seine Sendung mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt[110], das ihm im Januar 2003 überreicht wurde.[111]
2.7 Überblick über Forschungsergebnisse zur Hörerbeteiligung in bayerischen Programmen
Es gibt nur sehr wenige Studien zur Hörerbeteiligung in Radioprogrammen. Eine davon ist die bereits mehrfach zitierte Studie von ORIANS, die sich mit der Meinung der Hörer über Beteiligungsformate beschäftigt. Zwei weitere Studien - speziell für die landesweiten Radiosender in Bayern bzw. die privaten Lokalsender - veröffentlichte die BLM; allerdings sind ihre Ergebnisse, ebenso wie die der Studie von ORIANS, mittlerweile über 20 Jahre alt. Aktuellere, repräsentative Untersuchungen über die Hörerbeteiligung in bayerischen Sendern liegen nicht vor.
2.7.1 BLM-Studie 1989
1989 hat die BLM die im Vorjahr erstmals durchgeführte Image- und Akzeptanzanalyse des Hörfunks in Bayern fortgeführt. Dafür wurden 1.710 Personen in Bayern unter anderem nach der Bedeutung einzelner Programmformen in privaten Lokalfunkprogrammen befragt.
Bei der Auswertung wurde deutlich, dass Sendungen mit Hörerbeteiligung von den Befragten als „eher negativ“ eingeschätzt wurden; noch ein wenig schlechter wurden Quizsendungen und Gewinnspiele bewertet.[112] Laut der Studie vermisste ein Großteil der Hörer „die Form der Hörerbeteiligung, die es ihm ermöglicht, für die Fragen eine Antwort zu erhalten, die seinen persönlichen Lebenskreis bestimmen“[113]. So wurde die Beteiligung an Diskussionen mit Experten oder Hörern als wichtig angesehen wie auch Wunsch- und Grußsendungen; Gewinn- und Ratespiele sowie Quizsendungen bewerteten die Befragten dagegen als unwichtig.[114]
2.7.2 BLM-Studie 1990
In der 1990 von der BLM veröffentlichten Studie zum Thema wurden die drei landesweiten bayerischen Sender Antenne Bayern, Bayern 1 und Bayern 3 analysiert. Zu- gründe gelegt wurde das Programm dieser Sender im Zeitraum vom 02.10.1989 bis 08.10.1989.[115]
Es wurde festgestellt, dass Hörerbeteiligung eine „wichtige Rolle bei der Gestaltung des Programms“ spielt. Die Inhaltsanalyse der drei Programme wies Antenne Bayern als denjenigen der analysierten Sender aus, der innerhalb der analysierten Woche den größten Anteil von Beiträgen mit Hörerbeteiligung hat. Bayern 1 und Bayern 3 beinhalteten deutlich weniger Beteiligungselemente, wobei Bayern 1 noch mehr Beteiligungsmöglichkeiten für Hörer bot als Bayern 3 (vgl. Tabelle 1).[116]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Hörerbeteiligung in bayerischen landesweiten Programmen 1989
Thematisch lagen in dieser BLM-Studie Musikwünsche von Hörern bei allen drei Sendern vorn: 35 Mal kam Hörerbeteiligung im Zusammenhang mit Moderationen zur Musik bei Antenne Bayern vor, 19 Mal wurde diese Kategorie bei Bayern 1 verzeichnet und im Programm von Bayern 3 lag die Anzahl bei 4.[117]
In der auf die Häufigkeitsverteilung von Hörerbeteiligung folgenden Image- und Akzeptanzanalyse wurde festgestellt, dass die Hörer „Möglichkeiten, sich am Programm beteiligen zu können“ als eher unwichtig einschätzen; ähnlich wurde die Kategorie „Spiele und Quizsendungen“ bewertet.[118] „Musikwunschsendungen“ konnten sich hingegen bei den befragten Hörern als wichtiger durchsetzen.[119]
Bei der Umsetzung von Hörerbeteiligung in den Sendungen hatten die analysierten Sender aus Sicht der befragten Hörer offenbar Nachholbedarf: sowohl „Spiele und Quizsendungen“ als auch „Hörereinbeziehung“ wurden lediglich mit einem „befriedi- gend“ bewertet und gehörten damit zu den von den Hörern am schlechtesten bewerteten Kategorien.[120]
2.8 Forschungsfrage und Untersuchungsinhalt
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Hörerbeteiligung in den Augen vieler Programmverantwortlicher unter anderem Hörer an einen Sender bindet und für die Authentizität des Programms förderlich ist; allerdings sind mit ihr auch Risiken verbunden, die z.B. der medialen Unerfahrenheit der sich beteiligenden Hörer geschuldet sind. Inwiefern sind Programmverantwortliche bereit, diese Risiken einzugehen, um Hörer aktiv an ihrem Programm zu beteiligen? Gibt es für Programmverantwortliche überhaupt einen Anlass - und wenn ja welchen - Hörer in Sendungen einzubinden? Und auf welche Art und Weise erfolgt die Beteiligung am häufigsten? Die vorliegende Arbeit wird auf diese Fragen eingehen. Untersucht werden - wie im Kapitel 3.1 ausführlich erläutert wird - die drei erfolgreichsten, landesweiten Sender Bayerns und zwei Lokalsender, die am Standort Bamberg empfangbar sind.
Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Frage: Welche Ziele verfolgen bayerische Radiosender mit dem Einsatz von Hörerbeteiligung in ihren Programmen (am Beispiel der drei meistgehörten, landesweiten Programme Antenne Bayern, Bayern 1 und Bayern 3 sowie der zwei in der Stadt Bamberg empfangbaren Lokalsender Radio Bamberg und Radio Galaxy Bamberg/Coburg)?
Zur Klärung der Forschungsfrage dienen insbesondere Experteninterviews mit leitenden Programmverantwortlichen der analysierten Sender. Eine quantitative Inhaltsanalyse wird durchgeführt, um zu erkennen, ob Hörerbeteiligung in den analysierten Programmen regelmäßig eingesetzt wird und dabei eine Systematik erkennbar ist. Durch die gewonnenen Daten kann außerdem ein Vergleich zu den Inhaltsanalysen der BLM 1989/1990 (vgl. Kapitel 2.7) gezogen und herausgefunden werden, ob die Trends von Hörerbeteiligung in den landesweiten bayerischen Programmen von damals heute noch aktuell sind oder sich gewandelt haben.
3 Methoden der Analyse
Zur Beantwortung der in Kapitel 2.8 aufgeworfenen Fragen wird zum einen eine Inhaltsanalyse der Programme der fünf reichweitenstärksten Sender am Standort Bamberg durchgeführt. Ausschlaggebend für die Auswahl der Sender ist ein Marktanteil im jeweiligen Verbreitungsgebiet von mindestens 10%. Der Standort Bamberg dient exemplarisch als einer von vielen Standorten in Bayern, an dem sowohl landesweite Hörfunkprogramme als auch lokale Sender empfangen werden können.
Zum anderen werden leitende Programmverantwortliche dieser Sender in qualitativen Experteninterviews zu ihrer Motivation beim Einsatz von Hörerbeteiligung befragt.
3.1 Analyse von fünf bayerischen Radiosendern im Raum Bamberg
Die analysierten Sender sind Antenne Bayern, Bayern 1 und Bayern 3 mit bayernweiten Marktanteilen von 22,2%, 29,9% und 15,3%[121] sowie Radio Bamberg und Radio Galaxy Bamberg, die innerhalb ihres Sendegebiets Marktanteile von 20% und 10,1% aufweisen[122].
3.1.1 Antenne Bayern
Der Sendebetrieb bei Antenne Bayern wurde am 05. September 1988 aufgenommen. Seitdem sendet Antenne Bayern ein AC-Programm für eine Zielgruppe im Alter zwischen 14 und 49 Jahren.[123] Antenne Bayern hat wochentags eine durchschnittliche Reichweite von 1.105.000 Hörerkontakten in derwerberelevanten Zeit.[124]
Ursprünglich sollte Antenne Bayern unter dem Namen „Radio Bayern“ senden, wogegen der Bayerische Rundfunk aufgrund möglicher Verwechslungsgefahr mit seinen Hörfunkprogrammen erfolgreich gerichtlich vorging. Das Programm von Antenne Bayern wurde in der Bevölkerung Bayerns schnell bekannt und beliebt, da es sich mit Informationen, Comedy-Serien, markanten Moderatoren und einem Pop-Rock- Musikprogramm deutlich von den Programmen des Bayerischen Rundfunks absetzte. 1992 übernahm der Sender erstmals die Marktführerschaft in Bayern.[125]
3.1.2 Bayern 1
Der Bayerische Rundfunk in seiner heutigen Form besteht seit dem 25. Januar 1949. Zuvor gab es seit 1922 mit der „Deutschen Stunde in Bayern“[126], seit 1931 mit der „Bayerischen Rundfunk GmbH“, seit 1934 mit dem „Reichssender München“ und in den Jahren zwischen 1945 und 1949 mit „Radio Munich“ Hörfunk in Bayern[127]. 1949 wurde der Grundstein für den heutigen Bayerischen Rundfunk gelegt, als der damalige Intendant, Rudolf von Scholtz, die Lizenz vom Direktor der Militärregierung in Bayern, Murray D. van Wagoner, übergeben bekam.[128] Den Namen Bayern 1 trägt das erste Programm des Bayerischen Rundfunks seit dem 01. Januar 1974. Hintergrund für die Namensgebung war eine Radioreform des Bayerischen Rundfunks, die für Bayern 1 vorrangig die Themenbereiche „Aktuelles, Lebenshilfe, populäre Musik, Unterhaltung und Bayerisches“ vorgab.[129]
Bayern 1 ist laut den Angaben seines Vermarktungsunternehmens ARD-Werbung Sales & Services GmbH das reichweitenstärkste Programm Deutschlands und zeichnet sich durch ein Oldie-Musikprogramm mit aktuellen Informationen, Service und regionalen Beiträgen aus.[130] Pro Stunde kommt Bayern 1 im Durchschnitt auf eine Bruttokontaktsumme von 1.143.000.[131]
3.1.3 Bayern 3
Bayern 3 ist das dritte Hörfunkprogramm und die Servicewelle des Bayerischen Rundfunks. Laut der MA 2012 Radio I hat Bayern 3 durchschnittlich 804.000 Hörer- Bruttokontakte pro Stunde[132].
Gestartet ist das Programm von Bayern 3 am 01. April 1971 als erste Servicewelle Deutschlands - die „Servicewelle von Radio München“ - mit den Schwerpunkten Verkehrshinweise, Nachrichten und Popmusik. Bayern 3 übernahm eine Vorreiterrolle für alle Servicewellen in anderen Bundesländern.[133] Bis Mitte der 80er Jahre gab es keine Moderatoren im heutigen Sinn, sondern lediglich „Service-Sprecher“, die stündlich Nachrichten und Service-Meldungen verlasen. Im Laufe derzeit änderte sich die Programmstruktur häufig: nach der Zeit als „Autofahrerwelle“ zu Sendebeginn wurden in den 80er Jahren Informationen mit Musikformaten gemischt, bis 1992 schließlich das AC-Format eingeführt wurde.[134]
3.1.4 Radio Bamberg
Grundlage für die Entstehung von Radio Bamberg - sowie aller bayerischen Lokalsender - war das Bayerische Medienerprobungsgesetz, das 1985 in Kraft trat und die Entwicklung und Einführung von neuen Rundfunkangeboten ermöglichte.[135] Sendebeginn für Lokalradio in Bamberg war knapp zwei Jahre später am 10. Oktober 1987.[136] Zu Beginn teilten sich zwei Sender in Bamberg die Frequenz 88,5 MHz: vormittags sendete “Radio Regnitzwelle”, nachmittags übernahm “Fun Boy Radio”. Dieses Frequenzsplitting wurde aus wirtschaftlichen Gründen 1991 beendet, als beide Sender unter dem Namen “Radio Antenne Franken” fusionierten. Seit dem 10. Oktober 1996 - genau elf Jahre nach Sendebeginn - bekam der Sender seinen heutigen Namen Radio Bamberg.[137]
Radio Bamberg sendet ein regionales AC-Programm für die Landkreise und Städte Bamberg und Forchheim sowie angrenzende Landkreise. Die Zielgruppe ist die Altersgruppe von 29 bis 59 Jahre.138 Montags bis freitags übernimmt Radio Bamberg in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 06:00 Uhr sowie auch zeitweise am Wochenende das bayernweite Mantelprogramm der BLR.
[...]
[1] BRECHT, 1932, S.140/141
[2] Vgl. TROESSER, 1986, S.9
[3] Vgl. SCHANZE, 2001, S.460
[4] Als WERAG wurde die „Westdeutsche Rundfunk AG“ bezeichnet, die sich in Köln 1927 als Rundfunkgesellschaft gebildet hat.
[5] Vgl. WDR, Stand: 11.05.2012 Vgl. ORIANS, 1991,S.32
[6] TROESSER, 1986, S.10
[7] Vgl. ORIANS, 1991,S.34
[8] Vgl. HALEFELDT, 1999, S.214
[9] Vgl. ARD/ZDF-ARBEITSGRUPPE MARKETING, 1997, S.158
[10] Vgl. HALEFELDT, 1999, S.215
[11] Vgl. TROESSER, 1986, S.12
[12] Vgl. TROESSER, 1986, S.13
[13] Vgl. ORIANS, 1991, S.35
[14] Vgl. WINTER/ECKERT, 1990, S.68
[15] Vgl. TROESSER, 1986, S.13
[16] Vgl. ORIANS, 1991, S.35
[17] TROESSER, 1986, S.2
[18] Vgl. BUCHER/KLINGLER/SCHRÖTER, 1995, S.54
[19] Vgl. BUCHER/KLINGLER/SCHRÖTER, 1995, S.55
[20] Vgl. BÖHME-DÜRR/GRAF, 1995, S.116
[21] Vgl. VON LA ROCHE/BUCHHOLZ, 2004, S.254
[22] ORIANS, 1991, S.42
[23] Vgl. NEUMANN-BRAUN, 1993, S.26
[24] Vgl. LYNEN, 2010, S.114
[25] Vgl. KIESSLING, 1996, S.237
[26] HAAS/FRIGGE/ZIMMER, 1991, S.382
[27] Vgl. HAAS/FRIGGE/ZIMMER, 1991, S.383
[28] Vgl. ARNOLD, 1991, S.240
[29] Vgl. ARNOLD, 1991, S.240
[30] Vgl. BLM-SCHRIFTENREIHE 9, 1990, S.48
[31] Vgl. HRUBESCH, Stand: 10.05.2012
[32] Facebook-Nutzerzahlen der Sender können über folgende Internetadresse abgerufen werden:
http://www.traxy.de/188/radio_deutschland.html#facebook, Stand: 10.05.2012
[33] Vgl. ARD/ZDF-ARBEITSGRUPPE MARKETING, 1997, S.157/158
[34] Vgl. ORIANS, 1991, S.37
[35] Vgl. NEUMANN-BRAUN, 1993, S.159
[36] Vgl. BUCHER/KLINGLER/SCHRÖTER, 1995, S.60
[37] Vgl. KIESSLING, 1996, S.237
[38] NEUMANN-BRAUN, 1993, S.11
[39] Vgl. BUCHER/KLINGLER/SCHRÖTER, 1995, S.60
[40] Vgl. BUCHER/KLINGLER/SCHRÖTER, 1995, S.77
[41] VON LA ROCHE/BUCHHOLZ, 2004, S.254
[42] Vgl. NEUMANN-BRAUN, 1993, S.159
[43] Vgl. HAAS/FRIGGE/ZIMMER, 1991, S.382
[44] Vgl. ARNOLD, 1991, S.237
[45] Vgl. HAAS/FRIGGE/ZIMMER, 1991, S.382
[46] Vgl. MEYER, 2007, S.196
[47] Vgl. HAAS/FRIGGE/ZIMMER, 1991, S.198
[48] Vgl. VON LA ROCHE/BUCHHOLZ, 2004, S.271
[49] Vgl. ARNOLD, 1991, S.103
[50] Vgl. HAAS/FRIGGE/ZIMMER, 1991, S.381
[51] BRÜNJES/WENGER, 1998, S.155
[52] ORIANS, 1991, S.46
[53] Vgl. RACKWITZ, 2007, S.30
[54] Diese Form der Hörerbeteiligung ist der Autorin aufgrund ihrer Erfahrung in Radiosendern bekannt.
[55] Vgl. THOMAS, 1984, S.192
[56] ARNOLD, 1991, S.238
[57] Vgl. ORIANS, 1991, S.41
[58] Vgl. VON LA ROCHE/BUCHHOLZ, 2004, S.395/396
[59] Vgl. BRÜNJES/WENGER, 1998, S.52/53
[60] Vgl. MDR JUMP, Stand: 10.05.2012
[61] Vgl. HORN/PAUKENS, 1988, S.70
[62] Vgl. ARNOLD, 1991, S.238/239
[63] KIESSLING, 1996, S.239
[64] KIESSLING, 1996, S.236
[65] Vgl. KIESSLING, 1997, S.334/335
[66] Vgl. MEYER, 2007, S.132
[67] Vgl. HAAS/FRIGGE/ZIMMER, 1991, S.91/92
[68] Vgl. NEUMANN-BRAUN, 1993, S.27
[69] Vgl. ORIANS, 1991, S.98
[70] BUCHER/KLINGLER/SCHRÖTER, 1995, S.131
[71] Vgl. KIESSLING, 1996, S.239
[72] Vgl. NEUMANN-BRAUN, 1993, S.11
[73] Vgl. VON LA ROCHE/BUCHHOLZ, 2004, S.252
[74] Vgl. MEYER, 2007, S.133
[75] Vgl. BÖHME-DÜRR/GRAF, 1995, S.116
[76] Vgl. ORIANS, 1991, S.99
[77] Vgl. NEUMANN-BRAUN, 1993, S.27
[78] Vgl. ARD/ZDF-ARBEITSGRUPPE MARKETING, 1997, S.158
[79] Vgl. BUCHER/KLINGLER/SCHRÖTER, 1995, S.127
[80] Vgl. MEYER, 2007, S.133 Vgl. ORIANS, 1991, S.99
[81] Vgl. ORIANS, 1991, S.38
[82] Vgl. ORIANS, 1991, S.100/101
[83] Vgl. BRÜNJES/WENGER, 1998, S.40
[84] Vgl. KIESSLING, 1996, S.235
[85] Vgl. MEYER, 2007, S.133
[86] Vgl. ORIANS, 1991, S.101/102
[87] Vgl. LYNEN, 2010, S.111
[88] Vgl. NEUMANN-BRAUN, 1993, S.14
[89] Vgl. ORIANS, 1991, S.26
[90] Vgl. BLM-SCHRIFTENREIHE 9, 1990, S.48
[91] Vgl. KIESSLING, 1997, S.337
[92] LYNEN, 2010, S.110
[93] Vgl. ARNOLD, 1991, S.238
[94] Vgl. ORIANS, 1991, S.46
[95] Vgl. NEUMANN-BRAUN, 1993, S.12
[96] Vgl. VON LA ROCHE/BUCHHOLZ, 2004, S.252
[97] Vgl. ARNOLD, 1991, S.237/238
[98] Vgl. VON LA ROCHE/BUCHHOLZ, 2004, S.255
[99] Vgl. MEYER, 2007, S.133
[100] LYNEN, 2010, S.112
[101] THOMAS, 1984, S.27
[102] Vgl. THOMAS, 1984, S.71
[103] Vgl. 1LIVE, Stand: 06.05.2012
[104] Vgl. KRAUSE, 2006, S.56
[105] Vgl. KRAUSE, 2006, S.57
[106] Die gesendeten Themen wurden über das verifizierte Twitter-Profil von Domian (https://twitter.com/#!/domian, Stand: 06.05.2012) recherchiert.
[107] 1LIVE, Stand: 06.05.2012
[108] Vgl. KRAUSE, 2006, S.75
[109] Vgl. DWDL, Stand: 06.05.2012
[110] Vgl. KÖLNER NEWSJOURNAL, Stand: 06.05.2012
[111] Vgl. BLM-SCHRIFTENREIHE 7A, 1989, S.65
[112] Vgl. BLM-SCHRIFTENREIHE 7A, 1989, S.69
[113] Vgl. BLM-SCHRIFTENREIHE 7A, 1989, S.146
[114] Vgl. BLM-SCHRIFTENREIHE 9, 1990, S.5
[115] Vgl. BLM-SCHRIFTENREIHE 9, 1990, S.46
[116] Vgl. BLM-SCHRIFTENREIHE 9, 1990, S.48
[117] Vgl. BLM-SCHRIFTENREIHE 9, 1990, S.100
[118] Vgl. BLM-SCHRIFTENREIHE 9, 1990, S.102
[119] Vgl. BLM-SCHRIFTENREIHE 9, 1990, S.120
[120] Vgl. FAB 2011 ONLINE, Stand: 17.05.2012
[121] Vgl. FAB 2011, S.39 und 43
[122] Vgl. BLM SENDERPROFIL ANTENNE, Stand: 16.05.2012
[123] Vgl. MA 2012 RADIO I, Stand: 14.05.2012
[124] Vgl. RADIO JOURNAL, Stand: 17.05.2012
[125] Vgl. BR-CHRONIK 1922-1932, Stand: 14.05.2012
[126] Vgl. BR-CHRONIK 1933-1944, Stand: 14.05.2012
[127] Vgl. BR-CHRONIK 1945-1952, Stand: 14.05.2012
[128] Vgl. BR-CHRONIK 1970-1983, Stand: 14.05.2012
[129] Vgl. ASS BR 1, Stand: 14.05.2012
[130] Vgl. MA 2012 RADIO I, Stand: 14.05.2012
[131] Vgl. MA 2012 RADIO I, Stand: 14.05.2012
[132] Vgl. BR-CHRONIK 1970-1983, Stand: 14.05.2012
[133] Vgl. B3-HISTORY, Stand: 17.05.2012
[134] Vgl. ARD-CHRONIK, Stand: 15.05.2012
[135] Vgl. BLM SENDERPROFIL BAMBERG, Stand: 15.05.2012
[136] Vgl. RADIO BAMBERG, Stand: 15.05.2012
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieser HTML-Datei?
Diese HTML-Datei enthält einen umfassenden Sprachentwurf zum Thema Hörerbeteiligung im Radio. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Liste von Abkürzungen, Abbildungs-, Tabellen- und Anlagenverzeichnisse sowie Einleitungen und theoretische Grundlagen. Der Fokus liegt auf der Analyse von Hörerbeteiligung bei bayerischen Radiosendern, einschließlich der Ziele, Methoden und Ergebnisse.
Was sind die wichtigsten Themen, die in dieser Datei behandelt werden?
Die wichtigsten Themen sind: die Geschichte der Hörerbeteiligung, verschiedene Arten der Hörerbeteiligung (technische und thematische Unterscheidungen), Ziele und Risiken der Hörerbeteiligung, ausgewählte Beispiele für Hörerbeteiligungssendungen (Hallo Ü-Wagen, Domian), Forschungsergebnisse zur Hörerbeteiligung in bayerischen Programmen sowie die Forschungsfrage und der Untersuchungsgegenstand.
Welche Arten der Hörerbeteiligung werden unterschieden?
Es werden technische (Telefongespräche, Straßenbefragungen, Beteiligung via Internet und Post) und thematische Unterscheidungen (Gewinnspiele, Quizsendungen, Wunschsendungen, Grüße, Meinungsäußerungen, Diskussionen, Beratungen, Hörer als Werbeträger) getroffen.
Welche Ziele werden mit Hörerbeteiligung verfolgt?
Häufig genannte Ziele sind: Hörerbindung, Schaffung von Publikumsnähe, Steigerung der Glaubwürdigkeit, Unterhaltung, Demonstration von Demokratie und Meinungsvielfalt sowie Varianz im Programm.
Welche Risiken birgt die Hörerbeteiligung?
Zu den Risiken zählen die mediale Unerfahrenheit der Hörer, die Störung des homogenen Programms, die Gefahr der Bloßstellung von Hörern, unpassende Themen oder Meinungen und dialektale Einfärbungen der Sprache.
Welche bayerischen Radiosender werden analysiert?
Analysiert werden Antenne Bayern, Bayern 1, Bayern 3, Radio Bamberg und Radio Galaxy Bamberg/Coburg.
Welche Forschungsmethoden werden angewendet?
Es werden eine Inhaltsanalyse der Programme und qualitative Experteninterviews mit Programmverantwortlichen der Sender durchgeführt.
Was sind die wichtigsten Forschungsergebnisse bisheriger Studien?
Die BLM-Studien von 1989 und 1990 zeigen, dass Hörerbeteiligung in bayerischen Programmen eine wichtige Rolle spielt, wobei Antenne Bayern den größten Anteil von Beiträgen mit Hörerbeteiligung aufweist. Wunschsendungen wurden als wichtig angesehen, während Quizsendungen eher negativ bewertet wurden.
Was ist die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welche Ziele verfolgen bayerische Radiosender mit dem Einsatz von Hörerbeteiligung in ihren Programmen (am Beispiel der drei meistgehörten, landesweiten Programme Antenne Bayern, Bayern 1 und Bayern 3 sowie der zwei in der Stadt Bamberg empfangbaren Lokalsender Radio Bamberg und Radio Galaxy Bamberg/Coburg)?
Was ist das Bayerische Medienerprobungsgesetz?
Grundlage für die Entstehung von Radio Bamberg - sowie aller bayerischen Lokalsender - war das Bayerische Medienerprobungsgesetz, das 1985 in Kraft trat und die Entwicklung und Einführung von neuen Rundfunkangeboten ermöglichte.
Details
- Titel
- Hörerbeteiligung in bayerischen Radioprogrammen – Strategie oder Willkür?
- Hochschule
- Hochschule Mittweida (FH)
- Note
- 1,0
- Autor
- Lucie Militzer (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2012
- Seiten
- 118
- Katalognummer
- V207462
- ISBN (eBook)
- 9783656354543
- ISBN (Buch)
- 9783656355298
- Dateigröße
- 966 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Radio Hörer Hörerbeteiligung Beteiligung Hörfunk Bayern Oberfranken Bayern 3 Bayern 1 Antenne Bayern Radio Galaxy Radio Bamberg
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 0,99
- Preis (Book)
- US$ 41,99
- Arbeit zitieren
- Lucie Militzer (Autor:in), 2012, Hörerbeteiligung in bayerischen Radioprogrammen – Strategie oder Willkür?, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/207462
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-