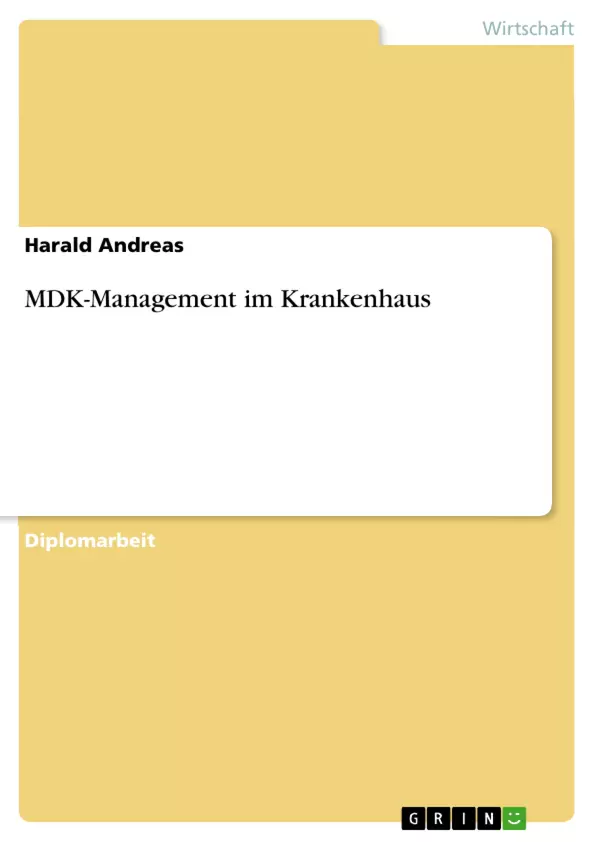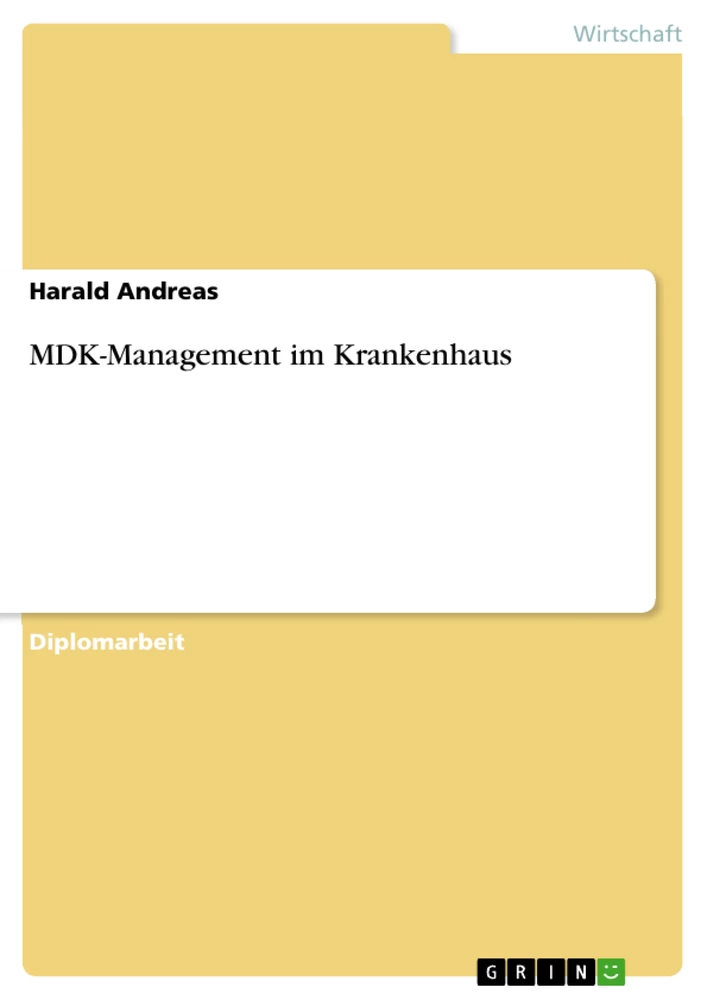
MDK-Management im Krankenhaus
Diplomarbeit, 2012
42 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemaufriss
1.2 Gang der Untersuchung
2 Skizzierung des Gesundheitswesens
2.1 Ambulant
2.2 Stationär
3 Aufbau des DRG-Systems
3.1 Kurzabriss der historischen Entwicklung
3.2 Grundlegende Definitionen und Funktionsweise des DRG-Systems
3.2.1 ICD-10: Internationale Klassifikation der Krankheiten
3.2.2 OPS: Operationen und Prozeduren
3.2.3 ZE: Zusatzentgelte
3.2.4 NUB: Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden.
3.3 Die stationäre Krankenhausrechnung
4 Der MDK
4.1 Aufbau und Finanzierung
4.2 Aufgaben und rechtliche Grundlagen
5 MDK-Prüfung
5.1 Prozessbeschreibung
5.2 Gefahren für Krankenhaus und Krankenkassen
5.2.1 Diskussion von Vor- und Nachteilen der DRG-Einführung
5.2.2 Diskussion Kodierfehler oder bewusste Manipulation
6 Vorgehen bei der MDK-Prüfung bei Krankenhäusern und Krankenkassen
6.1 MDK-Management
6.2 Kosten und Aufwendungen für das MDK-Management der Kliniken
6.3 Vorgehen der Krankenkassen bei der DRG-Fallprüfung durch den MDK
7 Fazit
Literaturverzeichnis
Rechtsquellenverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist das DRG-System im Krankenhaus?
DRG steht für Diagnosis Related Groups. Es ist ein pauschaliertes Abrechnungssystem, bei dem Behandlungen nach Krankheitsgruppen und nicht nach Liegetagen vergütet werden.
Welche Aufgabe hat der MDK (Medizinischer Dienst der Krankenversicherungen)?
Der MDK prüft im Auftrag der Krankenkassen die Abrechnungen der Krankenhäuser auf medizinische Notwendigkeit und korrekte Kodierung (ICD und OPS).
Was versteht man unter MDK-Management?
Das MDK-Management in Kliniken koordiniert die Prüfungsprozesse, bereitet Unterlagen vor und führt Widerspruchsverfahren, um Erlösminderungen durch Rechnungsprüfungen zu vermeiden.
Was sind ICD-10 und OPS?
ICD-10 ist die internationale Klassifikation der Krankheiten (Diagnosen), und OPS ist der Schlüssel für Operationen und medizinische Prozeduren. Beide sind die Basis für die DRG-Ermittlung.
Welche Gefahren birgt die MDK-Prüfung für Krankenhäuser?
Es drohen erhebliche finanzielle Rückforderungen durch die Krankenkassen, wenn Behandlungen als nicht stationär notwendig oder falsch kodiert eingestuft werden.
Details
- Titel
- MDK-Management im Krankenhaus
- Hochschule
- Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Göttingen
- Veranstaltung
- Medizincontrolling
- Note
- 1,7
- Autor
- Harald Andreas (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2012
- Seiten
- 42
- Katalognummer
- V209166
- ISBN (eBook)
- 9783656378891
- ISBN (Buch)
- 9783656379324
- Dateigröße
- 605 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- mdk-management krankenhausabrechnung drg- einführung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 27,99
- Arbeit zitieren
- Harald Andreas (Autor:in), 2012, MDK-Management im Krankenhaus, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/209166
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-